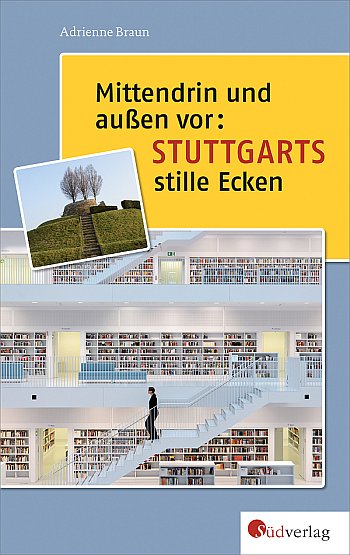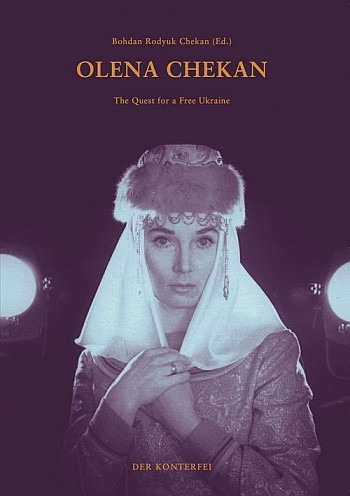Menschen | Luca Crippa / Maurizio Onnis: Wilhelm Brasse
Wilhelm Brasse ist kein Geheimtip, auch wenn der Verlag das unauffällig suggeriert. Irek Dobrowolskis Film mit ihm und über ihn, ›Portretisca‹ (Der Porträtist), lief 2005 im polnischen Fernsehen und seitdem auf vielen internationalen Festivals. Es gab auch in deutschen Medien große Geschichten über Brasse, Erich Hackl hat ihm zwei literarische Reportagen gewidmet, und nach Brasses Tod im Oktober 2012 erschienen Nachrufe in aller Welt. Einen davon, so berichtet das Autorenduo Luca Crippa & Maurizio Onnis in seinem Blog, »hat Maurizio beinah zufällig online gelesen«. So entstand ein Projekt, das tatsächlich bis dato niemand umgesetzt hatte: Die Geschichte von Wilhelm Brasse als Doku-Fiction zu erzählen. Cinéma vérité in Buchform – Der Fotograf von Auschwitz als romanzo-verità. Von PIEKE BIERMANN
 Wilhelm Brasse hat unsere bildliche Vorstellung von Auschwitz geprägt wie kein anderer. Selbst wenn man seinen Namen nicht parat hat – seine Fotos sind auf der kollektiven Netzhaut aller Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg eingebrannt. Porträts von Todgeweihten, als erkennungsdienstlich standardisiertes Triptychon: Profil von rechts / frontal / Halbprofil linkes Ohr frei. Ikonen des Grauens, fast immer namenlos, nur versehen mit Nummern und dem Kürzel ihres »Verbrechens«: J wie Jude, Pol wie Politisch, P wie polnisch, H wie holländisch. Und so weiter.
Wilhelm Brasse hat unsere bildliche Vorstellung von Auschwitz geprägt wie kein anderer. Selbst wenn man seinen Namen nicht parat hat – seine Fotos sind auf der kollektiven Netzhaut aller Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg eingebrannt. Porträts von Todgeweihten, als erkennungsdienstlich standardisiertes Triptychon: Profil von rechts / frontal / Halbprofil linkes Ohr frei. Ikonen des Grauens, fast immer namenlos, nur versehen mit Nummern und dem Kürzel ihres »Verbrechens«: J wie Jude, Pol wie Politisch, P wie polnisch, H wie holländisch. Und so weiter.
Allein mit Bildern
Wilhelm Brasse, 1917 im galizischen Żywiec als Sohn eines österreichischen Vaters und einer polnischen Mutter geboren, wird im August 1940 Häftling Nr. 3444 in Auschwitz, damals noch kein Vernichtungslager, sondern »nur« eins für politische Gefangene aus Polen. Er hatte sich nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen geweigert, Deutscher zu werden, und zu flüchten versucht. Er ist knapp 23, gelernter Porträtfotograf, und er spricht gut Deutsch. Er wird Auschwitz bis zur Auflösung Ende Januar 1945 nicht mehr verlassen, aber er wird überleben: Er ist ein guter Fotograf, so einen können Gestapo und SS gebrauchen, nicht nur für korrekte Aktenführung. Er porträtiert auch SS-Leute, die Fotos für Ausweise benötigen, und macht Abzüge von allem, was sein direkter Vorgesetzter und die anderen uniformierten Fotoamateure so zusammenknipsen an »Genrebildern vom Lagerleben«. Er bekommt auch bestes Equipment zum Retuschieren, die Fotos sollen schließlich »schön« werden – auch die von den schätzungsweise 40-50.000 frisch Deportierten, die er ablichten muss. Im Akkord, ein paar Minuten pro Person. Auch seine jüdischen Nachbarn aus Żywiec sind irgendwann dabei. Bis es der SS 1943 zu teuer wird und sie sich aufs Tätowieren von Nummern auf Arme beschränkt.
Die Ausrüstung ist überhaupt vom Feinsten und, nebenbei, auch brauchbar zum Geldfälschen. Und Brasse ist sowieso am liebsten in der Dunkelkammer, allein mit Bildern. Für Aufnahmen nach draußen zu müssen, heißt, noch Grausameres vor die Linse zu bekommen als Menschen in Todesangst: zum Beispiel die Sterilisierungen, zu denen die furchtbaren Mediziner Wirths und Clauberg den jüdischen Arzt Prof. Samuel zwingen. Oder die nackten jungen Frauen, die ein ausgesprochen höflicher junger SS-Offizier dokumentiert haben möchte. Mengele heißt er. Er macht »medizinische« Experimente an den Frauen. Helfen kann Wilhelm Brasse niemandem. Auch nicht dem tapferen Pater Maximilian Kolbe. Und nicht Rudi Friemel, einem Freund. Friemel ist ein »Politischer«, Spanienkämpfer. Seine Eltern hatten solange alle Hebel in Bewegung gesetzt, bis sie mit Margarita Ferrer und dem gemeinsamen Söhnchen anreisen durften. Zwecks Hochzeit. In Auschwitz. Von Himmler persönlich genehmigt, warum auch immer. Brasse hält ein Familienidyll fest, auch das eine Art Dreifaltigkeit: Mutter / Sohn / Vater. Kurz darauf wird Rudi Friemel ermordet.
Anrührend und spannend
Im Januar 1945 ist das Ende absehbar. Die Rote Armee rückt immer näher. Die SS versucht, ihre Spuren zu vernichten. Brasse bekommt den Befehl, alle Fotos zu verbrennen. Er wirft Abzüge und Negative ins Feuer, aber sobald die SS-Leute gegangen sind, holt er sie wieder heraus. Die Negative brennen nicht. Er verschließt sie in seinem Schrank, in der Hoffnung, dass sie später Zeugnis ablegen können. Er wird nach Mauthausen verfrachtet und endlich im Mai 1945, fast verhungert, von US-Soldaten befreit. Die sowjetischen Soldaten bergen fast 39.000 Fotos, davon knapp 7.000 von Frauen und Mädchen. Sie werden Teil des Archivs der Gedenkstätte Auschwitz.
Es ging ihnen, schreiben Crippa & Onnis weiter in ihrem Blog, darum, »zu erzählen, wie das Bewusstsein eines Menschen von der Sorge um das eigene Überleben überwechselt in den Entschluss, etwas zum Wohl der Menschheit zu tun«. Nämlich: die Bilder zu retten. Dazu wählen sie die Doku-Fiction. Ein durchaus schwieriges Genre, nicht nur, weil man nie sicher sein kann, was am Erzählten authentisch (Doku) ist und was erfunden, womöglich gar manipulativ (Fiction). In Doku-Fiction wird per definitionem von Innen erzählt – in diesem Fall heißt das: aus Brasses Kopf und damit sozusagen »live aus Auschwitz«. Crippa & Onnis tun das fast naiv-unbefangen, so als hätten sie nie von Primo Levi gehört, um nur ein – italienisches – Beispiel zu nennen für die schmerzhaften, skrupulösen Versuche, »Auschwitz zu erzählen«. Aber ihr romanzo-verità ist anrührend und spannend geschrieben. Und vielleicht brauchen Leser, denen Literatur von Überlebenden zu anstrengend ist, ja genau so eine ganz undeutsche Unbefangenheit.
Eine erste Version der Rezension wurde am 19. November 2014 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht, ein Gespräch mit Pieke Biermann ist als Audio on Demand verfügbar.
Titelangaben
Luca Crippa / Maurizio Onnis: Wilhelm Brasse. Der Fotograf von Auschwitz
Aus dem Italienischen von Bruno Genzler
München: Blessing 2014
336 Seiten. 20,60 Euro