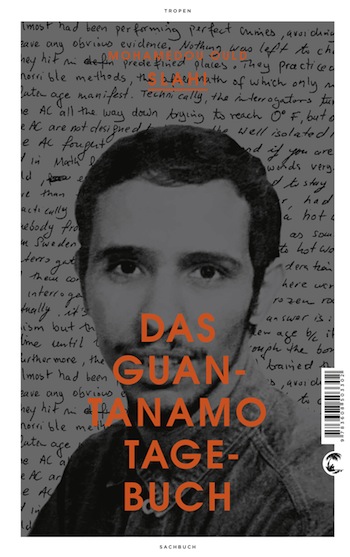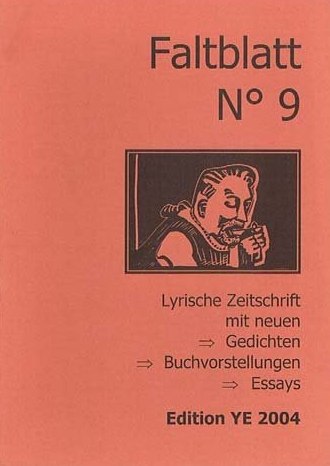Lyrik | René Steininger: In Margine
Die Tier- und Pflanzenwelt steckt voller verborgener Bezüge, Erinnerungen und Schwingungen. Seltsame Allianzen ergeben sich da, von denen der Mensch, wenn er nicht Biologe ist oder affizionierter Fan von Grenzen normaler Sichtbarkeit und Hemdsärmelnähe überschreitenden Naturdokus, noch nie gehört hat. – Betrachtungen zu René Steiningers neuestem Lyrikband In Margine. Von ROBERT SCHWARZ
Sie erinnert
die Erde
an die Kindheit
und verwandelt
das Zittern
eines Spinnennetzes
in Wellen
eines verschwundenen
Ozeans
(Thomisidae – Krabbenspinne)
 In René Steiningers neuem Buch In Margine, das den Bezügen zu Flora und Fauna nachgeht, stolpert man von Seite zu Seite über Eigentümlichkeiten, und manchmal muss man ein wenig nachdenken oder das Füllhorn wikipedia konsultieren. Und staunt und bricht in Lachen aus darüber, wie treffsicher das Tier oder die Pflanze durch einen an unsere bekannte Welt erinnernden Zug gepackt und literarisch präsentiert wird. Die in über 2000 Arten vertretene Krabbenspinne gehört zu den Echten Webspinnen, ist weltweit verbreitet und sieht tatsächlich wie eine Krabbe aus. Eine Krabbe im Netz. Krabbe in schwingendem Netz, Krabbe im Wind.
In René Steiningers neuem Buch In Margine, das den Bezügen zu Flora und Fauna nachgeht, stolpert man von Seite zu Seite über Eigentümlichkeiten, und manchmal muss man ein wenig nachdenken oder das Füllhorn wikipedia konsultieren. Und staunt und bricht in Lachen aus darüber, wie treffsicher das Tier oder die Pflanze durch einen an unsere bekannte Welt erinnernden Zug gepackt und literarisch präsentiert wird. Die in über 2000 Arten vertretene Krabbenspinne gehört zu den Echten Webspinnen, ist weltweit verbreitet und sieht tatsächlich wie eine Krabbe aus. Eine Krabbe im Netz. Krabbe in schwingendem Netz, Krabbe im Wind.
Alles Leben kommt aus dem Meer und Biologen pflegen ja zu sagen, dass das Tier und also auch der Mensch das Meer in sich hat. Das sagt sich leicht, aber der Zusammenhang ist ungeheuer – die Tiefe, die sich dadurch im verkörperten Lebenskontinuum auftut. In dieser inneren, unsichtbaren Chemie zumindest sind und bleiben wir verbunden mit den Ursprüngen des Lebens. Wenn wir wirklich die Krone der Schöpfung sind, als die wir uns aufgrund unserer Intelligenz und unseres Erfolgs als Art vorkommen und wie es im Stolz unserer erhabenen Kulturen behauptet worden ist, dann ist diese Krone auch eine Schaumkrone, die ein ganzes Meer von Leben unter sich hat.
Rosa Luxemburg schrieb in ihren Gefängnisbriefen viel über die Tiere. Sie fühle sich im Gefängnishof unter Hummeln mehr daheim als auf einem Parteitag, ihr Inneres gehöre mehr den Kohlmeisen als den Genossen (zit. n. Bernhard Kathan: Wir sehen Tiere an). »Sie fragen, wozu das Alles? Wozu – – ist überhaupt kein Begriff für die Gesamtheit des Lebens und seine Formen. Wozu gibt es Blaumeisen auf der Welt? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich freue mich, dass es welche gibt, und empfinde es als süßen Trost, wenn mir plötzlich über die Mauer ein eiliges Zizi bä aus der Ferne herübertönt.«
Was von den fernen Ufern der Tierwelten zu uns herüberschwappt, belebt und öffnet den Raum für nicht weiter artikulierbare Resonanzen, wir können nicht genau sagen, warum, aber solchen Momenten der Berührung oder der versunkenen Beobachtung wohnt ein Zauber inne. Als Menschheit, die selbst an der Schwelle der Frage nach dem eigenen Überlebenkönnen steht, sind wir Zeugen einer eigenartigen und traurigen Dialektik:
Präparate
hinter Museumsvitrinen
rufen kein Gelächter
hervor
wie im Zoo
die Laute der Tiere
und ihre kleinen
komischen Gesten
(…)
Erst ausgestorben
sind sie für uns
sterblich geworden
(Einen Tasmanischen Tiger betrachtend)
Wie die letzten Heiligen bekommen Tiere einen Wert durch ihre äußerste Bedrohtheit, oder dadurch, dass sie schon verloren sind, und plötzlich sind ihre spärlichen Überbleibsel Reliquien in Museumsvitrinen und wir stehen davor, berührt und trauernd. Auch Tiere, sonst austauschbar, da namenlos, sind sterblich. Der Ruf dieser einen Art wird uns nicht mehr erreichen, er wird nur unsere Hirne und unser Gemüt beschäftigen, falls wir uns überhaupt dafür interessieren. Oder doch als metaphysische Flaschenpost von jenseits des Grabens die metaphysische Seite in uns zum Schwingen bringen?
René Steininger Gedichtband bietet sich als Arche (»Jedes Gedicht ist eine Arche«, Günter Kunert) an, und es ist ein wenig unheimlich, sie zu betreten. Die Fahrt selbst, darin liegt die physiognomische und sympathetische Kunst dieses Autors, wird nicht traurig sein, trotz des erschreckenden Hintergrunds, dessen Zeugen wir an der Schwelle unserer eigenen großen Frage sind. Nur zur Erinnerung: Die Naturgeschichte unseres Planeten kennt mehrere Zeiten des Wandels und Übergangs, in denen – wahrscheinlich aufgrund klimatischer Verschiebungen – eine sehr große Anzahl von Arten verschwand. Diese Zeiten dauerten aber sehr lange, es handelt sich um Perioden von Hunderttausenden oder Millionen Jahren. Arten sterben immer aus.
Nach einer Analyse des Magazins ›Science‹ hat sich die Geschwindigkeit dieses »normalen« Sterbens aber um das 1000-fache beschleunigt. Im Durchschnitt hat sich die Anzahl der in der Untersuchung erfassten Säugetiere (Vögel, Amphibien, Reptilien, Fische), wie der WWF in seinem ›Living Planet Report‹ bekanntgibt, seit den 70er Jahren halbiert. Hot Spots des Schwunds liegen vor allem in den Weltmeeren und in den Tropen, wo die Habitate aufgrund der Abholzung schrumpfen. Andererseits sind die Bemühungen sehr stark gewachsen, das Überleben einzelner bedrohter Tierarten zu sichern. Der Bestand des Nepalesischen Tigers konnte in kurzer Zeit um zwei Drittel erhöht werden.
Aber darum geht es in diesem Buch nur am Rande. Zwar will das empörte Hausschwein seine Trüffel zurück und gibt dafür gerne die wahrscheinlich falschen Perlen wieder her, die man ihm in den Saustall geworfen hat, wie es auf Seite hundert in einer »Anzeige« bekannt gibt. Nur einmal wird in diesem Buch den Tieren von menschlicher Seite direkt der Krieg erklärt, im »Bericht aus Shandong«, aus dem ich hier zitieren darf: »Den größten Sprung nach vorn habe man unterdessen freilich in den Schlafzimmern der schmutzigen und verlausten, unterentwickelten Landbevölkerung gemacht. Dort habe man nämlich im Anschluss an die siegreiche Große Spatzenkampagne im Namen der Partei den Bettwanzen öffentlich und feierlich den Krieg erklärt. (Passer montanus – Feldsperling)« Auf der Arche bleibt uns dieses Gemetzel ansonsten erspart und wir bekommen unscheinbare Schätze zu Gesicht und betreten große, freie Räume.
Der Anthropologe Claude Lévi-Strauss, Träger eines Vogelnamens übrigens, äußerte einmal in einem Interview den Wunsch, die Welt als Vogel wahrzunehmen: »Ich hätte mich gern einmal richtig mit einem Tier verständigt. Das ist ein unerreichtes Ziel. Es ist fast schmerzhaft für mich zu wissen, dass ich nie wirklich herausfinden kann, wie die Materie beschaffen ist oder die Struktur des Universums. Das hätte für mich bedeutet, mit einem Vogel sprechen zu können. Aber da ist die Grenze, die nicht überschritten werden kann. Diese Grenze zu überschreiten, würde für mich das größte Glück bedeuten.« Der europäische Gelehrte konnte übrigens auch eine mentale, kulturelle Grenze nicht überschreiten, denn in den schamanischen Kulturen ist so eine Verwandlung mit Hilfe der Geister der Tiere und manchmal auch der großmütigen Unterstützung eines mächtigen Pilzes oder einer weisen Pflanze, Ayahuasca zum Beispiel, gar keine Kunst. Die reine Denkmöglichkeit dieses Glücks konnte oder wollte der Strukturalist nicht zugeben.
In Steiningers gelehrtem Buch wird ein Schakal (»Fragebogen nach Proust«) nach seiner Definition des Glücks gefragt: »Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? – Die Fortuna eines faulen Jägers: Aas.« Der Lyriker »mag, was Vögel in den Himmel schreiben«. Aber entscheidender ist, dass auf dieser Arche jede Art Raum für ihre Besonderheit bekommt. Die Tiere sind nicht »gut«, sie sind nicht »besser als« der Mensch, sie sind hier vielmehr mit dessen eigenen Unvollkommenheiten und Vollkommenheiten geschlagen, beglückt. Auf einer Ebene sind die meisten dieser Texte als contes moraux, moralische Geschichten zu lesen, die – noch einmal – ein Pandämonium des Menschlichen entwerfen. Das Leben ist gut, wenn man es nicht an zu großen Ansprüchen und an falschen Horizonten misst.
Die Gebrechlichkeiten, die kleinen Vergnügen und Eigenwilligkeiten, sogar die Katastrophen geben ihm seinen unvergleichlichen Reiz, seine Vielfalt. Die Tiere sprechen sich hier durch menschliche Charakter- und Sprachmasken aus, was der Autor sehr listig und witzig dadurch verstärkt, dass jede Art durch eine besondere literarische Form (hohes menschliches Kulturgut! neben banalen Sprachformen wie »Gebrauchsanweisung«, »Nachrichten«, »Klatsch und Tratsch«) kommuniziert. Die Tiere treten auf als Narren, als Verlorene, Liebende, Entbehrende, Trauernde, Triumphierende. Was den Menschen abhandengekommen ist, die Tiere zeigen es im Übermaß: den Sinn für das Menschliche.
Sicherlich ist das ein ironisches Spiel mit Spiegeln. Aber darin steckt menschliche Sympathie für diese – anderen – Brüder und Schwestern. Dem, der nur nach Witzen sucht, wird entgehen, dass unter der Maske des menschlich Bekannten das Unbekannte und Seltene von Lebensformen aufblitzt, die für unser Verständnis kaum greifbar sind. Man muss sich sinken lassen in dieses Meer, berühren lassen, betrachten, staunen.
Die Schönheit der Ordnung des sich organisierenden Lebens, das auch chaotisch ist, das eingefangen wird in Farbe, Geometrie, Bewegung, Funktion und Schall und dann wieder ausbricht, das kollektiv ist und singulär, gerettet und verloren, lässt sich ja sprachlich kaum fassen. Die Künstler sind selbst Imitatoren, wie Aristoteles gesagt hat. An diesem Buch In Margine gefällt mir, dass es den Tieren und Pflanzen so viel Platz gibt, Raum zum Atmen sozusagen. Kurze Anmutungen leisten mehr als lange Beschreibungen. Das Tier wird greibar und bleibt ungreifbar. Und wir schmecken etwas von dem, was uns wohl schon durch unsere Vorgeschichte begleitet hat: (nicht nur der Schrecken, sondern) die Freude der Begegnung.
Am Ende stirbt auch homo erectus aus, der »ein primus inter pares unter Affen« gewesen ist.
Statt Touristenschwemmen
verstreute HordenStatt Reizwäsche
ein sittigender LendenschurzStatt mehr Hirnmasse
massenhaft anderes Leben
Einen Weg zurück gibt es für uns wohl nicht. Aus 7,3 Milliarden menschlicher Erdbewohner werden es – wenn nicht etwas Unvorhergesehenes dazwischenfunkt – gegen Ende dieses Jahrhunderts 9 oder 9,5 Milliarden sein, dann sollte der rein quantitative Höhepunkt unseres Wachstums in die Breite erreicht sein, prognostizieren die Demographen. Unsere eigene Frage ist also offen, die nicht nur unsere Frage ist, weil viele andere mit uns im gleichen Boot sitzen. Was braucht der Mensch, um »vielleicht doch noch einmal zum homo sapiens zu werden«, wie Vera Birkenbiehl so treffend zu formulieren pflegt?
Sicher ist es notwendig, den weiten, offenen Raum, das Meer in uns nicht zu verachten. Die Fähigkeit, dem anderen – Mensch oder Tier – auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, dürfte dazugehören. Und das eine oder andere literarische Vergnügen.
| ROBERT SCHWARZ
Titelangaben
René Steininger: In Margine
Buxtehude: Verlag Rote Zahlen 2014
132 Seiten, 18,65 Euro