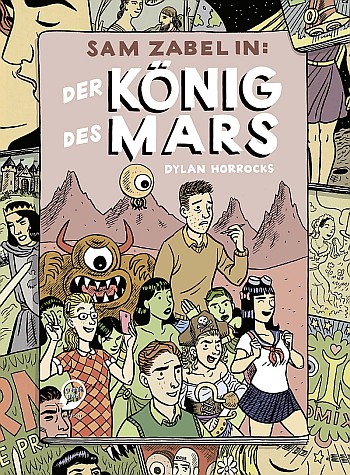Menschen | Zum Tode von Günter Grass
Vor zehn Tagen verstarb der Autor Günter Grass. Sein Tod löste Erinnerungen an ein Gespräch im Jahre 1999 aus, das PETRA KAMMANN, damalige Chefredakteurin des BuchJournal, mit dem streitbaren Schriftsteller und Bildhauer, Citoyen und Geschmähten in Lübeck führte.

Günter Grass auf allen Kanälen. Keine Tageszeitung hat die Berichterstattung ausgelassen. Und Sie sind der am besten dokumentierte deutsche Nachkriegsschriftsteller. Wie ist es, wenn man nach zwanzig Jahren den Nobelpreis endlich bekommt? Fühlen Sie sich mehr von ausländischen Kollegen verstanden und akzeptiert? Oder sehen Sie, dass die deutsche Literaturkritik, die Sie vor allem nach Ihrem letzten Roman so schlecht behandelt hat, nun eingelenkt hat?
Das ist eine komplexe Frage. Ich habe ein unermessliches, noch gar nicht überschaubares Echo bekommen. Und es hört auch noch gar nicht auf. Gerade habe ich ein Telegramm von Gabriel García Marquez bekommen, das in etwa sinngemäß so lautet: Er umarme mich. Er aber habe mir etwas voraus, dass er nämlich wisse, was auf mich zukommt. Und er bedaure das. Damit hat er auf die mit dem Nobelpreis zusammenhängende Last angespielt. Ich glaube nicht, dass das so übermäßig sein wird. Wenn man mir das vor etwa 20 Jahren gesagt hätte, ich wäre in der engeren Wahl, wäre das sicher eine Last für mich gewesen. Damals noch mitten im Werk, da war noch vieles angedacht und unausgeführt. Da hätte man mich als den Nobelpreisträger abgestempelt und hätte von Buch zu Buch hohe Erwartungen gehabt. Die habe ich selbst seit Erscheinen der »Blechtrommel« ohnehin gehabt. Das hätte sich wieder verstärkt. In meinem Alter, jenseits der siebzig, kann ich mich ganz ungeteilt darüber freuen. Was den zweiten Teil Ihrer Frage betrifft, da gibt es natürlich einige Stimmen, die führen sich ziemlich auf. Und diese Stimmen kommen vorzugsweise aus der Springer-Presse. Sie verschweigen dem Publikum ihrer Zeitung den ganzen Inhalt der Begründung. Die ist nämlich sehr weitläufig ausgefallen.
Die Schwedische Akademie hat sich ja wohl auf Ihr Gesamtwerk bezogen.
Es fängt mit der »Blechtrommel« an, geht auf den »Butt« ein, auch auf meine politische Arbeit und endet bei »Mein Jahrhundert«. Das wird bei den Kritikern dieser Journale unterschlagen. Sie argumentieren so: Wenn er denn schon den Preis bekommt, dann nur für die »Blechtrommel« – eine mir altbekannte These. Im Goethejahr darf ich ja den Vergleich zu Goethe ziehen. Goethe hat Zeit seines Lebens gesagt – er hat hoffentlich nicht darunter gelitten – es sei ihm nicht eingefallen, ein zweites »Die Leiden des jungen Werther« oder noch einen »Götz« zu schreiben. Das ist so fern der Literatur und so töricht, dass man nur darüber lachen kann.
Fühlen Sie sich eigentlich Goethe nahe? Schließlich war auch er ein vielseitig begabter Künstler und ein anschaulicher Dichter. Und was die Genres betrifft, die Goethe beherrschte: Er war Lyriker, Zeichner, Dramatiker, Erzähler.
Nicht nur das. Was gerne unterschlagen wird: dass dieser Mann sich zeit seines Lebens mit den politischen Tendenzen seiner Zeit herumgeschlagen hat, was sich auch in seinem Werk widerspiegelt. Aus der Sicht heutiger kurzsichtiger Literaturkritiker wäre »Hermann und Dorothea«, worin er gegen die französische Revolution plädiert, ein reines Tendenzstück. Nach den napoleonischen Befreiungskriegen hatte er eine starrsinnige, man kann auch sagen standfeste Haltung. Er hatte sich nun einmal zu Napoleon bekannt. Und mit Deutschtümelei hatte er wenig an seinem berühmten Hut. Von Ähnlichkeiten will ich da nicht sprechen. Ich will nur sagen: Der große Goethe war zeit seines Lebens auch mit Politik beschäftigt.
 Fühlt man sich in Lübeck insofern stärker Thomas Mann oder Willy Brandt verwandt?
Fühlt man sich in Lübeck insofern stärker Thomas Mann oder Willy Brandt verwandt?
Also, Politiker will ich eigentlich nicht werden. Ich glaube, dass der wesentliche Unterschied ist, dass der Begriff des Bürgers in Goethes Zeit der Begriff des »Citoyen« war, der in der Französischen Revolution gefordert und gefördert wurde. Ich handelte als engagierter Bürger, der Schriftsteller von Beruf ist. Ich sehe das auch nicht als Gegensatz an, sondern als andauernde Notwendigkeit, weil Demokratie etwas ist, was ständig neu erobert werden muss. Wir konnten erfahren, dass die »Weimarer Republik« u.a. daran gescheitert ist, weil es nicht genügend »Citoyens« gab, d.h. engagierte Bürger, die sich für die schwach begründete erste deutsche Republik eingesetzt haben.
Sehen Sie die Gefahr auch heute? Viele junge Autoren nehmen ihre Pflicht als »Citoyen«, so wie Sie es verstehen, nicht wahr. Sie sind sich selbst genug. Worauf führen Sie diese Haltung zurück?
Ich bedaure das außerordentlich.
Hängt es vielleicht damit zusammen, dass Sie selbst einer Generation angehören, die als Luftwaffenhelfer den Krieg noch mitgemacht und dann hinterher erlebt hat, was die Auswirkungen des Krieges bedeuten? Und was es dann heißt, eine Demokratie aufzubauen und zu erkennen, welch schützenswerte Einrichtung das ist?
Da ist ja auch ein rechter Terror auf der Straße. Wir haben demagogische Politiker, die Unterschriftensammlungen gegen die neue Staatsbürgerschaft inszenieren und dadurch Wahlergebnisse beeinflussen können. Ein Glück, dass kein Haider da ist. Aber das kann ja noch kommen. Was die Gründe der Schriftsteller angeht, so kann ich nur vermuten. Ein Grund ist sicher, dass seit geraumer Zeit in den Feuilletons zwar gelegentlich eine Stellungnahme von den Schriftstellern erwartet wird, in der ihre Haltung zum Krieg und zum Kosovo abgefragt wird, aber dass ihnen gleichzeitig empfohlen wird, den Elfenbeinturm zu beziehen und sich abseits der Politik zu halten. Da zucken sie zurück und wagen nicht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Der Feuilletonist Tilmann Krause verhöhnt Sie als »Praeceptor Germaniae«. Glauben Sie nicht, dass hinter dieser Äußerung auch die Angst vieler Deutscher steht, sich so etwas nachsagen zu lassen und sie sich deswegen auch nicht engagieren? Sehen Sie da eine Trendwende?
Krause ist Repräsentant der Springer-Presse und das ist reine Tendenz. Das spiegelt sich auch in anderen Blättern. Es wird zu einer nationalen Frage gemacht. Mein Verständnis von Literatur ging immer über Grenzen hinaus. Ich habe das bei Hans Werner Richter in der Gruppe 47 gelernt. Er sprach immer zu Recht von deutschsprachiger Literatur. Und von Anfang an hat er Autoren aus Österreich und der deutschsprachigen Schweiz und auch aus der DDR eingeladen, wenn auch oft vergeblich, weil sie kein Visum bekamen. Ich habe diesen Preis übrigens auch nicht als deutscher Schriftsteller erhalten, sondern als deutschsprachiger. Und das Echo, die Freude darüber, kommt aus dem Ausland, ganz stark und ungeteilt.
Sie hatten schon sehr früh Kontakte zur DDR. Und nun haben Sie, als Sie erfuhren, dass Sie den Nobelpreis bekommen, gesagt, Sie würden ihn am liebsten mit Christa Wolf teilen. Warum? Weil sie eine DDR-Autorin ist? Oder wie ist die Begründung?
Wir sind ja beide nicht vom Himmel gefallen. Wir stammen beide aus der Tradition der deutschsprachigen Literatur, gemeinsamen Geschichte und deren Folgen. Es ist zwar gelungen, durch Zutun der beiden deutschen Staaten, die Teilung des Landes mehr und mehr zu vertiefen. Aber es ist nie gelungen, die deutsche Literatur, was die beiden deutschen Staaten angeht, so grundlegend zu teilen, wie es ideologisch geschehen war. Es gab immer eine Korrespondenz zwischen den beiden Literaturen in der Bundesrepublik und in der DDR, mit streitbarem Dialog. Aber es gab diese Verbindung. Die war nicht abzureißen. Da kam mir der Gedanke, es wäre eine Möglichkeit gewesen – und sicher dem Prozess der deutschen Einheit förderlich –, wenn wir beide den Preis bekommen hätten.

Foto: „Blaues Sofa“
Nein. Das kann ich nicht sagen. Von meiner Herkunft her fühle ich mich der Geschichte der Stadt Danzig und der Geschichte der Bevölkerung verbunden, auch verwandtschaftlich, so dass ich auch ein emotionales Verhältnis zu Polen und auch ein genauso engagiertes Lesepublikum in Polen habe. Es wäre sicher ein interessanter Dialog zwischen polnischen und deutschen Germanisten und Literaturkritikern, sich darüber Gedanken zu machen, in wieweit es auch Unterschiede in der Rezeption gibt, den »Butt«, die »Rättin« und das letzte Buch eingeschlossen. Darin kommt nicht nur immer wieder Danzig, Gdansk und Polen vor, sondern es ist Teil einer nicht nachlassenden Obsession von mir. Diese Obsession ist Resultat des Verlustes von Heimat. Auch sozial. Ich komme eben aus einer Flüchtlingsfamilie. Das hat mir vielleicht auch ermöglicht, mich in die Situation der Bürger der DDR zu versetzen, die von uns als die »armen Brüder und Schwestern« behandelt wurden. Das hört offenbar nicht auf, obgleich die Mauer dankenswerterweise gefallen ist. Außerdem kann ich mich auch in die Situation von Kosovo-Flüchtlingen hineinversetzen und Partei ergreifen.
Warum haben Sie Ihr letztes Buch »Mein Jahrhundert«, das aus vielen Einzelgeschichten besteht, nicht subjektiv angelegt und aus Ihrer eigenen Anschauung gesprochen? Wäre das nicht authentischer gewesen?
Ich wollte die Geschichte durch viele Stimmen wiedergeben. Und zwar von Menschen, die nicht Geschichte gemacht haben, auch gar nicht Geschichte machen konnten, denen Geschichte widerfahren ist – unausweichlich. Die man zu Opfern oder Tätern gemacht hat und zu Gejagten. Aus dieser Perspektive wird jeweils sehr persönlich erzählt. Dabei ist die Geschichte zwar immer präsent, oft aber nur im Nebensatz. Große Ereignisse werden absichtlich verkleinert, d.h. auf menschliches Maß gebracht. Es ist nicht nur die Politik, die eine Rolle spielt. Es sind auch die Sportereignisse oder Erfindungen wie die Erfindung der Schallplatte, die Medienerfindungen, die wieder einen Reflex im Politischen haben. Das zieht sich wie einer der roten Fäden durch das Buch. Das war Absicht und die bewusste Konzentration auf das, was als deutsche Geschichte ausgegraben ist und welche Folgen es hatte. Die erste Hälfte des Jahrhunderts ist nun einmal durch zwei Weltkriege bestimmt gewesen, und die zweite Hälfte bis ins nächste Jahrtausend hinein haben wir an den Folgen zu tragen.
Da Sie nicht nur von sich sprechen, mussten Sie viel Archivarbeit leisten. Was haben Sie denn alles ausgewertet?
Ich habe mit einem jungen Historiker zusammengearbeitet. Ich musste mich ja für jedes Jahr entscheiden. Diese Vorentscheidung habe ich getroffen, sei es zum Rathenau-Mord, der einen wichtigen Vorgang der Weimarer Republik kennzeichnet, sei es zur ersten deutschen Fußballmeisterschaft in Hamburg-Altona. Und dann bestand die Schwierigkeit darin, aus diesem Wust an sehr trockenem Material eine Geschichte zu erzählen.
Welcher Art war das Material? Erlebnisberichte und Briefe?
Es waren Briefe, ein paar unbekannte Zeitungsberichte. Da fiel beispielsweise auf, dass die Sprache vom Englischen geprägt war, weil der Fußball aus England kam. Da war von goal und von half time die Rede.
Sie verwenden ja auch verschiedene Dialekte, wie Rheinisch und Ruhrpöttisch. Wie konnten Sie sicher sein, den jeweiligen Ton zu treffen?
Das ist Arbeit. Und das muss ein Schriftsteller können. Manches habe ich gegenlesen lassen. Wie sich im Schreibprozess herausstellte, ist das ja eine Möglichkeit, eine Art Topographie Deutschlands zu erstellen, weil die Geschichte an verschiedenen Orten stattfindet, wenngleich Berlin häufiger vorkommt als andere Orte. Aber es sind die Kleinstädte, die eine Rolle spielen. Die Reichskristallnacht, wie sie später genannt wurde, wird nicht in Berlin oder Hamburg geschildert, sondern in Esslingen. Als ich über den Ersten Weltkrieg schreiben wollte, war mir klar, dass es darüber eine ganze Bibliothek Literatur gibt. Ich wollte aber eine andere Erzählperspektive gewinnen und habe ein Dichtertreffen arrangiert.

Foto: Gorup de Besanez
Ich habe das in Zürich arrangiert, sie taten das ja im Auftrag einer Schweizer Rüstungsfirma Oerlikon-Bührle. Und sie treffen sich in ungeheurer Zeitdistanz, nämlich Mitte der 60er Jahre während des Vietnamkriegs. Wenn die Amerikaner Giftgase, Entlaubungsmittel und Napalm einsetzen, so ist das die Fortentwicklung der Schrecken der Materialschlachten, die im Ersten Weltkrieg ausgetragen wurden.
Haben Sie eigentlich für Ihre frühen Romane auch soviel Recherchearbeit betrieben wie in den letzten Jahren, vor allem bei »Ein weites Feld«, oder waren Ihnen die Dinge aus der Erinnerung geläufig?
Das war bei allen Büchern der Fall, auch im »Butt«. In der »Blechtrommel« wie in den »Hundejahren« gab es einen historischen Hintergrund. Damals gab es nur wenig historisches Material über die »Polnische Post« oder über Danzig. Diese Stadt hatte ihre glücklichste Zeit über 300 Jahre unter der Krone Polens gehabt und war reich genug, die Schulden des polnischen Königs jeweils zu bezahlen. Das Ganze im Verbund mit der Hanse, so wurde sie zu einer blühenden Handelsstadt. Der Niedergang der Stadt spiegelt sich in dem Augenblick wider, in dem sie preußisch wird.
Sie sind nicht nur ein politisch, sondern auch ausgesprochen historisch interessierter Mensch. Dabei beklagte Ihre Mutter, dass Sie nicht einmal Abitur gemacht haben. Wo haben Sie die Recherche-Methoden erlernt? Oder hatten Sie ein Schlüsselerlebnis?
Als Dreizehnjähriger habe ich ganz dilettantisch auf einem großen Blatt Papier die politischen Ereignisse notiert und Rubriken entworfen und zeitlich parallel die großen Entdeckungen und Kulturereignisse aufgezeichnet. Ich wollte mich nicht nur an die Schlachten und Friedensschlüsse halten. Es sah aus wie der Stein’sche Kultur-Fahrplan. Das mag prägend gewesen sein.
Und was hat Sie schließlich bewogen, eine ganz andere Laufbahn, die künstlerische, einzuschlagen und zunächst einmal eine Steinmetzlehre zu machen?
Germanistik oder Geschichte zu studieren wäre mir ohne Abitur nicht in den Sinn gekommen. Ich suchte Lehrer. Angefangen von meinem ersten Steinbildhauermeister, dem alten Herrn Singer, der das Bismarck-Denkmal in Hamburg gemeißelt hat. Später in Düsseldorf auf der Kunstakademie war Otto Pankok für mich prägend, in Berlin dann Hans Hartung. Ich habe immer Meister gesucht und gefunden. Zwei Essays habe ich über Döblin geschrieben. Einer davon heißt »Mein Meister«. Von ihm habe ich viel gelernt, was das Prosaschreiben, aber auch was die Haltung, keine Doubletten zu schreiben, angeht. So ist es mir nie eingefallen, eine zweite »Blechtrommel« zu schreiben.
Wie steht es mit den Verlegern? Es gibt einige Verleger, zu denen Sie ein sehr persönliches, produktives Verhältnis hatten. Reifferscheid von Luchterhand, Kurt und Helen Wolff, Ihre amerikanischen Verleger, und jetzt zu Gerhard Steidl?
Viele Jahre Reifferscheid, bis er hinter dem Rücken der Autoren den Verlag verhökert hat. Das habe ich ihm übel genommen. Und Helen Wolff vermisse ich sehr seit ihrem Tod. Sie und ihr Mann haben in Amerika die schwierige deutsche Literatur an den Leser gebracht: Uwe Johnson, Max Frisch, Reinhard Lettau, Schädlich. Man muss nur wissen, dass diese Generation der deutschen Emigranten bald nicht mehr da sein wird.
Wie wichtig ist heute noch ein Verleger, da die meisten Bücher in den großen Verlagshäusern entstehen? Kann ein Verlag noch in der Weise hinter den Autoren stehen, wie es damals im Autorenstatut des Luchterhand Verlags verankert worden ist?
Das hat leider nicht Schule gemacht. Ich selbst stand damals, nachdem der Verlag verhökert und von den Verlegerinnen heruntergewirtschaftet worden ist und dort keine Bleibe mehr für mich war, vor der Frage, ob ich zu einem großen oder engagierten kleinen Verlag gehen sollte, der mir Möglichkeiten gab, die mir ein großer Verlag nicht bietet. Ich entschied mich für Gerhard Steidl. Der arbeitet mit einer eigenen Druckerei, was für mich sehr wichtig ist.
War es das Handwerkliche, das Steidl für Sie so anziehend gemacht hat?
Das verbindet uns. Hier hatte ich die Möglichkeit, »Mein Jahrhundert« und davor die »Fundsachen für Nicht-Leser« mit Aquarellen zu veröffentlichen. Angefangen haben wir mit meinen Radierungen »Kupfer auf Stein« und was noch bei Luchterhand erschienen ist, »Zunge zeigen«, also Bücher mit Zeichnungen von mir. Da konnte ich bis zum Andruck dabei sein. Das hat mich animiert.
Hatten Sie nicht Angst, dass die Literatur dabei auf der Strecke bleibt, weil Steidl kein Literaturverleger war?
Nein. Steidl hatte auch Bücher von isländischen und deutschen Autoren herausgebracht, dann die Staeck-Plakate. Und er ist ein linker Verleger, was auch für mich ausschlaggebend war. Er ist nämlich kein Verlagsmanager. Das hat mich gereizt, mit ihm zusammenzuarbeiten, und das geht auch wunderbar.
Mit welcher Utopie gehen Sie eigentlich als erfolgreicher Schriftsteller in das neue Jahrhundert bzw. Jahrtausend?
Ich halte es mit dem Mythos des Sysiphos von Camus, dass der Stein nie oben liegen bleibt. Nichts hasse und fürchte ich mehr als Ideologien, die mir einen Endzustand, den glücklichen Menschen, beschreiben. Was die Literatur betrifft, so hoffe ich, dass sie wieder subversiver und anstößiger wird, – auch unterhaltend, aber nicht nur.
| PETRA KAMMANN
Das Interview erschien im Buchjournal 4/1999 unter dem Titel ›Trommelwirbel für Günter Grass‹