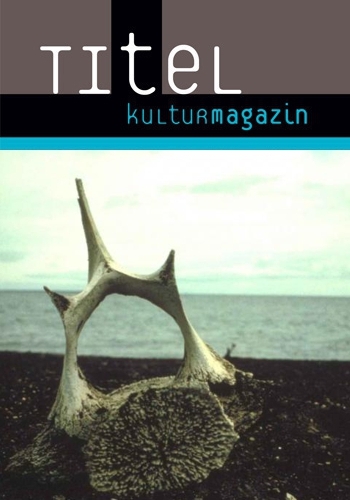Seit 1979 führt der 1929 in Berlin geborene, heute auf dem Lande bei Itzehoe (Schleswig-Holstein) lebende Lyriker, Essayist und Prosaist Günter Kunert seine mittlerweile auf 1500 Seiten angewachsenen »Sudelbücher«, die er auch noch heute fortsetzt. Aus diesem allmorgendlichen Selbstgespräch, das sich nun über 25 Jahre schon mit »Gott und der Welt«, Lektüren und Erinnerungen, Träumen und tagesbezogenen Reflexionen beschäftigt, hat jetzt, zu Kunerts 75. Geburtstag, Hubert Witt eine umfängliche Auswahl unter dem Titel »Die Botschaft des Hotelzimmers an den Gast« herausgegeben. Von WOLFRAM SCHÜTTE
 Der Herausgeber war auf Kunerts Wunsch als Auswähler aus dem »Big Book« tätig geworden, damit der Autor nicht zur Überarbeitung der spontan niedergelegten Tagebuch-Notizen »verführt« wird und »um die Gefahr der Selbstzensur zu verringern«. Denn der Einblick ins Intimste verlangt nach einer fremden Instanz, die Distanz hält.
Der Herausgeber war auf Kunerts Wunsch als Auswähler aus dem »Big Book« tätig geworden, damit der Autor nicht zur Überarbeitung der spontan niedergelegten Tagebuch-Notizen »verführt« wird und »um die Gefahr der Selbstzensur zu verringern«. Denn der Einblick ins Intimste verlangt nach einer fremden Instanz, die Distanz hält.
»Intim« ist das nun zuletzt auf 338 Seiten eingeschmolzene Kondensat jedoch gewiss in einem existentiell rückhalt- und auch rücksichtslosen Sinne immer noch, weil es uns ins Chambre separeé, d.h. »unter die Hirnschale« des Autors führt – unmittelbarer als jedes seiner Gedichte oder seiner Essays, Reiseberichte und Betrachtungen, aus denen wir diesen unsentimentalen Melancholiker und apokalyptischen »Schwarzseher« schon kennen.
Denn unter allen derzeit deutsch schreibenden Autoren ist Günter Kunert, der vor einem Vierteljahrhundert endgültig die DDR verlassen hat (nachdem er schon zuvor oft längere Zeit »im westlichen Ausland« als Reisender und poet-in-residence sich aufhalten konnte), der aufs Große und Ganze pessimistischste Schriftsteller. Weit hinausgehend über Günther Anders, der die »Antiquiertheit des Menschen« in der von ihm hergestellten industriellen Zivilisation konstatierte, ist für Kunert der Mensch als Spezies ein »Irrläufer der Evolution«, und alle individuellen und kollektiven Versuche, seinen Irrlauf in die von ihm angerichteten Katastrophen zu stoppen oder gar umzukehren, sind zum Scheitern verurteilt, weil selbst radikalste Selbstaufklärung – die Kunert als »Chronist des Beiläufigen« gerade nun hier noch mehr als schon in seinem publizierten Oeuvre en détail betreibt – den ultimativen »Big Bang« nicht verhindern wird.
Hoffnung? Lachhaft!
In einem der letzten Stücke dieser Summa der Kunertschen Weltsicht(ung) gibt er als einen der hauptsächlichen unter den vielen Gründe für seine eigene Hoffnungslosigkeit an, dass er in der »undefinierten, faktenunkundigen und unbegründbaren Hoffnung (…) der meisten Zeitgenossen« nichts anderes erkennen kann, als eine »säkularisierte christliche Erwartung«. Seit die Aufklärung die transzendentale Vertröstung aufs »Himmlische Jerusalem« in die »mittels des technischen Fortschritts zu verwirklichende soziale Utopie« verwandelt habe, sei »die Hoffnung der Realität ausgeliefert« worden, von der »sie stets und ständig desavouiert« werde.
Nun ja, das ist banal und trivial. Der alte Bloch, der Dr. Spes, hat auf die Frage, ob Hoffnung enttäuscht werden kann, geantwortet: »Natürlich kann sie das. Sonst wäre sie ja keine. Solange aber noch nicht alles verloren ist, ist auch noch nicht die mögliche Rettung ausgemacht«. Für Kunert, der in diesem Falle seinen von im selbst zugesprochenen »Wohnort Ambivalencia« verlässt, um manichäistisch auf die Pauke zu hauen, ist aber gerade diese Unentschiedenheit, bei der er so etwas wie eine autosuggestive »Überlebensgarantie der Menschheit« am Werk sieht, die »wesentliche Voraussetzung für den unbewusst bewirkten Suizid«. Paradox gesprochen, aber nicht in Kunerts Worten, könnte man seinen trostlosen Pessimismus derart formulieren: Nur wenn wir alle wüssten, dass wir nicht zu retten sind, könnten wir uns möglicherweise retten. Aber weil wir »unglücklichen Geschöpfe, die weder ganz Geist noch ganz Fleisch sind« und diese gattungsbedingte Schizophrenie verdrängen, richten wir uns und den Planeten zugrunde. Kurz, gut und schlecht: was immer Du tust, es ist umsonst – in Ansehung des vorprogrammierten Weltendes. Ob wir »in Gottes« oder bloß in unserer Hand sind, scheint einerlei für den erklärten Atheisten Günter Kunert.
Heiter als absoluter Pessimist leben
Es ist, um das Paradox der menschlichen Existenz fortzuschreiben, wohl eine Frage der jeweiligen psychischen, sozialen, emotionalen, intellektuellen etc. Konstitution, ob man dieser Ansicht zustimmt oder ihr widerspricht – und vor allem, wie und ob man mit ihr leben kann.
Günter Kunert jedenfalls kann damit so hoffnungslos wie der Camussche Sisyphos (den man sich ja als glücklichen Menschen vorstellen soll) und so illusionslos und von der Welt gebeutelt wie der Candide Voltaires leben, von dem bekanntlich zuletzt überliefert ist: »Il faut cultiver le jardin«, was der Schriftsteller zusammen mit seiner Ehefrau Marianne, der dieses wie fast alle seiner vorhergehenden Bücher gewidmet ist, auf seinem kleinen Anwesen in Kaisborstel, im Kreis zahlreicher Katzen, tut; und auch bei seinen morgendlichen intellektuellen Streifzügen, emotionalen Jätungen und Gedankensetzungen handelt es sich darum, in selbstgewählter und -genossener Einsamkeit sein eigenstes Gärtlein zu bestellen.
Zweifellos hat sich der Diarist von Kaisborstel den gascognerischen Edelmann in seinem Turm, Michel de Montaigne, zum Vorbild genommen: »Ich möchte, wenn auch in einem kleineren Zirkel und kontaktärmer, wie Montaigne die Zeit begleiten«, schreibt Kunert: »Äußerliches Nichtgeschehen gleitet an einem gleichmäßig vorüber wie ein unauffälliger Fluß (…) Nun sitze ich als Angler an dem hierzulande sacht dahinziehenden Strom und ziehe hin und wieder etwas für meine Überlegungen an Land. Salut, Michel!«
Aber Welten trennen Kunert von dem aufklärerischen humanistischen Skeptiker, der gerade kein Apokalyptiker war, wie sein deutscher Copain. Näher ist dem Berliner auf dem Lande in der Geisteshaltung denn doch eher der italienische Lyriker Giacomo Leopardi, dessen abgründiger Pessimismus erst in seinen postum publizierten Notizen des »Zibaldone« leuchtend hervortrat. Vermutlich kennt ihn aber Kunert gar nicht, jedenfalls erwähnt er ihn nicht – im Gegensatz zu Lichtenberg, dessen (ebenfalls erst postum publizierte) »Sudelbücher« ihm einen Nachruhm verschafften, der alles übertraf, was er zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hatte.
Es sieht ganz so aus, als wolle Kunert nun mit dem mixtum compositum »Die Botschaft des Hotelzimmers an den Gast« Ähnliches versuchen. Darauf deutet zum einen die selbstkritische Bemerkung hin, wonach »gerade meine besondere Befähigung, in vielerlei literarischen Gattungen mich bewegen zu können, die Vollkommenheit meiner Arbeiten verhindert hat. Meine Manie war nicht eng genug fokussiert, die Obsession diffus« – und dieser diffusen Obsession, sich Gedanken über alles Mögliche zu machen, kann er nun in seinen Sudelbüchern durchaus lustvoll und ohne Zwang zur Form nachgeben. Zum anderen zitiert er eine Passage aus Hans Erich Nossacks kürzlich erst publizierten Tagebüchern, die ihm »aus der Seele« gesprochen sei: »Es muß immer einer da sein, der außerhalb des Zeitgeschehens den Gedanken weiterdenkt. Nur darauf kommt es an: es ist viel wichtiger als große Werke. Vielleicht liest einer in zwanzig oder fünfzig Jahren dies, und es gibt ihm Mut zum Durchhalten«.
Kleine gegen Große Werke
Kunert erklärt die Egomanie zur unabdingbaren Voraussetzung für die introvertierte, introspektive Arbeit des Schriftstellers, »schriftliche Äußerungen« seien »seine wahren Lebensäußerungen«, wohingegen die »großen Werke« kaum »die entsprechende Verbreitung und das dazugehörige Interesse« fänden, trügen sie »nicht das Stigma des Trivialen an sich«.
Das erinnert nun allerdings fatal an die Lafontaineesche Fabel vom Fuchs, dem die Trauben sauer erscheinen, weil sie ihm zu hoch hängen. »Groß« sind eben manche »Werke«, weil sie ungemein verdichtet, komplex und selbstregenerierbar sind. Keinesfalls ist die kleine, fragmentarisch-aphoristische Form oder die essayistische Betrachtung, wie sie Kunert in seinen Selbstgesprächen und Aufzeichnungen pflegt, gefeit gegen das Triviale; es besteht – und das markiert die historische Entfernung, die uns von Montaigne, Lichtenberg oder Leopardi unrevidierbar trennt – gerade auf diesem Feld des unsystematisch-spontaneistischen »Selberdenkens« eine viel größere Gefahr, im Trüben des längst schon Gesagt-Gedacht- und Formulierten zu fischen und die eigene Findigkeit zu überschätzen.
Natur- und Geisteswissenschaft und Philosophie haben seit dem 19. Jahrhundert unsere äußere und innere Welt derart durchdekliniert und -definiert, dass für ein »eigensinniges« diskursiv-argumentatives Denken und Formulieren kaum noch ein Platz bleibt, auf dem sich nicht schon das Allgemeine breit gemacht hat. Heute noch »originell« zu sein im Essayistischen oder gar Aphoristischen, setzt exzentrische Betrachtungsweisen (wie die Canettis) oder einen dafür eigens entwickelten literarischen, poetischen Stil voraus (wie bei Peter Handke, Botho Strauß oder Peter Sloterdijk), was man von der allgemein kulturpessimistischen, technik- und massenmedienkritischen Reflexion Kunerts nicht sagen kann.
Glücklicherweise fehlt seinem »Sinnieren« über sich und die Welt aber das tiefgründelnde, hochgestochen pathetische Raunen. Der kassandrische Nachrufer der Aufklärung ist selbst noch einer. Kein Rückfall oder Rückruf des Mythischen ist von ihm zu erwarten. Stoizismus, Staunen, Ironie oder Humor, der auch eine kleine Sammlung von Kalauern (»unwiderlegliche Wahrheiten in lumpigem Gewande«) nicht verschmäht, halten sich in diesen Aufzeichnungen u.a. »vom Reisen« und »vom Altern«, »von Sex und Eros« und »von der Sprache« die Waage, die sich hin & wieder auch zum »Reaktionären« senkt, wie es bei solcher Weltsicht nicht vermeidbar scheint zur gefälligen Selbstaufwertung des Solitären.
Rosinen picken
Je nach eigenen Interessen wird man sich aus diesen Denkstücken und spekulativen Räsonnements das einen Erhellende oder zum Widerspruch Reizende als Rosinen herauspicken. Besonders fündig bin ich da bei Kunerts Autobiographika geworden, sei´s in seinen Träumen, sei´s beim Blick auf ihm nahe und ferne Kollegen, sei´s bei seinen Überlegungen zu Katzen und anderen Tieren. Bei ihm, dem Katzenliebhaber, findet sich die Ansicht, wonach »die immens gewachsene Tierliebe in der Zivilisation« sich »leichterdings auf den zunehmenden Widerwillen der Menschen füreinander zurückführen« lasse. »Beim Beobachten junger Tiere, verspielter Katzen, erkennst du, daß das wahre Glück keinen Namen hat«. Nicht verwunderlich, dass Kunert eine seiner schönsten Paradoxien dabei einfällt: »Wenn ich tot bin, möchte ich nur von Katzen träumen«. Vorerst träumen seine aber wohl von ihm.
Titelangaben
Günter Kunert: Die Botschaft des Hotelzimmers an den Gast
Aufzeichnungen
Herausgegeben von Hubert Witt
München Wien: Carl Hanser Verlag 2004
347 Seiten. 21,50 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe