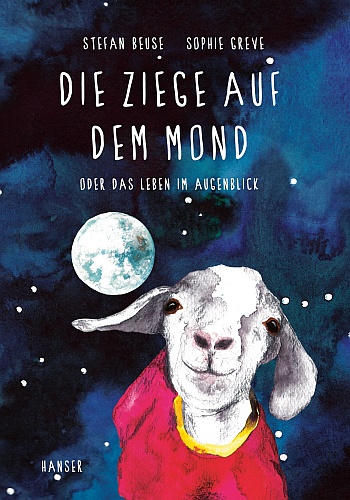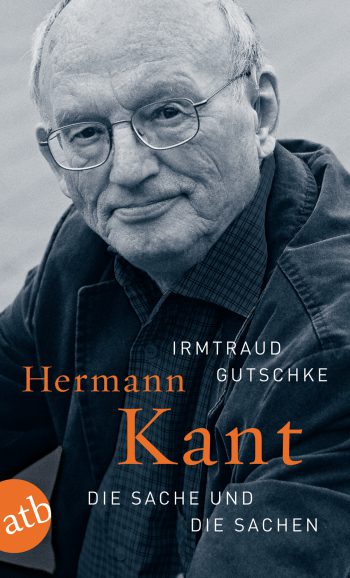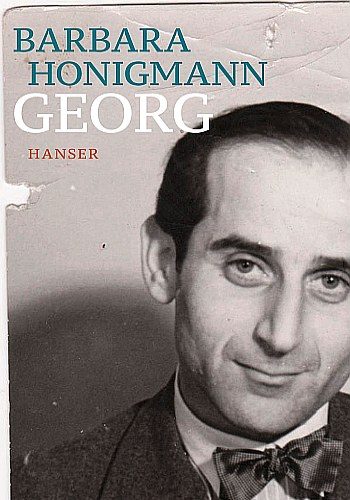Menschen | Zum 100. Geburtstag von Doris Lessing
»Als ich jung war, hießen die weltbeherrschenden Themen Nazideutschland, Mussolini, das britische Empire, die Sowjetunion. Mir war zwar immer klar, dass die Welt sich schnell verändert, aber dass am Ende meines Lebens nichts von alldem mehr existieren würde, hätte ich nie gedacht«, hatte Nobelpreisträgerin Doris Lessing in den späten 1980er Jahren erklärt. Und ihr Leben selbst hätte tatsächlich genügend Stoff für ein opulentes Erzählepos hergegeben. Von PETER MOHR
 Doris Lessing, die am 22. Oktober 1919 als Tochter eines britischen Offiziers in Kermansah (im heutigen Iran) unter dem Namen Doris May Tayler geboren wurde, wuchs auf einer Maisfarm in Rhodesien auf und schmiss mit 14 Jahren die Schule. Der erste rebellische Akt einer großen nonkonformistischen Frau, die 1949 mit ihrem kleinen Sohn Peter nach Großbritannien übersiedelte und nach umfangreichen autodidaktischen Studien der europäischen und amerikanischen Literatur (geschult an den großen Meistern des 19. Jahrhunderts Tolstoj, Dostojewski, Stendhal und Balzac) ein ganzes Bündel unveröffentlichter Manuskripte und Aufzeichnungen im Gepäck mit sich trug. Zunächst arbeitete sie in England als Telefonistin, Kindermädchen und Schreibkraft, ehe sie 1950 mit der ›Afrikanischen Tragödie‹ (später erfolgreich verfilmt) für Aufsehen sorgte. »Die Wut meines Vaters auf die Schützengräben hat sich schon in jungen Jahren auf mich übertragen und sich seither nicht verflüchtigt. Ein Vermächtnis, auf das ich gern verzichtet hätte«, hatte Lessing später erklärt.
Doris Lessing, die am 22. Oktober 1919 als Tochter eines britischen Offiziers in Kermansah (im heutigen Iran) unter dem Namen Doris May Tayler geboren wurde, wuchs auf einer Maisfarm in Rhodesien auf und schmiss mit 14 Jahren die Schule. Der erste rebellische Akt einer großen nonkonformistischen Frau, die 1949 mit ihrem kleinen Sohn Peter nach Großbritannien übersiedelte und nach umfangreichen autodidaktischen Studien der europäischen und amerikanischen Literatur (geschult an den großen Meistern des 19. Jahrhunderts Tolstoj, Dostojewski, Stendhal und Balzac) ein ganzes Bündel unveröffentlichter Manuskripte und Aufzeichnungen im Gepäck mit sich trug. Zunächst arbeitete sie in England als Telefonistin, Kindermädchen und Schreibkraft, ehe sie 1950 mit der ›Afrikanischen Tragödie‹ (später erfolgreich verfilmt) für Aufsehen sorgte. »Die Wut meines Vaters auf die Schützengräben hat sich schon in jungen Jahren auf mich übertragen und sich seither nicht verflüchtigt. Ein Vermächtnis, auf das ich gern verzichtet hätte«, hatte Lessing später erklärt.
Nach ihrer Ehe mit dem Kolonialoffizier Frank Charles Wisdom war die Schriftstellerin in zweiter Ehe mit einem deutschen Emigranten namens Gottfried Anton Nicolai Lessing verheiratet. Durch diese, 1949 wieder geschiedene Ehe wurde sie Schwägerin von Klaus Gysi und Tante des deutschen Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi (Linkspartei).
In der »afrikanischen Tragödie« thematisierte Lessing (angelehnt an der eigenen bewegten Vita) das wenig freudvolle Leben in den britischen Kolonien Afrikas. Lessing beschreibt darin gleich eine doppelte Tragödie – das trostlose Dasein der britischen Siedler in einem fremden Land und die bittere Armut der Einheimischen. Anhand einer verbotenen Beziehung eines schwarz-weißen Paares wird das beidseitige Dilemma schonungslos offenbart.
Die erzählerische Doppelperspektive blieb auch später durchaus charakteristisch für Doris Lessings Schreibstil – so auch in ihrem formal anspruchsvollsten und überaus erfolgreichen Hauptwerk ›Das goldene Notizbuch‹ (1962), das aber eben nicht auf eine »Bibel des Feminismus« reduzierbar war, sondern auch eine Abrechnung mit dem blutigen Kolonialismus und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kommunismus lieferte.
Im Mittelpunkt dieses assoziativ erzählten Romans, der auf fünf Ebenen angesiedelt ist, stehen zwei politisch engagierte, intellektuelle und emanzipierte Frauen, die der kommunistischen Partei angehören und sich zwischen revolutionärem Fortschrittsdenken und stalinistischen Verbrechen innerlich aufreiben. Und man darf heute die Romanfigur der Kommunistin Anna Wulf durchaus auch als leicht verfremdetes Selbstbild deuten.
Doris Lessing, die leidenschaftliche humanistische Aufklärerin, warnt in diesem Roman zwischen den Zeilen vor den Gefahren jugendlicher Verblendung und vor ideologischer Vereinnahmung – ganz im Sinne des großen Aufklärers Gotthold Ephraim Lessing, dessen Name sie nicht ohne Stolz trägt. »Sozusagen als Omen für meine eigene schriftstellerische Karriere. Denn es bedeutet Anregung und Maßstäbe zugleich für mich, den Namen eines Genies zu tragen.«
Doris Lessing, die immer wieder mit Virgina Woolf verglichen und als große alte Dame der englischen Literatur bezeichnet wurde, galt in den 1960er Jahren als Ikone der Frauenbewegung. Doch gegen diese Vereinnahmung wehrte sie sich in einem Interview mit der ›New York Times‹ ganz vehement: »Die Feministinnen verlangen von mir einen religiösen Akt, den sie nicht genauer untersucht haben. Sie wollen, dass ich Zeugnis ablege. Am liebsten möchten sie, dass ich sage: ›Ich stehe auf eurer Seite, Schwestern, in eurem Kampf für den goldenen Tag, an dem all die brutalen Männer verschwunden sind.‹«
»Sie ist die Epikerin weiblicher Erfahrung, die sich mit Skepsis, Leidenschaft und visionärer Kraft eine zersplitterte Zivilisation zur Prüfung vorgenommen hat«, hieß es 2007 in der Begründung des Stockholmer Nobelpreiskomitees, als Doris Lessing – eigentlich mit etlichen Jahren Verspätung, sie war bereits 87 Jahre alt – die wichtigste Auszeichnung der literarischen Welt verliehen wurde.
Nach der Nobelpreisverleihung hatte sich Doris Lessings Leben schlagartig geändert. »Ich habe keine Energie mehr«, hatte die Schriftstellerin schon nach Fertigstellung ihres letzten Romans ›Alfred und Emily‹ (2008) geklagt. Seit der Ehrung durch die Stockholmer Akademie hatte sie kaum noch freie Zeit, sollte fast täglich Interviews geben und für die Fotografen posieren. »Den Nobelpreis kann man niemandem verleihen, der tot ist, also haben sie sich wahrscheinlich gedacht, die geben ihn mir, bevor ich abkratze«, hatte Lessing bissig ihre Ehrung durch die Stockholmer Akademie kommentiert. Die pompös inszenierten Auftritte und das ständige Blitzlichtgewitter vor ihrem Haus in London waren der ältesten Literatur-Nobelpreisträgerin aller Zeiten ein Gräuel.
»Ich habe versucht, meinen Eltern das Leben zu geben, das sie vielleicht geführt hätten, wenn es nie zum Ersten Weltkrieg gekommen wäre«, schrieb Doris Lessing im Vorwort ihres letzten vollendeten Romans ›Alfred und Emily‹ (2008). Während sie hier gegenüber der Figur ihres Vaters deutlich moderatere Töne anschlägt als in früheren Büchern, bleibt das Verhältnis zu ihrer Mutter mehr als frostig. Der literarische »Trick« des Romans ist relativ simpel: Die Autorin lässt Vater und Mutter mit anderen Partnern ein glücklicheres Leben führen. Aus Alfred wird ein englischer Farmer, aus Emily nach kurzer Ehe mit einem Kardiologen eine wohltätige Stiftungsgründerin – eine Dame mit großer gesellschaftlicher Reputation.
Der Versuch, sich eine fiktive Kindheit zu konstruieren, basiert offenkundig auf einem starken Harmoniebedürfnis der stets um Gerechtigkeit bemühten Schriftstellerin. Vater und Mutter, die in der Realität (als Schwerverwundeter und als Krankenschwester) beide vom Ersten Weltkrieg traumatisiert waren, erhalten durch die neu erfundenen Lebensläufe auch deutlich positivere Charakterzüge verliehen. Ihr letzter Roman ›Alfred und Emily‹ ist ein auf rührende Weise versöhnliches Alterswerk – sanft, mild und ohne den gefürchteten Lessing-Biss.
»Ich habe mir schon immer gern fantastische Welten ausgedacht. Das bedeutet eine größere Freiheit beim Schreiben. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich in einer wilderen Welt aufgewachsen bin: im südrhodesischen Busch. So bin ich nie ganz und gar zu einer Engländerin geworden, ein Teil blieb fremd und Außenseiterin. Für eine Schriftstellerin ist dieser Blick von außen sehr gut«, hatte Lessing einmal ihr schriftstellerisches Credo beschrieben.
Schon 1995 hatte sie sich in ihrer Autobiografie ›Unter der Haut‹ ihren Eltern und ihrer afrikanischen Kindheit gewidmet, und in ihrem frühen, nur noch wenig bekannten Roman ›Martha Quest‹ aus den 1950er Jahren stand schon einmal ein feindseliges Mutter-Tochter-Verhältnis im Mittelpunkt.
Zu großen Bestsellern wurden unter ihren rund 60 veröffentlichten Büchern ›Das fünfte Kind‹ (1988), ›Unter der Haut‹ (1994), der zweite Teil ihrer Autobiografie ›Schritte im Schatten‹ (1997) und ›Ein süßer Traum‹ (2003).
Richtig glücklich war Lessing mit dem Literaturzirkus allerdings nicht. Mitte der 1980er-Jahre hatte sie ihrem Verlag ein Manuskript unter dem Namen Jane Somers zugeschickt. Prompt schickte man ihr ›The Diary of a Good Neighbour‹ zurück. Für sie der Beweis, dass es im Literaturmarkt ohne bekannten Namen und renommierte Fürsprecher kaum Chancen gibt.
Ein letztes großes, fantasievolles literarisches Experiment hatte Lessing 2007 noch einmal mit dem Roman ›Die Kluft‹ vorgelegt. In ihrer märchenhaften, erzählerischen Evolutionsgeschichte existiert eine große weibliche Gemeinschaft. Als irgendwann der erste Mann auftaucht, endet dies in einer Katastrophe. »Es fasziniert mich, in Gedanken in die Zeit zurückzugehen, als die Welt noch ein Platz war, wo verschiedene evolutionäre Schritte gleichzeitig stattgefunden haben«, bekannte Lessing über die Entstehung dieses Romans.
In einem ihrer letzten Interviews mit dem ›Telegraph‹ hatte sich die in keine politische und künstlerische »Schublade« passende Doris Lessing gewünscht, über ihre Katze zu stolpern und dann zu sterben. »Es wird mir gefallen, tot zu sein. Es wird mich davon erlösen, mich wegen all dieser Kriege zu sorgen.«
Am 17. November 2013 ist Doris Lessing, die in den letzten Lebensjahren gemeinsam mit ihrem Sohn Peter in einem Haus im Londoner Stadtteil West Hampstead gelebt hatte, im Alter von 94 Jahren gestorben. Eine streitbare Schriftstellerin, eine aufrichtige Humanistin und unermüdliche Gerechtigkeitsfanatikerin, die wahrscheinlich im Geiste völlig eins war mit ihrem großen Namensvetter, der sich einst wünschte: »Alle Dichter wollen weniger gelobt und fleißiger gelesen werden.«
| PETER MOHR
| Titelfoto: No machine-readable author provided. Elya assumed (based on copyright claims)., Doris lessing 20060312, CC BY-SA 3.0