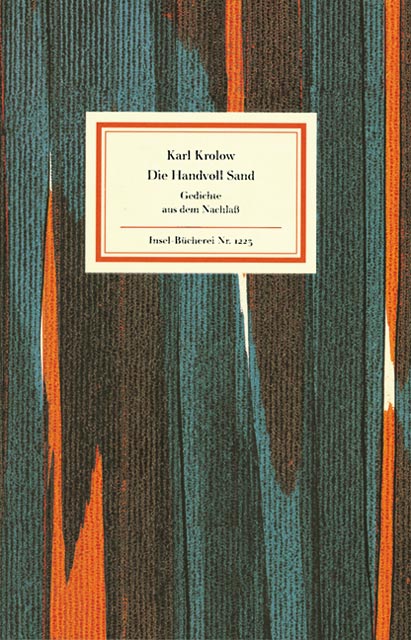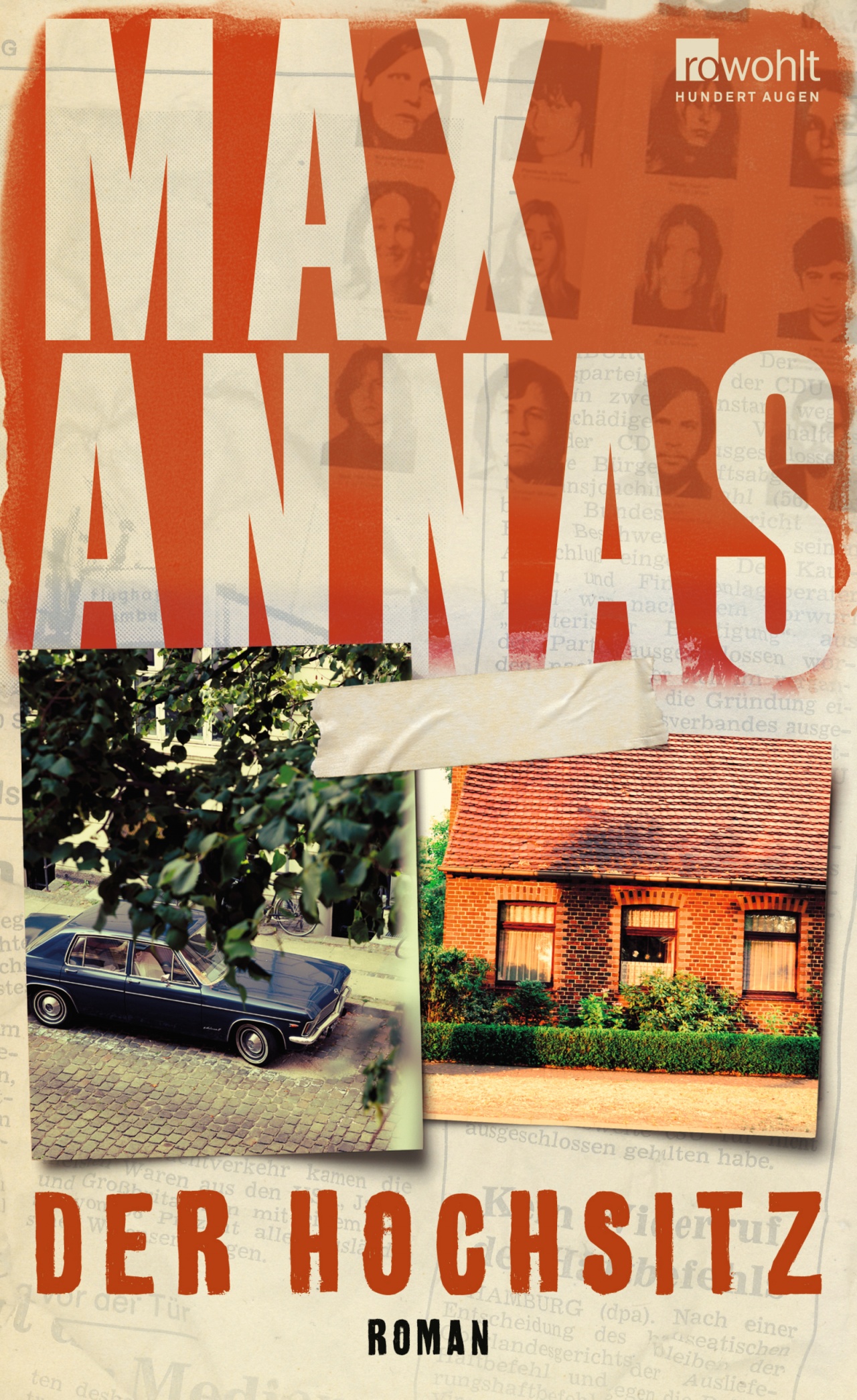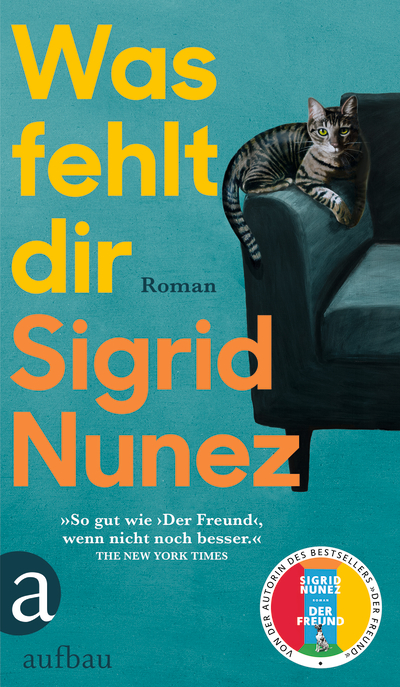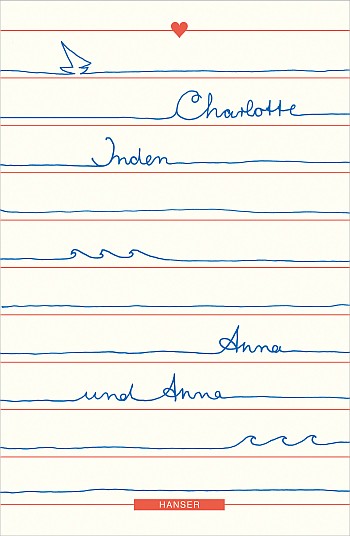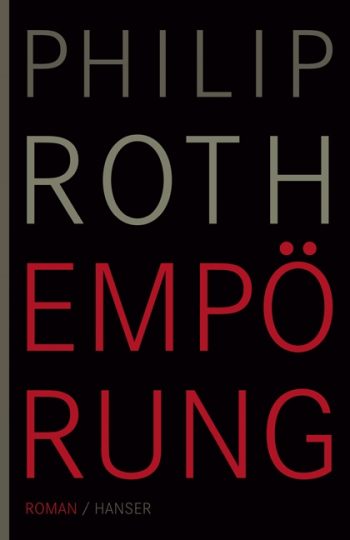Roman | Arnaldur Indriðason: Nacht über Reykjavík
Mit seinem neuen Roman ›Nacht über Reykjavík‹ setzt Islands Krimiautor Nummer 1 fort, was er mit dem Roman ›Duell‹ (2013) begonnen hat: einen Rückblick auf die ersten Dienstjahre des Helden jener 11-teiligen Serie, mit der er zwischen 1997 und 2010 seine Heimatstadt zu einem europäischen Krimischauplatz machte. War Erlendur Sveinsson in der Geschichte um das »Match des Jahrhunderts« zwischen den Schachgiganten Boris Spasski und Bobby Fischer 1972 in Reykjavík allerdings nur eine von vielen Nebenfiguren, löst er im vorliegenden Buch seinen ersten wirklichen Fall. Und darf sich am Ende sogar Hoffnung machen, in die Kriminalabteilung der Polizei übernommen zu werden. Von DIETMAR JACOBSEN
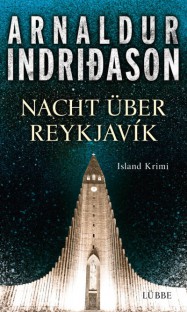 Ein Obdachloser ist ertrunken – in einem eher flachen, von Kindern gern als Abenteuerspielplatz benutzten Teich in Reykjavíks Südosten. Fast zeitgleich verschwindet eine junge Frau, nachdem sie mit Freundinnen einen ausgelassenen Abend verbracht hat, spurlos. Erlendur Sveinsson, seit kurzem als Streifenpolizist auf Reykjavíks Straßen unterwegs und Nacht für Nacht mit den dunklen Seiten der isländischen Hauptstadt konfrontiert, kommt mit beiden Fällen in Berührung. Den Obdachlosen hat er sogar gekannt. Und sein Schicksal geht ihm nahe.
Ein Obdachloser ist ertrunken – in einem eher flachen, von Kindern gern als Abenteuerspielplatz benutzten Teich in Reykjavíks Südosten. Fast zeitgleich verschwindet eine junge Frau, nachdem sie mit Freundinnen einen ausgelassenen Abend verbracht hat, spurlos. Erlendur Sveinsson, seit kurzem als Streifenpolizist auf Reykjavíks Straßen unterwegs und Nacht für Nacht mit den dunklen Seiten der isländischen Hauptstadt konfrontiert, kommt mit beiden Fällen in Berührung. Den Obdachlosen hat er sogar gekannt. Und sein Schicksal geht ihm nahe.
Die Leser von Arnaldur Indriðason kennen Erlendur bereits als vergrübelten, einzelgängerischen Kommissar aus der elfteiligen Romanreihe, die 1997 mit ›Menschensöhne‹ (deutsche Übersetzung 2005) begann und nach 13 Jahren mit ›Eiseskälte‹ (Lübbe 2012) ihren fulminanten Abschluss fand. Nun holt Islands bekanntester Kriminalautor offensichtlich nach, was in seinen bisherigen Büchern gelegentlich in kurzen Rückblenden aufblitzte: die Vorgeschichte des mit seinen Eltern nach dem Tod des Bruders aus den Ostfjorden in die Metropole gezogenen Kriminalisten. In ›Nacht über Reykjavík‹ ist der noch unverheiratet, seine Freundin Halldóra erwartet aber bereits ihr erstes Kind von ihm und macht sich Sorgen über eine Beziehung, die von Erlendur mehr passiv hingenommen als forciert wird.
Tod eines Obdachlosen
Dass das Interesse des sich in Reykjavíks kalten Nächten um die Zukurzgekommenen der Gesellschaft kümmernden Streifenpolizisten vor allen jenen gilt, die aus ihrem gewohnten Lebensumfeld plötzlich und auf kaum erklärliche Weise verschwanden, um nie mehr aufzutauchen, wird aus Erlendurs Vorgeschichte erklärbar. In einem Unwetter in der eisigen Bergwelt der Ostfjorde hat er als Kind einst seinen Bruder verloren. Dass er einen Gutteil der Schuld an diesem Unglück, von dem die Familie sich nie wieder erholen sollte, sich selbst gibt, wissen Indriðason-Leser bereits. Nun, während er sich immer mehr und ohne dazu von irgendwem autorisiert zu sein, in die Fälle des ertrunkenen Obdachlosen Hannibal und der verschwundenen Oddny hineinarbeitet, begegnet ihm ein ähnliches Geschwisterschicksal, wie er es einst am eigenen Leib erlebte.
Denn auch Hannibal hat eine tragische Familiengeschichte, für die er verantwortlich war, aus der Bahn geworfen. Bei einem Autounfall, den er verschuldete, musste er sich entscheiden, ob er entweder die geliebte Frau oder seine jüngere Schwester der Kälte des Meeres, in das sein Leichtsinn den Wagen gesteuert hatte, überlassen sollte. Indem er sich für die Schwester entschied und sich mit der Schuld am Tod der Geliebten belastete, legte er den Grundstein für sein weiteres Leben außerhalb der Gesellschaft.
Ein Faible für Verschwundene
Auf raffinierte Weise gelingt es Arnaldur Indriðason, Hannibals Fall mit jenem der verschwundenen Oddný zu verknüpfen. Beharrlich und ohne sich darum zu kümmern, ob ihm das erlaubt ist oder nicht, sucht Erlendur einen nach dem anderen alle in den Fall verwickelten Personen auf. Und bald hat er erste Ansätze nicht nur zu der Hypothese, dass der von der Polizei als Unglücksfall verbuchte Tod des Obdachlosen ein Mord war, sondern kann auch jenen Mann überführen, der als einziger weiß, dass Oddnýs Verschwinden nicht auf einen Suizid zurückzuführen ist.
Wie er das tut, das hat schon viel von dem späteren, in der Nachfolge seines Mentors Marian Briem die Reykjavíker Kriminalabteilung leitenden Kommissars Erlendur. Und Briem selbst, den Indriðason am Ende übernehmen lässt, spricht aus, was nicht nur ein Lob für den jungen Erlendur ist, sondern auch beschreibt, wie der später alle seine Fälle angehen wird: »Ich habe mir deine Niederschriften über die Fälle von Hannibal und Oddný angesehen, nicht zuletzt im Hinblick darauf , wie du sämtliche klassische Regeln der Polizeiarbeit ignoriert hast […] Mir gefällt das sehr und du brauchst dich bei mir deswegen ganz sicher nicht zu entschuldigen […] Setz dich mit mir in Verbindung, wenn du mit dieser Art von Schnüffelei weitermachen möchtest.«
Was in Duell sich noch so las, als lege Indriðason nur eine wohlverdiente Pause ein, um nach dem Ausflug in die Zeiten des Kalten Kriegs wieder zur Gegenwart zurückzukehren, erweckt mit ›Nacht über Reykjavík‹ nun ganz den Anschein, als stünden wir mit Erlendur am Beginn einer neuen Serie. Einer Buchreihe mit einem Protagonisten im Mittelpunkt, den sein Erfinder auch nach dessen Verschwinden am Ende des Romans ›Eiseskälte‹ nicht loslassen will. Und so erzählt er jetzt davon, wie Erlendur der wurde, als den ihn der Leser bereits kennt. Wenn dabei weiterhin solche spannenden, meisterhaft komponierten und auf leicht lesbare Weise in die Tiefen der menschlichen Psyche abtauchenden Romane entstehen wie dieser, soll uns das sehr willkommen sein.
Titelangaben
Arnaldur Indriðason: Nacht über Reykjavík
Aus dem Isländischen von Coletta Bürling
Köln: Lübbe 2014
192 Seiten, 22 Euro
Reinschauen
| Leseprobe
| Arnaldur Indriðason: Todeshauch im TITEL kulturmagazin
| Arnaldur Indriðason: Gletschergrab/ Menschensöhne im TITEL kulturmagazin