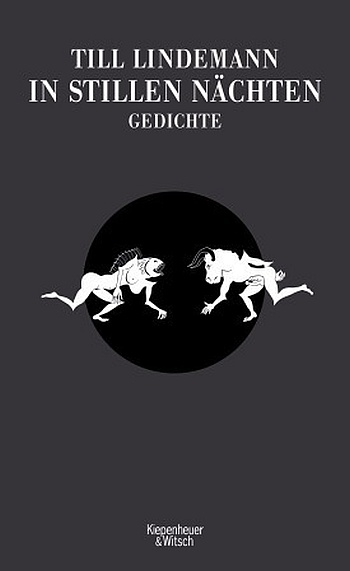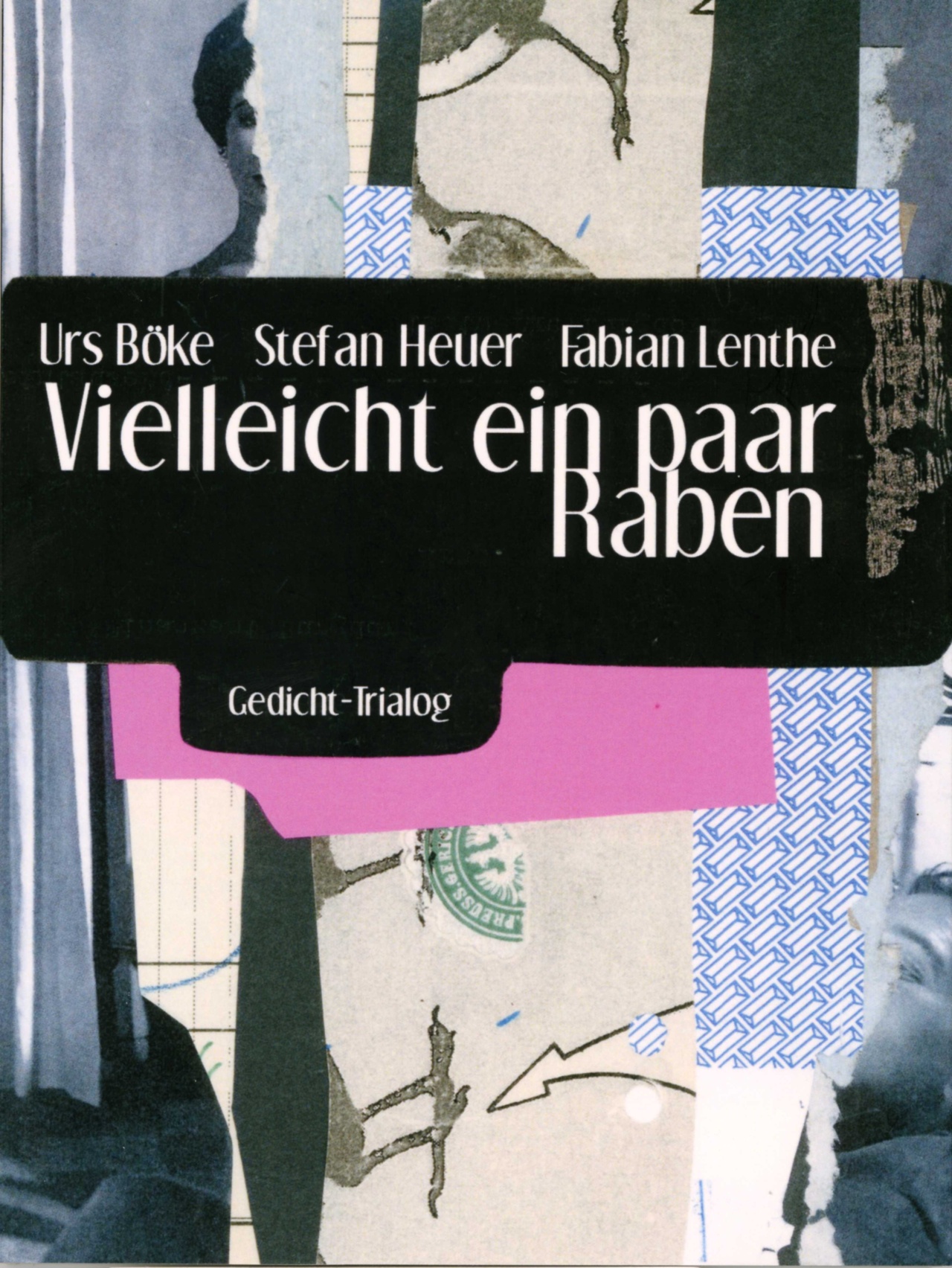Lyrik | Lyrik aus Nicaragua
Eine Reise durch das Land mit Ausflügen zu den Dichtern – eine Reportage von PETER STÄUBER
 Der Dichter Jorge Eduardo Argüello erzählt mit beißendem Spott, würzt seine Bemerkungen mit Zynismus und bekundet eine tiefe Abneigung gegen die Volksfeste Leóns. Entnervt seufzt er, als der Platz vor der Kathedrale zum zigsten Mal unter lautem Trommeldonner erdröhnt und er seine Ausführungen unterbrechen muss. Einen Jungen, der an den Tischen vorbeigeht und Süßigkeiten verkauft, verscheucht er mit einer ungeduldigen Handbewegung, wie eine Fliege. »Die sind eine regelrechte Plage.« Argüello mag die Leute nicht. Wer Dichter sein will, müsse ein Misanthrop sein, sagt er. Dann beginnt er zu erzählen, weshalb man ihn in seiner Heimatstadt zur persona non grata erklären wollte.
Der Dichter Jorge Eduardo Argüello erzählt mit beißendem Spott, würzt seine Bemerkungen mit Zynismus und bekundet eine tiefe Abneigung gegen die Volksfeste Leóns. Entnervt seufzt er, als der Platz vor der Kathedrale zum zigsten Mal unter lautem Trommeldonner erdröhnt und er seine Ausführungen unterbrechen muss. Einen Jungen, der an den Tischen vorbeigeht und Süßigkeiten verkauft, verscheucht er mit einer ungeduldigen Handbewegung, wie eine Fliege. »Die sind eine regelrechte Plage.« Argüello mag die Leute nicht. Wer Dichter sein will, müsse ein Misanthrop sein, sagt er. Dann beginnt er zu erzählen, weshalb man ihn in seiner Heimatstadt zur persona non grata erklären wollte.
Argüello sitzt im Restaurant El Sesteo, mit Blick auf die Plaza Central, das Zentrum Leóns. Nach Sonnenuntergang, wenn die Hitze etwas nachlässt, zieht es die Menschen hierher. Auf den Stufen der imposanten Kathedrale sitzen Teenager in Schuluniform, Großeltern schieben ihre Enkel in Kinderwägen vor sich her, zwischen den Parkbänken hindurch, auf denen Verliebte schäkern. Eine Gruppe junger Touristen schlurft in Flip-Flops und ärmellosen T-Shirts über den Platz.
Die Dezemberabende in León sind festlich: Jungs ziehen mit riesigen Frauenpuppen, sogenannten gigantonas, durch die Gassen, begleitet von Trommlern und einer kleineren Männerpuppe mit einem überdimensionierten Kopf. Die vorweihnachtliche Tradition symbolisiert die Vermischung von spanischen und indigenen Kulturen.
Aber wie gesagt, Argüello kann bei so viel Folklore nur die Nase rümpfen. Und nicht nur bei Folklore. Man muss nur ein beliebiges Thema anschneiden, und das Gesicht des Dichters verzieht sich zu einer herablassenden Grimasse: Die Regierung Daniel Ortegas, die Linken, die Konservativen, die Touristen in ihrer leichten Bekleidung, die meisten zeitgenössischen Dichter – alle bedeppert, überbewertet, zu nichts tauglich.
 Eigentlich wollte ich meine Suche nach der Poesie Leóns nicht bei Argüello beginnen – ich kannte ihn nicht –, sondern beim Dichter Nuñez, den viele hier schlicht el poeta nennen. Einst war Nuñez einer der besten Lyriker Mittelamerikas, hat man mir gesagt, doch heute ziehe er als betrunkener Vagabund durch die Straßen Leóns, auf Almosen und ein kostenloses Abendessen im Sesteo angewiesen. Jeden Tag, wenn ich im Lokal auftauche und mich beim Kellner nach Nuñez erkundige, antwortet dieser, er sei nicht gekommen, oder schon wieder weg, oder man habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. So auch heute. Doch das stellt kein größeres Problem dar, schließlich sind wir in der Stadt der Poeten. Der Kellner zeigt auf einen untersetzten Mann mit einem weißen, kurz geschnittenen Ziegenbart, der in ein Manuskript vertieft ist. »Sprechen Sie mit dem Dichter Argüello.« Und so sitze ich hier, trinke ein Bier und unterhalte mich mit dem mürrischen Literaten.
Eigentlich wollte ich meine Suche nach der Poesie Leóns nicht bei Argüello beginnen – ich kannte ihn nicht –, sondern beim Dichter Nuñez, den viele hier schlicht el poeta nennen. Einst war Nuñez einer der besten Lyriker Mittelamerikas, hat man mir gesagt, doch heute ziehe er als betrunkener Vagabund durch die Straßen Leóns, auf Almosen und ein kostenloses Abendessen im Sesteo angewiesen. Jeden Tag, wenn ich im Lokal auftauche und mich beim Kellner nach Nuñez erkundige, antwortet dieser, er sei nicht gekommen, oder schon wieder weg, oder man habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. So auch heute. Doch das stellt kein größeres Problem dar, schließlich sind wir in der Stadt der Poeten. Der Kellner zeigt auf einen untersetzten Mann mit einem weißen, kurz geschnittenen Ziegenbart, der in ein Manuskript vertieft ist. »Sprechen Sie mit dem Dichter Argüello.« Und so sitze ich hier, trinke ein Bier und unterhalte mich mit dem mürrischen Literaten.
In Nicaragua, so sagt man, sei jeder ein Dichter. Wer sich mit der Geschichte des Landes befasst, trifft allenthalben auf Lyriker in allen Variationen – Revolutionäre, Konservative, Diplomaten und Geistliche. Da ist Alfonso Cortés, der in der Nacht auf den 18. Februar 1927 plötzlich den Verstand verlor. Oder Gioconda Belli, gefeierte Poetin aus der Bourgeoisie, die im Untergrund als sandinistische Rebellin den Sturz des Diktators Anastasio Somoza vorbereitete. Oder Ernesto Cardenal, linker Befreiungstheologe und in den 1980er-Jahren Priester in der Sandinista-Regierung, von dem sich Papst Johannes Paul II. die Hand nicht küssen lassen wollte (»Sie müssen ihre Situation mit der Kirche in Ordnung bringen.«). Und dann ist da noch Rosario Murillo, preisgekrönte Dichterin, Gattin des Präsidenten Daniel Ortega – und laut vielen Nicaraguanern die mächtigste Person im Land.
Der allergrößte Wortschmied in dieser Nation der Lyriker war Rubén Darío, geboren 1867, Mitbegründer des Modernismus in Lateinamerika und nach gängiger Ansicht einer der besten Dichter überhaupt. Mit 13 Jahren veröffentlichte er sein erstes Gedicht, und mit 21 gab er seinen ersten Lyrikband heraus. Er bereiste ganz Lateinamerika, traf Literaten in Paris und New York, war Diplomat in Buenos Aires, Zeitungskorrespondent in Barcelona, Botschafter in Madrid, trank zu viel Alkohol und starb 1916 in León, in einem Haus wenige Straßen vom Sesteo entfernt.
Im gleichen Haus wohnte nach Daríos Tod auch Alfonso Cortés, der den Ruf als zweites lyrisches Genie des Landes genießt. Nachdem er 1927 in der geistigen Umnachtung versunken war, verbrachte er lange Zeit angekettet in seinem Zimmer und schrieb nur in sporadischen Momenten der Klarheit – allerdings zählen diese Gedichte zu seinen besten.
Und ausgerechnet diesen Cortés hat Argüello jetzt verunglimpft, angeblich. Sein jüngstes Theaterstück heißt El Mono y su Ventana, der Affe und sein Fenster. Es tritt darin auf: Alfonso Cortés als Wahnsinniger, wie er nackt herumrennt, masturbiert und mit seiner Schwester eine inzestuöse Liebesbeziehung führt. Argüello sagt, er sei bei seinen Recherchen auf unzweideutige Texte gestoßen, die eine solche Beziehung nahelegen. Die Kulturbeauftragte der Stadt hingegen sah darin ein Sakrileg und wollte Argüello zu einer »unerwünschten Person« erklären. 100 Literaten habe sie aufgefordert, einen Protestbrief zu unterschreiben, sagt Argüello, aber das Vorhaben scheiterte. Auf die Premiere im März freut er sich natürlich – allein der Gedanke, für Empörung zu sorgen, scheint ihm Vergnügen zu bereiten. »Alles kann passieren«, meint er fröhlich.
Wir bestellen noch ein Bier. Irgendwann wendet sich das Gespräch dem Essen zu, und plötzlich, zum ersten Mal an diesem Abend, erhellt sich Argüellos Gesicht. Er fragt, ob ich die beste Bohnensuppe der Stadt probieren möchte. Bohnen sind eine unabdingbare Zutat in der nicaraguanischen Küche – gallo pinto zum Beispiel, gebratener Reis mit roten Bohnen, wird morgens, mittags und abends als Beilage gegessen. Der Preis der Hülsenfrucht ist in den letzten Wochen stark gestiegen, sodass die traditionelle Suppe aus Gründen der Kostenersparnis zurzeit oft etwas dünn ausfällt. Aber Argüello versichert mir, dass die Brühe in der Kneipe La Curaracha dick ist und mich umhauen wird. Wir verabreden uns für die nächste Woche.
Doch zurück zur Poesie. Auch am nächsten Morgen ist der poeta nicht aufzufinden. Der Kellner zeigt mir auf seinem Handy ein Bild von Nuñez, damit ich ihn erkennen würde, sollte ich ihm über den Weg laufen. Dann mache ich mich auf ins Casa de Cultura. Wie die meisten alten Kolonialhäuser Nicaraguas hat das Kulturzentrum einen quadratischen Innenhof mit einem kleinen Garten in der Mitte. Ein leichter Wind zieht hier ab und zu, aber bereits um 11 Uhr morgens ist es erdrückend heiß. Die Tür zum Tanzsaal steht halb offen, man hört klassische Musik und die Instruktionen des Tanzlehrers: Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres… Auf einem großen Gemälde neben dem Tanzstudio ist eine indigene Frau zu sehen, aus deren aufgeschnittenen Pulsadern Blut tropft. Auf ihren Schultern hockt Ronald Reagan, Schrotflinte in der Hand, und grinst.
In einem kleinen Raum im ersten Stock sitzt Alberto Juárez Vivas – Dichter, selbstverständlich – und ermahnt die Schülerinnen und Schüler mit erhobenem Zeigefinger: »Die Dichtung ist Arbeit.« Ernst schaut er in die Runde und schweigt ein paar Momente lang. Laute Motorengeräusche sind von der Straße zu hören. Dann wiederholt er: »Arbeit.« Zwei Mädchen und drei Jungs, alle etwa 15 Jahre alt, hören aufmerksam zu. Sie glauben es ihm. Juárez trägt eine Baseball-Mütze mit dem Signet der Uni von León, an der er Literatur unterrichtet. Samstags bietet er einen Poesie-Workshop für Schüler an, heutiges Thema sind Sprachfiguren, aber immer wieder schweift er ab in allgemeine Grundsätze für die Nachwuchs-Literaten. »Die Aufgabe des Schreibers ist das Schreiben. Und das Lesen. Er muss sich über die tagesaktuellen Ereignisse informieren, um den Kontakt zur Realität zu wahren.«
Die heutige Poesie Nicaraguas befasse sich mit dem Sozialen, sie sei ein Spiegel der Gesellschaft, sagt Juárez. Mit schön komponierten, romantischen Versen habe sie nichts zu tun, und die revolutionäre Lyrik, wie sie in den 1970er- und 80er-Jahren praktiziert worden sei, habe ebenfalls keine Relevanz mehr. Gestern habe er einer Lesung eines 18-Jährigen Dichters aus Masaya beigewohnt, der über die Homosexualität schrieb – »phänomenal« sei es gewesen. Der 18-Jährige zeige damit Mut, cojones würde man hier sagen, denn in Nicaragua ist der Machismo weit verbreitet, Homosexualität gilt in vielen Kreisen als Tabu. Wie gesagt, Lyrik von solcher Kraft setze Arbeit voraus. Dass das dichterische Talent seinen Landsleuten sozusagen im Blut mitgeliefert wird, sei ein Mythos: »Es ist der lange Schatten, den Darío wirft und Nicaragua als Dichternation bekannt gemacht hat.«
Eines Nachmittags kurz vor Weihnachten, als ich in einem Restaurant in der Nähe meines Apartments sitze und eine Limonade trinke, sehe ich aus dem Augenwinkel eine gebückte Gestalt am Fenster vorbeigehen. Das muss er sein. Nachdem ich mich beim Bartender vergewissert habe, folge ich dem Mann und klopfe ihm auf die Schulter. »Poeta Nuñez?« »Ja, ich bin Fernando José Nuñez, den man el poeta nennt.« Seine hellen Augen schauen aus einem faltigen Gesicht hervor, der Schnauz wächst etwas wild, auf seinem weißen Haupt trägt er einen Hut. Der klein gewachsene Mann kleidet sich elegant, so, als könne ihm die Hitze nichts anhaben: weißes Hemd, darüber ein Gilet und ein grüner Anzug, dazu eine violette Krawatte. Ob ein Gespräch möglich sei? Aber natürlich. Morgen im Sesteo.
Ob er tatsächlich einer der besten Dichter Zentralamerikas war, weiß ich nicht. Er erzählt mir von seinem Leben in León, wie er 45 Jahre lang als Direktor einer Universitätsbibliothek der städtischen Kultur diente. Vor zehn Jahren schloss die Institution, seither lebt Nuñez auf den Gassen, schläft auf den Bürgersteigen der Stadt, in der er vor 75 Jahren geboren wurde. Er erzählt Episoden aus der Geschichte seiner Heimat, von der liberalen Tradition, die den Grundsätzen der Französischen Revolution folgt, und vom Nationalhelden Augusto César Sandino, der mit seiner »kleinen verrückten Armee« gegen die Amerikaner kämpfte.
Aber seine lyrischen Kompositionen will er nicht vortragen. Auf meine Bitte entgegnet er mit einem Satz, den man in Nicaragua oft hört: »Machen wir das doch morgen.« Ich gebe ihm meine Adresse, er verspricht, am nächsten Tag vorbeizuschauen. Doch der Besuch findet nie statt, die Lesung bleibt aus.
Zum letzten Mal sah ich ihn einige Stunden nach unserem Gespräch, als ich abends an der Kathedrale vorbeispazierte. »Ah, so sehen wir uns wieder«, sagte der Dichter Nuñez gut gelaunt, bevor er in die kolossale, bezaubernde Kirche trat, in der Rubén Darío seit bald hundert Jahren ruht.
| PETER STÄUBER
Titelangaben
Ernesto Cardenal: Etwas, das im Himmel wohnt
Aus dem Spanischen von Lutz Kliche
Wuppertal: Peter Hammer 2015
140 Seiten, 14,90 Euro
Gioconda Belli: Die Frau, die ich bin
Wuppertal: Peter Hammer 2014
160 Seiten, 19,90 Euro