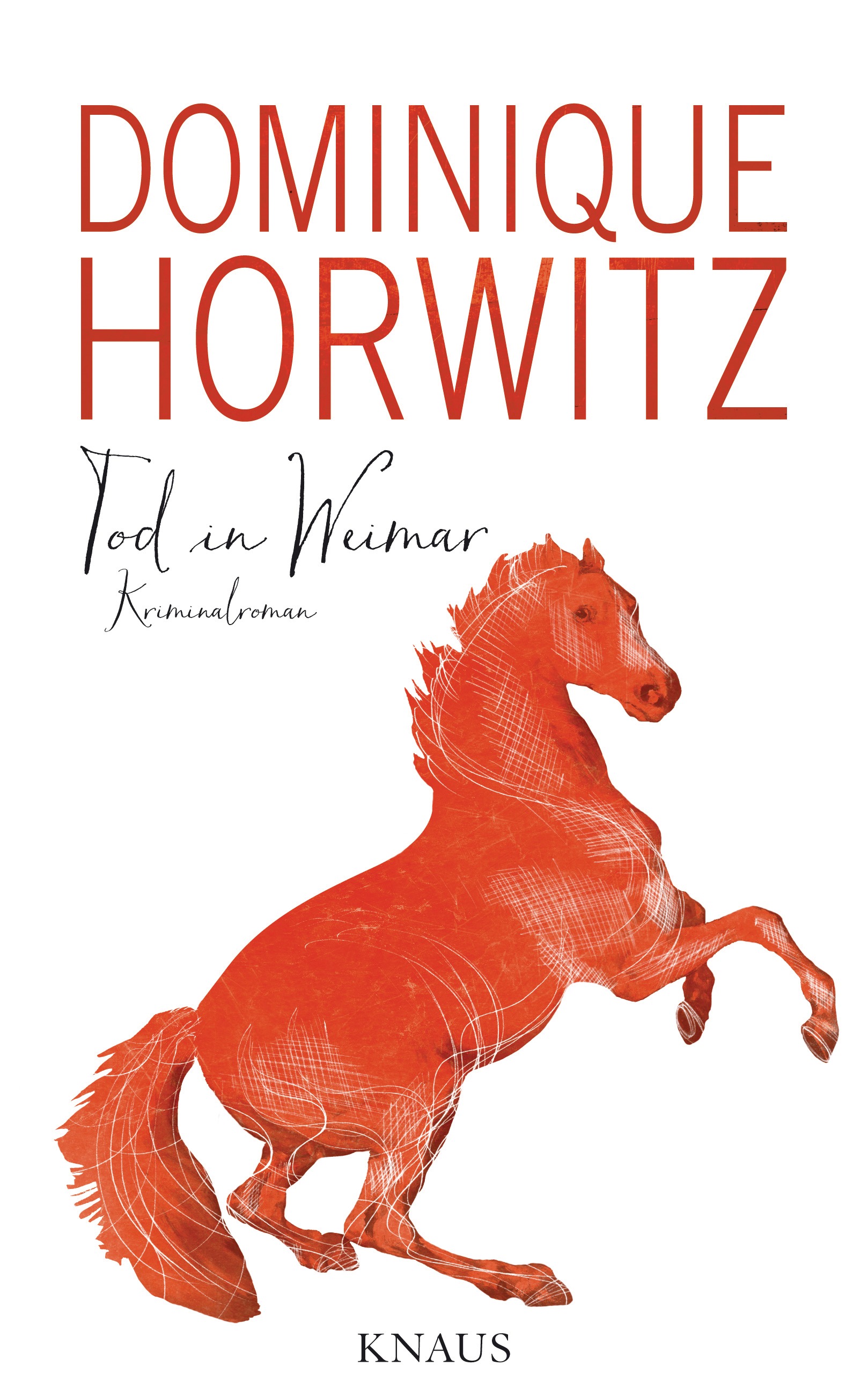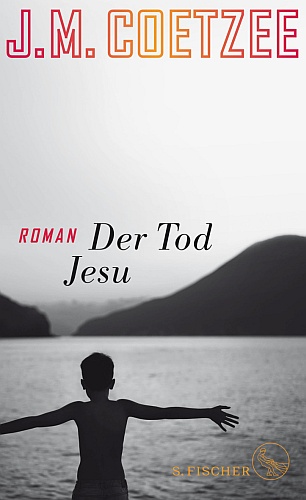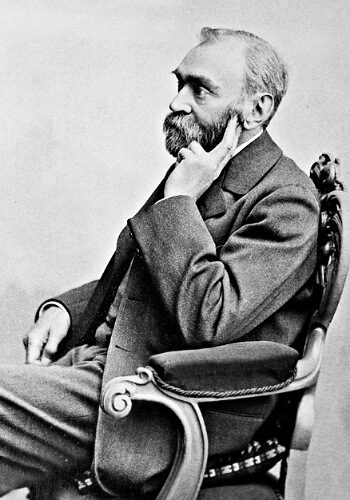Roman | Zum Geburtstag der Georg-Büchner-Preisträgerin Brigitte Kronauer am 29. Dezember
»Mir scheint ein großes Problem unserer Gegenwart zu sein, dass man mit so viel Sachen konfrontiert wird, mit so viel Menschen, und nicht nachkommt, wie wir es vielleicht eigentlich möchten, wirklich anteilnehmend diesen zum Teil auch Katastrophen gegenüberzustehen«, erklärte die Schriftstellerin Brigitte Kronauer in einem Interview vor zwei Jahren. Da war gerade ihr bisher letzter Roman Gewäsch und Gewimmel erschienen. Ein gewaltiges Opus von 600 Seiten, das uns eine völlig neue Facette der Autorin offenbarte, denn so humorvoll und unangestrengt wie in diesem Roman waren wir Brigitte Kronauer zuvor noch nie begegnet. Von PETER MOHR
 Als im Sommer 2005 bekannt wurde, dass sie mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird, gehörte ihr Vorgänger Wilhelm Genazino zu den ersten Gratulanten. Kein Zufall, denn beider Werk weist viele Parallelen auf. Kronauer und Genazino schreiben seit vielen Jahren auf hohem Niveau, wurden von der Kritik stets wohlwollend begleitet, ohne jedoch ein breites Lesepublikum gefunden zu haben. Das liegt augenscheinlich daran, dass sich beide nie dem literarischen Mainstream angenähert haben und stets eine leicht hermetische, detailverliebte Beschreibungsliteratur favorisierten.
Als im Sommer 2005 bekannt wurde, dass sie mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird, gehörte ihr Vorgänger Wilhelm Genazino zu den ersten Gratulanten. Kein Zufall, denn beider Werk weist viele Parallelen auf. Kronauer und Genazino schreiben seit vielen Jahren auf hohem Niveau, wurden von der Kritik stets wohlwollend begleitet, ohne jedoch ein breites Lesepublikum gefunden zu haben. Das liegt augenscheinlich daran, dass sich beide nie dem literarischen Mainstream angenähert haben und stets eine leicht hermetische, detailverliebte Beschreibungsliteratur favorisierten.
Brigitte Kronauer, die am 29. Dezember ihren 75. Geburtstag feiert, ist eine Meisterin der Beschreibung. Jede vordergründig nebensächliche Veränderung in den Figurenkonstellationen, jede winzige Regung in der Natur wird registriert: Sie arbeitet mit einem literarischen Weitwinkel – ganz nah heran ans Geschehen und mit viel Tiefenschärfe ein breites Spektrum ablichten.
Die gebürtige Essenerin, die seit vielen Jahren in Hamburg lebt und dieser Stadt und ihrem Umfeld im Roman Teufelsbrück (2000) ein eindrucksvolles literarisches Denkmal setzte, hat in den frühen 70er Jahren den Lehrerberuf an den Nagel gehängt und sich ganz der Literatur zugewandt. Ein Wagnis, das sich erst ein Jahrzehnt später auszahlte. Drei schmale Bände mit Prosa und Aufsätzen waren bereits in Kleinverlagen erschienen, als der Verlag Klett-Cotta 1980 ihren ersten Roman Frau Mühlenbeck im Gehäus herausbrachte. »Wie ist es möglich, solche Sätze zu machen und jahrelang den Suchstrahlen der Literatur-Akquisition zu entgehen«, fragte damals die drei Jahre ältere Schriftstellerkollegin Hannelies Taschau in einer Rezension.
Der Durchbruch gelang Brigitte Kronauer dennoch erst 1986 mit dem Roman Berittener Bogenschütze, in dem sie einen Literaturwissenschaftler an einem Aufsatz mit dem Titel »Die Leere, Stille, Einöde im innersten Zimmer der Leidenschaft« schreiben lässt. Der Protagonist Matthias Roth (wie Kronauer selbst leidenschaftlicher Joseph Conrad-Fan), der eine schwere intellektuelle Lebenskrise durchmacht, wirkt wie ein männliches Erzähl-Ego seiner Schöpferin. Drei Jahre später erfolgte die erste bedeutende öffentliche Auszeichnung, als ihr der Heinrich-Böll-Preis verliehen wurde. Danach erhielt Brigitte Kronauer zudem noch den Mörike-Preis, den Bremer Literaturpreis und vor fünf Jahren den Georg-Büchner-Preis.
Seit 1990 (Frau in den Kissen) hat Brigitte Kronauer fast jährlich ein neues Buch publiziert: Romane, Prosa und immer wieder auch höchst intelligente Aufsätze und Essays. Eines ihrer gelungensten Werke war der schmale Prosaband Schnurrer (1992), der Momentaufnahmen von fotografischer Genauigkeit aus dem Leben der leicht kauzigen Hauptfigur Karl-Rüdiger Schnurrer lieferte.
Dieser introvertierte Schnurrer könnte mit all seiner Apathie indes auch ein Bruder von Willi Wings sein, der Hauptfigur aus Kronauers Roman Das Taschentuch (1994). Beide zeichnen sich dadurch aus, nicht aktiv am Leben teilzunehmen, sondern es zu beobachten. Schnurrer schaut sich die Leute in einem Copy-Shop aus sicherer Distanz an, und Willi Wings betrachtete lieber den Fisch als ihn zu verspeisen. Diese Episode im Roman Taschentuch war im belgischen Nordseebad Oostende angesiedelt, das auch in Kronauers kunstvollem Roman Verlangen nach Musik und Gebirge (2004) wieder eine ganz zentrale Rolle spielte. Und auch Jobst Böhme, spleeniger Inhaber eines Büro-Artikelshops und Hauptfigur des Kronauer-Romans Errötende Mörder (2007), trägt ähnlich skurrile Züge, denn er hat sich nach 10-jähriger Ehe von seiner Frau getrennt, weil er nicht mehr mochte, wie sie stets ihren kleinen Finger abspreizte.
Brigitte Kronauer ist fraglos eine der gebildetsten, sprachmächtigsten, fantasievollsten und ambitioniertesten zeitgenössischen Schriftstellerinnen, sie ist die »Feinmechanikerin« der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Literaturangaben
Brigitte Kronauer: Gewäsch und Gewimmel
Stuttgart: Klett-Cotta Verlag 2013
612 Seiten. 26,95 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Gewäsch und Gewimmel – Leseprobe
| Gewäsch und Gewimmel – rezensiert im TITEL kulturmagazin