Gesellschaft | Kathrin Hartmann: Wir müssen leider draußen bleiben
Ja, die Welt ist schlecht, weil ungleich. Aber hurra – wir tun doch was! Das Netzwerk der »Tafeln« sorgt dafür, dass auch Hartz-IV-ler würdig zu essen bekommen. Konzerne aus der reichen westlichen kreieren in der armen »Dritten Welt« neue Jobs für Frauen; mit unseren Microkrediten können sie sich sogar eine eigene Existenz aufbauen. Aber in Deutschland soll sich doch bitte niemand über Armut beschweren, das ist Jammern auf Luxusniveau. Wirklich? Kathrin Hartmann sieht das ganz anders. Wie und warum, belegt sie in ihrem neuen Buch Wir müssen leider draussen bleiben – Die neue Armut in der Konsumgesellschaft. Von PIEKE BIERMANN
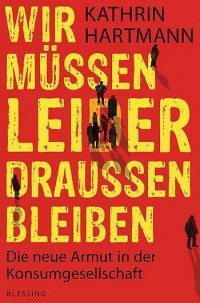 In ihrer Streitschrift Ende der Märchenstunde (2009) hatte sich die gelernte Journalistin Kathrin Hartmann die neue Mittelschicht vorgeknöpft: die Lohas. Diese mit dem US-Kürzel für Lifestyle of Health and Sustainability benannten modernen Besserverdiener legen größten Wert auf »politisch korrektes Konsumieren«. Sie kaufen vorzugsweise alles, was Prädikate wie »Bio« oder »Öko« oder »nachhaltig« trägt, von Essen bis Urlaub. Das kostet etwas mehr, macht aber ein ungemein gutes Gewissen. Kathrin Hartmann hatte genauer nachgesehen und enttarnt, dass dahinter fatal viel Selbstgerechtigkeit steckt und die Lohas in Wahrheit weder zu mehr Gesundheit noch zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt beitragen. Im Gegenteil.
In ihrer Streitschrift Ende der Märchenstunde (2009) hatte sich die gelernte Journalistin Kathrin Hartmann die neue Mittelschicht vorgeknöpft: die Lohas. Diese mit dem US-Kürzel für Lifestyle of Health and Sustainability benannten modernen Besserverdiener legen größten Wert auf »politisch korrektes Konsumieren«. Sie kaufen vorzugsweise alles, was Prädikate wie »Bio« oder »Öko« oder »nachhaltig« trägt, von Essen bis Urlaub. Das kostet etwas mehr, macht aber ein ungemein gutes Gewissen. Kathrin Hartmann hatte genauer nachgesehen und enttarnt, dass dahinter fatal viel Selbstgerechtigkeit steckt und die Lohas in Wahrheit weder zu mehr Gesundheit noch zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt beitragen. Im Gegenteil.
In ihrem neuen Buch legt sie nach und vergrößert das Panorama. Herausgekommen ist eine wohlfundierte Philippika gegen die Armut in unserer modernen Gesellschaft. Neu, wie der Untertitel suggeriert, ist die allerdings nicht, und sie findet auch keineswegs nur in den konsumierenden Gefilden der Gesellschaft statt. Aber sie hat dank der glorreichen Globalisierung schärfere Züge bekommen. Bildhaft gesprochen etwa so: Wenn man sich Armut und Wohlstand als zwei tektonische Platten vorstellt, funktioniert Globalisierung wie eine seismische Verwerfung, die die eine Platte nach oben reißt und die andere brachial nach unten presst. Inzwischen ist das Gefälle zwischen Armen und Reichen so steil, dass es gefährlich wird für Frieden, Demokratie und all die anderen schönen Dinge des menschlichen Lebens auf diesem Planeten.
Dass das die Verelendung überall dort radikalisiert, wo wir Armut sowieso bequemerweise verorten, ist die eine Folge. Aber Kathrin Hartmann geht es nicht um die x-te gönnerhafte Schilderung des Elends in der »Dritten Welt«. Sie hat vielmehr recherchiert, wo überall im reichen Deutschland Armut Einzug gehalten hat und wie damit umgegangen wird. Und sie ist dabei auf eine zweite wahrhaft empörende Radikalisierung gestoßen: die der Nicht-Armen. Empathie für Arme und Arm-Gemachte, gar Solidarität mit ihnen, sind im Orkus der rot-grünen Arbeitsmarktliberalisierung und ihrem bis dato nachhaltigsten Projekt »Agenda 2010« verschwunden. An ihre Stelle ist Verachtung getreten, »Klassenkampf von oben«. Öffentliches Schwadronieren über »Sozialschmarotzer« und deren – laut Guido Westerwelle – »anstrengungslosen Wohlstand« in der »sozialen Hängematte« ist heute konsensfähiger als »der Stammtisch« je war. Wohlstandsbürger mit Computer, Fernseher, Autoradio und Zeit- und Spiegel-Abo mokieren sich darüber, dass »solche Leute« unbedingt immer »Super-Handys« haben müssen. Da ist Beifall garantiert, in dem dann untergeht, dass sie womöglich wirklich müssen: Smartphones sind wenigstens ein gleichberechtigter Zugang zu Kommunikation, ihr Internetanschluss vielleicht der einzige Anschluss der Ausgeschlossenen an soziales und kulturelles Leben überhaupt.
Kathrin Hartmann klopft solche dahingeplapperten Sätze auf die Denk- und Gefühlsarmut dahinter ab, und trägt eine verheerende Menge Mosaiksteinchen zusammen, aus denen etwas blitzt, das sie als »Verrohung des Bürgertums« bezeichnet. Ein ganzes Kapitel ist dem Thema »Wie das Feuilleton die Rechte der Etablierten verteidigt« gewidmet. Und nicht nur die Zitate dort lassen einen frösteln, auch die übrigen stammen zumeist von Edelfedern, Meinungsmachern und anderen Vertretern der kultivierten, bildungsnahen Mitte der Gesellschaft.
Arme Leute hierzulande werden voreilig kriminalisiert. Aber selbst »nur« stigmatisiert zu werden, ist eine Form von Gewalt: Es demütigt und entwürdigt. Zu den Strategien der Ausgrenzung gehört außerdem ein medial besonders propagierter Mythos von der »nur relativen Armut« in Deutschland: Der stiehlt den 11,5 Millionen, die hier an oder unterhalb der Armutsgrenze leben, auch noch jede Legitimation für Unzufriedenheit oder gar Protest.
Sozialstaatliches Armutszeugnis
Vielleicht auf Druck rabiater neuer globaler wie lokaler Bewegungen – von Attac bis Occupy! –, vielleicht auch aufgrund eines eigenen inneren Anstandsrests geben sich Globalisierungsgewinnler heute gern ein soziales Image. In einer großen Reportage erzählt Kathrin Hartmann von einer Joghurt-Firma, die sich damit schmückt, in Bangladesh Beschäftigungsmodelle für arme Frauen aufzuziehen, und in Wahrheit nur ihre Produkte in die dortigen Supermärkte für die Mittelschicht lanciert. Die armen Frauen bleiben so arm wie zuvor. Auch bei den bejubelten Microkrediten geht es nur vordergründig darum, armen Frauen zur Existenzgründung zu verhelfen, und hintergründig um die Reorganisation armer Länder nach Maßgabe der Weltbank. Mit derart geschärftem Blick zurück nach Deutschland geguckt, müsste man eigentlich laut aufschreien, wenn sich wieder irgendwo Politiker, Nahrungsmittelproduzenten und Prominente mit sozialem Gewissen im schönen Schein der Tafeln sonnen. Denn die funktionieren nach derselben Dialektik wie Entwicklungshilfe, die Lebensmittel abwirft und damit die lokale Land- und Marktwirtschaft nachhaltig ruiniert. Auch die Tafeln werden, zwangsläufig, immer mehr und müssen mittlerweile auch nicht mehr nur Arme ernähren. Sie sind – bei allem, was sie an akuter Hilfe leisten – vor allem ein sozialstaatliches Armutszeugnis: der Beweis für die Unfähigkeit oder den Unwillen der Politik, die Armut abzuschaffen. Und statt zur Vermeidung von Müll beizutragen, verteilen sie ihn um.
So sprengt Kathrin Hartmann auf 400 Seiten die Realität unter unseren Mythen frei, mit kühler Wut, investigativem Feinbesteck und erfrischend schonungslos auch gegenüber der eigenen journalistischen Branche. Ein Ziegelstein, aber luftig gesetzt und rasant geschrieben. In den USA gäbe es für so etwas einen Pulitzer-Preis. Wir hätten hier auch den einen oder anderen feinen Journalistenpreis, nur sind die Jurys dafür vor allem mit den erwähnten Edelfedern besetzt.
| PIEKE BIERMANN
Eine erste Version dieser Rezension wurde am 4. April 2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.
Titelangaben
Kathrin Hartmann: Wir müssen leider draußen bleiben – Die neue Armut in der Konsumgesellschaft
München: Blessing 2012. 416 Seiten. 18,95 Euro
Reinschauen
Leseprobe
Kathrin Hartmann auf Facebook
Blog zu Kathrin Hartmann: Ende der Märchenstunde



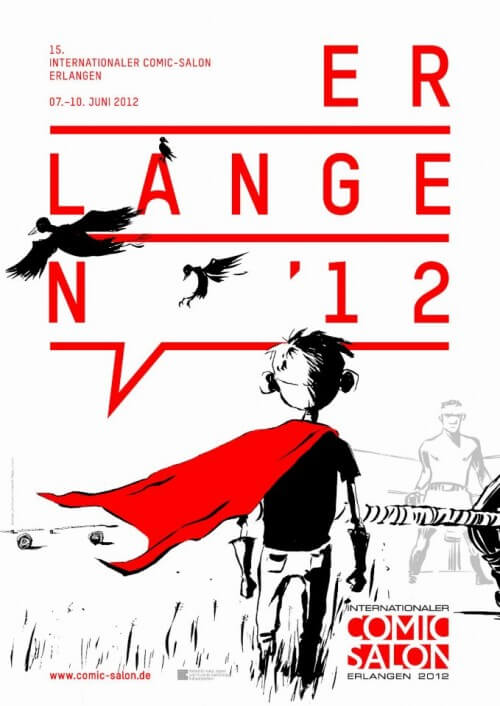
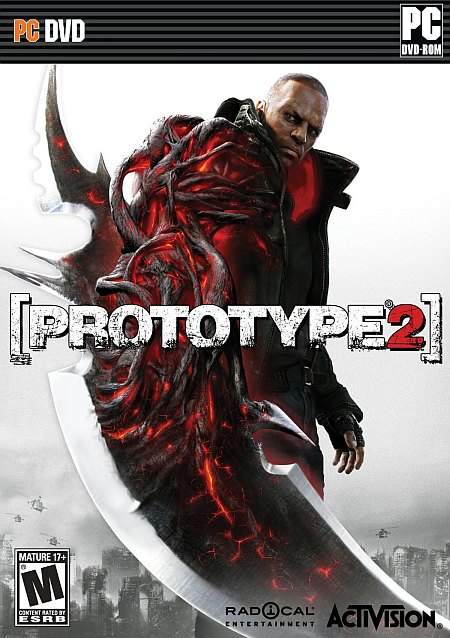
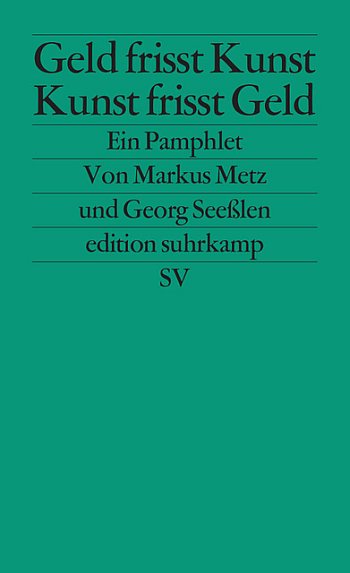

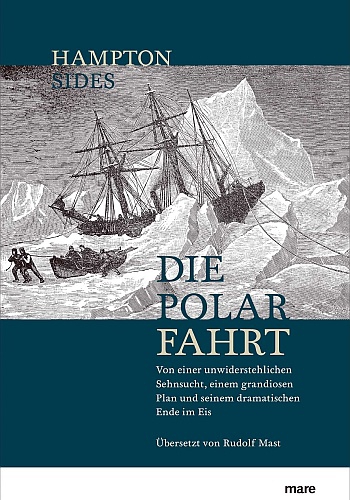
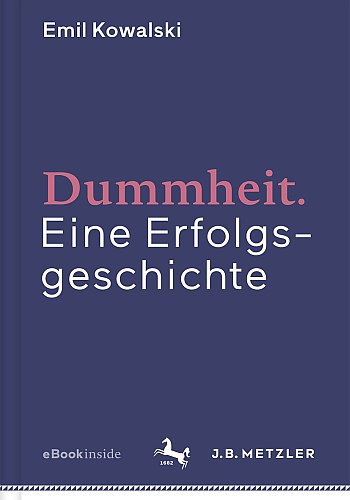

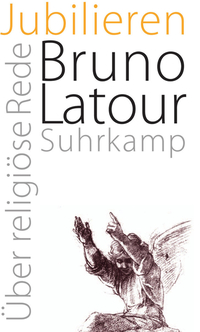
[…] Reinschauen Leseprobe Blog von Owen Jones Von der Verrohung des Bürgertums – Pieke Biermann zu Kathrin Hartmann: Wir müssen leider dra… […]