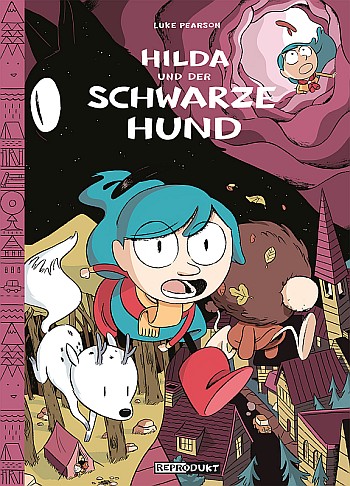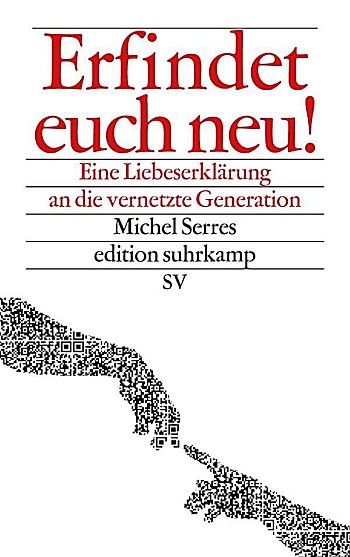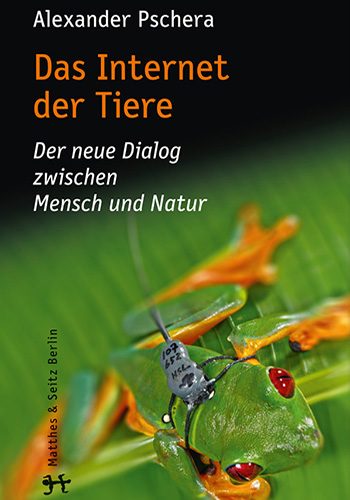Gesellschaft | Dan Diner: Rituelle Distanz. Israels deutsche Frage
Lange bevor die Bundesrepublik Deutschland und Israel 1965 diplomatische Beziehungen aufnahmen, öffnete das Luxemburger Abkommen von 1952 den Weg zu einer behutsamen Annäherung beider Staaten. Die Ereignisse sind längst ausführlich historisch beleuchtet worden, nicht wenige der Protagonisten haben ihre Erinnerungen veröffentlicht. Dan Diner, 1999-2014 Direktor der Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte in Leipzig, interessieren in ›Rituelle Distanz‹ allerdings gerade nicht die bekannten diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Aspekte. Von PETER BLASTENBREI
 Diners Studie ist Teil eines größeren Forschungsprojektes, in dem es um die Ablösung traditioneller jüdischer Lebenswelten und Bewusstseinsstrukturen nach 1945 geht. Er identifiziert das Luxemburger Wiedergutmachungsabkommen, die erste organisierte Kontaktaufnahme zwischen Juden und Deutschen nach der Katastrophe des millionenfachen Mordes, zu Recht als einen der entscheidenden Wendepunkte im Bewusstseinswandel des Judentums in dieser Zeit.
Diners Studie ist Teil eines größeren Forschungsprojektes, in dem es um die Ablösung traditioneller jüdischer Lebenswelten und Bewusstseinsstrukturen nach 1945 geht. Er identifiziert das Luxemburger Wiedergutmachungsabkommen, die erste organisierte Kontaktaufnahme zwischen Juden und Deutschen nach der Katastrophe des millionenfachen Mordes, zu Recht als einen der entscheidenden Wendepunkte im Bewusstseinswandel des Judentums in dieser Zeit.
Nach 1945 legte sich für Juden eine nahezu heilige Aura des Verbotenen um alles Deutsche. In Israel schloss das Tabu selbst die »guten Deutschen« ein, wie man damals anerkannte Vertreter des deutschen Humanismus (Goethe, Schiller usw.) im Gegensatz zu den nazistischen Schlächtern nannte. Der Autor widmet ein ganzes Kapitel dem quasireligiösen Charakter dieses Tabus und seinen langen historischen Wurzeln bis zurück zur alttestamentarischen Ächtung von Feindvölkern und dem rabbinischen Bann in Mittelalter und Neuzeit (cherem). Kontakte mit deutschen Politikern und Beamten, Deutsch als Verhandlungssprache, gar ein Händedruck bei Vertragsabschluss – das lag um 1950 außerhalb jeden Vorstellungsvermögens.
Wiedergutmachung wofür?
Und doch war es schließlich die israelische Regierung, die in ihrer finanziellen Notlage an Deutschland wegen Entschädigungen herantrat. Dass sich das in der herrschenden Atmosphäre nicht einfach pragmatisch begründen ließ, sondern nur mit Bezügen zu Bibel und rabbinischer Tradition, zeigte sich in der Knessetdebatte im Januar 1952, die den Verhandlungen vorausging. Die Regierung argumentierte hier mit der Geschichte von Nabots Weinberg im 1. Buch der Könige (»Der Mörder darf nicht Erbe seines Opfers werden«). Das unterstrich ihre Rechtsauffassung: künftige deutsche Leistungen waren keine Entschädigung für ermordete Juden – ein solches »Blutgeld« war undenkbar – sondern Äquivalent für geraubtes jüdisches Eigentum.
Die Opposition ging darauf nicht ein. Rabbi Mordechai Nurok verdammte jede deutsche Zahlung mit talmudischen Beispielen als schmutziges Geld, als Hurenlohn. Andere Kontaktgegner benutzten weltliche Argumente, so Menachem Begin die Geschichte der Pinsker Juden, die sich 1919 geweigert hatten, von der polnischen Regierung eine finanzielle Entschädigung für die Opfer eines Pogroms anzunehmen, solange die Schuldigen nicht bestraft waren – ein damals weit über Polen hinaus beachtetes Fanal. Der Linkszionist Adolf Berman bezog sich in seiner Ablehnung auf seine Erfahrungen als Untergrundkämpfer im Warschauer Getto, als er das gnadenlose Wüten der Deutschen hautnah erlebt hatte.
Die Verhandlungen kamen, wie man weiß, in Gang und führten zum erfolgreichen Abschluss. Doch wovor die Verhandlungsgegner gewarnt hatten, trat prompt ein: das Luxemburger Abkommen wurde zum ersten Schritt auf einem anfangs dornigen, dann immer bequemeren Weg zu guten, schließlich ganz hervorragenden Beziehungen auf allen Gebieten. Nicht einmal die Ächtung des Deutschen als Verhandlungssprache ließ sich in letzter Konsequenz durchhalten – ein Redner hatte in der Knesset vergeblich gefordert, nur Diplomaten ohne deutsche Sprachkenntnisse nach Luxemburg zu schicken.
Tabu und Staatsräson
An einem Punkt waren die Kontaktbefürworter auf Regierungsseite ihren Gegnern argumentativ haushoch überlegen. Sie nahmen für sich in Anspruch, für die neue israelische Staatlichkeit zu sprechen (die eben dringend Geld brauchte), während ihre Gegner ihre Ablehnung noch ganz aus dem Geist der jüdischen Diaspora herleiteten. Ein Bann, ein quasireligiöses Tabu gegen Feinde, das waren überholte Mittel einer vergangenen jüdischen Welt, Israel musste als Staat unter Staaten handeln.
All das war mehr als nur pragmatische Ad-Hoc-Argumentation. Es entsprach der jüdischen Wirklichkeit der Zeit, denn mit dem osteuropäischen Zentrum des Judentums waren zwischen 1939 und 1945 auch seine nichtzionistischen Lebensentwürfe untergegangen, vom religiös-orthodoxen über den assimilatorischen bis hin zum sozialrevolutionären. Nach 1945 fiel das jüdische Bewusstsein überall auf der Welt mit dem zionistischen Projekt zusammen, das vorher Sache einer Minderheit gewesen war.
Diner ist eine ebenso dichte wie stellenweise dramatische Darstellung gelungen (etwa in der einleitenden Beschreibung der ausgeklügelten »Choreografie« der Luxemburger Begegnung, die schließlich doch ihren Zweck verfehlte) und er hat mit den innerisraelischen Auseinandersetzungen um die Wiedergutmachungsverhandlungen ein besonders hervorstechendes Indiz für den jüdischen Bewusstseinswandel nach 1945 ans Licht geholt. Dabei analysiert er Argumente und Topoi bis in den semantischen Gehalt einzelner hebräischer Wörter hinein, zu Recht, denn so bewusst gingen auch die Redner von 1952 mit ihrer Sprache um.
Verfehlt wäre es aber, das Buch nur historisch zu lesen. Abgesehen von den politischen Weichenstellungen des Luxemburger Abkommens, von denen in den Jubiläumsfeiern zu 50 Jahren deutsch-israelischen Beziehungen noch genug zu hören sein wird, haben wir es hier mit fortwirkenden ideologischen Verwerfungen und Bewusstseinsprozessen zu tun. Nach 1945 legte sich der Zionismus in Form der israelischen Staatsräson dauerhaft über die bisherigen vielfältigen jüdischen Traditionen und Denkstrukturen, setzte sich an ihre Stelle und saugte sie auf. Nur Reminiszenzen lebten weiter, soweit sie mit der Staatsräson harmonisierbar waren – relevant sind sie schon lange nicht mehr. Das ist bis heute eines der ideologischen Grundprobleme Israels.
Titelangaben
Dan Diner: Rituelle Distanz. Israels deutsche Frage
München: Deutsche Verlags-Anstalt 2015
176 Seiten, 19,99 Euro
Reinschauen
| Leseprobe