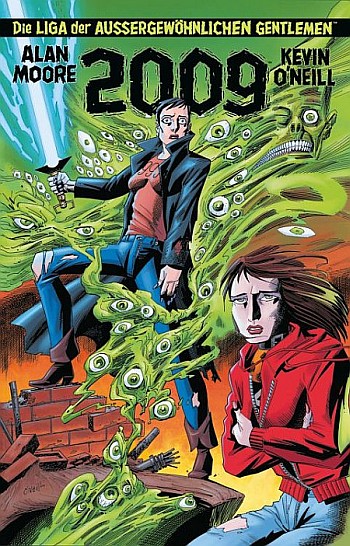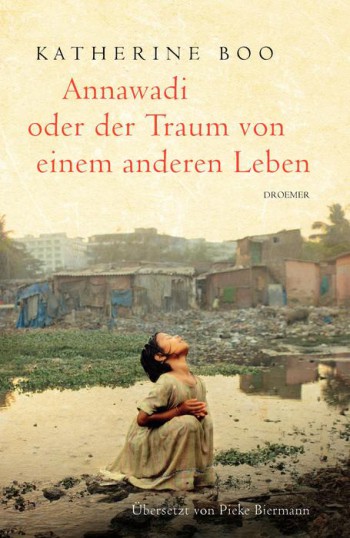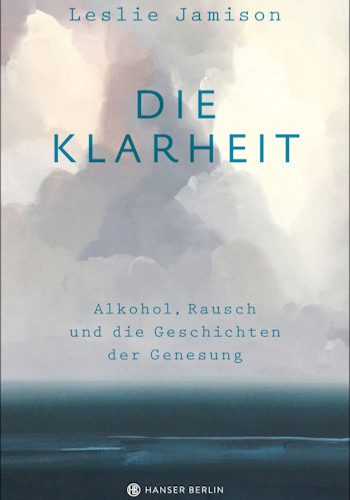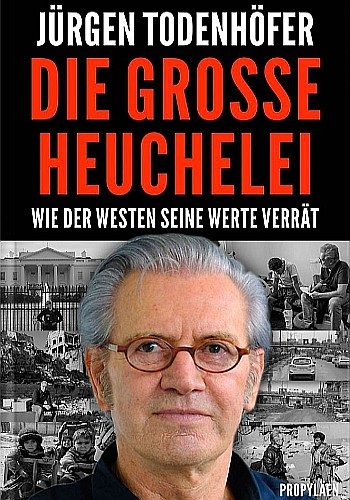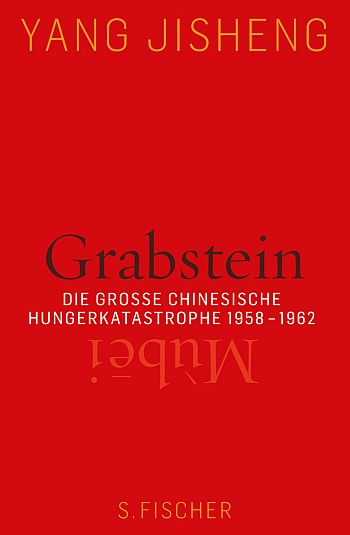Gesellschaft | Michael J. Sandel: Gerechtigkeit
Schaut man sich die Forderungen der Volksbewegungen der letzten Jahre an, gewinnt man den Eindruck, dass den Gesellschaften Europas vor allem eines abhanden gekommen ist, Gerechtigkeit. So sehr Gerechtigkeit heute zum aktuellen Anliegen geworden ist, für Philosophen aller Kulturen gehört sie seit Jahrhunderten zum Kernbestand ihrer Arbeit. Auch der derzeit bekannteste Philosoph der USA, Michael Sandel, widmet sich seit Jahren der Frage der Gerechtigkeit. Sein gleichnamiges Buch ist soeben auf Deutsch erschienen. Von PETER BLASTENBREI

Dass einem Philosophen der Sprung zum Bestsellerautor gelingt, ist eine extreme Seltenheit. Sandel, Ethikprofessor in Harvard, ist das mit Was man für Geld nicht kaufen kann gelungen. Gerechtigkeit erschien bereits 2009 in den USA und ist damit sozusagen das Mutterbuch des Bestsellers. Nur knappe zwei Seiten im Schlusskapitel von Gerechtigkeit befassen sich mit dessen Thema, dem Vordringen von Marktverhalten in menschliche Beziehungen. Nur dieses Schlusskapitel geht der aktuellen Frage nach, wie man akademisch-philosophische Erkenntnisse in eine gerechtere Politik für alle umsetzen könnte. Und es liest sich heute schon etwas kurios, welche Hoffnungen Sandel damals ausgerechnet auf US-Präsident Obama setzte.
Klassische Philosophenschulen
Sandels Ausgangspunkt für seine Reise durch 250 Jahre Philosophiegeschichte bildet der Utilitarismus aus dem späten 18. Jahrhundert. Das höchste Glück aller lässt sich danach erreichen, so sein Vordenker Jeremy Bentham, indem jeder Einzelne nach seinem eigenen größten Nutzen strebt und Unlustmomenten ausweicht. Eine simple Addition des Nutzens aller Einzelpersonen minus ihrer Kosten würde dann die messbare Summe des Glücks einer Gesellschaft ergeben. Individuen konnten in diesem System leicht unter die Räder kommen, und sogar Sklaverei war keineswegs ausgeschlossen, wenn nur eben die Schlussrechnung aufging.
Dem Utilitarismus stellt Sandel den klassischen Liberalismus an die Seite – wir würden heute eher Neoliberalismus oder Wirtschaftsliberalismus dazu sagen. In diesem System entscheidet das freie Spiel der Marktkräfte alles, Staat und Gesellschaft schützen nur noch das Eigentum und halten die Marktordnung in Gang. Soziale Ungleichheit stört hier nicht – wer arm ist, hat eben seine Chancen nicht genutzt oder nicht hart genug gearbeitet. Ein Extremfall ist das neoliberale Axiom, jeder besitze sich selbst, könne sich also (oder seine Körperteile) frei auf dem Markt anbieten und verkaufen.
Sandel zeigt sich deutlich mehr beeindruckt von Immanuel Kant, der den Utilitarismus schon 1780 einer vernichtenden Kritik unterzog. Für Kant handelt nur der Mensch als vernunftbegabtes Wesen frei, das heißt selbstbestimmt. Kants strikte Ethik fordert, auf dieser Basis das Richtige zu tun, weil man es als das Richtige erkennt, nicht wegen des eigenen punktuellen Lustgewinns. Dafür gebührt aber auch jedem Menschen Respekt, eben weil er ein Mensch ist, unabhängig von seinem Nutzen für die Gemeinschaft.
Mit dem bei uns weniger bekannten US-Philosophen John Rawls kommt Sandel ins 20. Jahrhundert. Rawls forderte 1971 dazu auf, ungleiche Startbedingungen wie Herkunft oder Vermögen, für die ein Individuum nicht verantwortlich ist, gezielt auszugleichen. Ziel ist keine Gesellschaft von Gleichen, sondern die Neutralisierung des Zufallsaspekts beim Erfolg und die stärkere Akzentuierung der persönlichen Leistung. In diese Richtung wirkt auch die von manchen US-Universitäten seit 1978 praktizierte »positive Diskriminierung«, die über Quoten Bewerber aus benachteiligten Minderheiten bevorzugt.
Denken lernen
Chancengerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, zielgerichtete Gerechtigkeit, Ausgleich historischer Benachteiligungen – Gerechtigkeit, wie sie die Philosophen verstehen, ist alles andere als eine schematische Handlungsanleitung oder gar als Wahlprogramm brauchbar. Gemeint ist richtiges Handeln des Einzelnen wie der Gesellschaft in kritischen Situationen und vor allem immer im unauflöslichen Spannungsfeld von Gemeinwohl und persönlicher Freiheit. Sandel selbst lässt keinen Zweifel, wo seine eigenen Präferenzen liegen: individuelle Entscheidungsfreiheit allein ist für ihn keine Basis für eine gerechte Gesellschaft ebenso wie Gerechtigkeit nicht aus (vorgeblich) wertneutralen Positionen abgeleitet werden kann.
Sandel benutzt (wie fast alle Philosophen heute) aktuelle Beispiele für Entscheidungssituationen, in denen es um richtiges, gerechtes Handeln geht. Leihmütter und militärische Kommandooperationen kommen da ebenso vor wie der Söldnereinsatz in US-Kriegen oder die Bankenrettung. Wie nicht anders zu erwarten, beziehen sich die Beispiele wiederum fast ausschließlich auf die USA (und sind daher nur partiell übertragbar). Diese aktuellen Entscheidungssituationen werden systematisch nach den Regeln der verschiedenen Denkschulen durchgeprüft, Lösungen entwickelt, verworfen oder widerlegt. Es geht, kurz gesagt, darum, Denken zu lernen. Philosophie eben.
Sandels Buch ist die Frucht jahrelanger Lehrveranstaltungen in Harvard, es folgt im Aufbau ungefähr dem Ablauf einer universitären Vorlesung. Das erklärt seine Solidität, seine Dichte und seine Systematik, aber auch, warum es bei weitem nicht so einfach zu lesen ist wie Was man für Geld nicht kaufen kann.
Eine besondere Klippe bietet der Begriff liberal. Im heutigen US-Englisch bezeichnet er eine Politik der vorsichtigen, weltanschaulich neutralen Staatsintervention in der Nachfolge von Roosevelt und Kennedy. So wird das Wort im letzten, politischen Kapitel gebraucht. Für die historische Denkrichtung dagegen benutzt der Übersetzer Libertarianismus (von englisch libertarian). Ziemlich unglücklich, aber nicht zu ändern.
| PETER BLASTENBREI
Titelangaben
Michael J. Sandel: Gerechtigkeit. Wie wir das Richtige tun
(Justice. What’s the right thing to do, 2009)
Deutsch von Helmut Reuter
Berlin: Ullstein 2013. 413 Seiten. 21,99 Euro