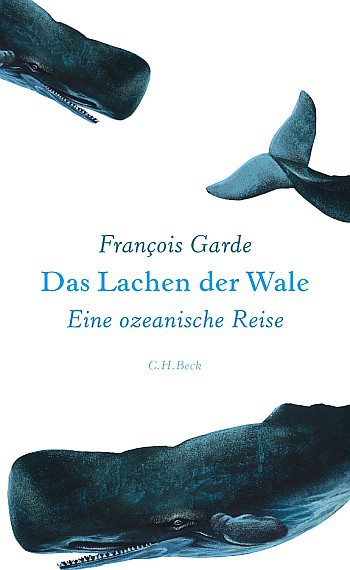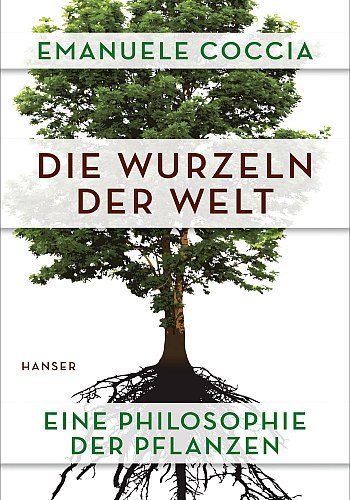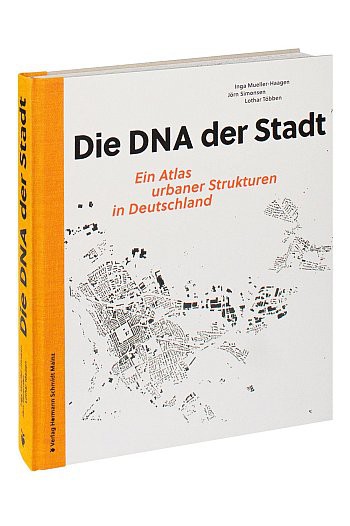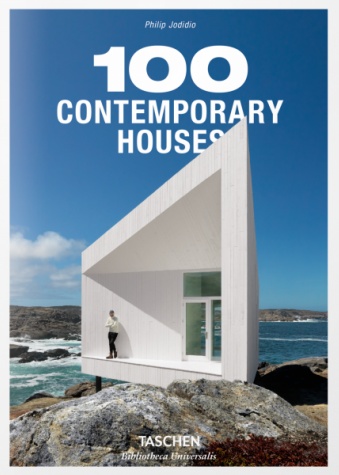Kulturbuch | Karl-Wilhelm Weeber: Von Achillesfersen und Trojanern
Karl-Wilhelm Weeber begibt sich auf die Spuren des geschichtlichen Ursprungs geläufiger und schon länger im Sprachgebrauch befindlicher Wörter. Von JENNIFER WARZECHA

Besonders die so genannte »Generation @« kennt das Phänomen: Man schreibt und schreibt sich zu Tode, egal, ob mit 140 Zeichen á la Twitter, in Form von schnellen Facebook-Nachrichten, die noch dazu das Risiko bergen, zeitversetzt gelesen und schnell vom Lesenden in einen ganz anderen Kontext gesetzt zu werden. Karl-Wilhelm Weeber möchte in seinem bei Reclam erschienenen Buch Von Achillesfersen und Trojanern – Wie die Antike im Deutschen fortlebt noch viel mehr als die deutsche Sprache retten: tief in den deutschen Kulturwortschatz vordringen und besonders die Herkunft alter Wörter erklären. Das gelingt ihm.
»Deus ex machina« oder »Dezember« – alles griechischen Ursprungs
»Deus ex machina« ist ein Ausdruck, der seinen Ursprung im griechisch-römischen Theater hat und im Deutschunterricht öfters erwähnt wird. Hierzu erklärt der Autor, welchen Sinn der plötzlich auftauchende Gott tatsächlich hat: »Wenn nichts mehr ›ging‹ und keine Aussicht mehr bestand, ein völlig verworrenes Handlungs- und Situationsknäuel zu entwirren, dann wurde mit Hilfe eines Krans ein Gott auf die Bühne gebracht, dessen Eingreifen dem Geschehen neue Impulse gab und die Blockade oder Ausweglosigkeit beendete: Der deus ex machina, ›der Gott aus der Maschine‹« (S. 49).
Interessant ist die Mischung aus Fachbegriffen – wie dem eben genannten – und täglich im Alltag gebrauchten wie dem Wort »Dezember«. Denn das Wort »geht auf das lateinische decem, ›zehn‹, zurück« (S. 49). Latein gilt nicht umsonst als »Mutter aller Sprachen«. Weeber, geboren 1950, heute Leiter des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums in Wuppertal und Professor für Alte Geschichte an der Universität Wuppertal sowie Lehrbeauftragter für die Didaktik der Alten Sprachen an der Ruhr-Universität Bochum, hat sich nicht nur mit der Herkunft mancher Wörter aus der griechischen Antike beschäftigt, sondern auch zahlreiche Bücher zur römischen Alltagsgeschichte verfasst. Gespaltene Meinungen ruft er bei den Rezensenten mit seinem Werk Romdeutsch (Eichborn 2006) hervor. Zufrieden äußert sich NZZ-Rezensent Klaus Bartels bezüglich Weebers Analyse lateinisch-deutschen Sprachgebrauchs und Ursprungs: So überzeuge der »Streifzug durch die lateinischen Spuren in der Gegenwartssprache« durch »Vielfalt und hohen Unterhaltungswert«. Dies sei unabdingbar für das bessere Verständnis, die witzige Darbietung müsse den Leser überzeugen. Gegenteilig empfindet das FAZ-Rezensent Uwe Walter: »Allzu gern möchte er den Fleiß und das redliche Bemühen des humanistisch gebildeten Autors honorieren. Doch es gelingt ihm nicht so recht. Zu altbacken der Witz, zu wenig satirisch der Aktualitätsbezug Karl-Wilhelm Weebers“, ist auf perlentaucher zu lesen.
Jahrtausend Jahre alte Geschichte der Sprache – komprimiert als gut verständlicher Artikel
Was die Rezensenten schon vor Jahren feststellen, ist bei Von Achillesfersen und Trojanern – Wie die Antike im Deutschen fortlebt nicht zu leugnen: Vermeintliche Gegensätze gibt es bei der sprachlichen Gestaltung des prosahaft dargestellten Wörterbuches. Der Autor schreibt sachlich und spart nicht mit Ironie. So schreibt er zu »Orgie«: »Wie muss es da erst bei den Griechen zugegangen sein, die das Wort nur im Plural kannten (ta ´orgia)?!« (S. 130). Auf diese Weise gelingt sowohl ein Bezug zur Gegenwart als auch ein geschichtlicher Abriss. Die für das jeweilige Wort auf jeweils eine halbe Seite komprimierte Sprachgeschichte wirkt durch die Kürze wie ein Lexikoneintrag, durch die Ausführlichkeit und Prägnanz wird die jahrtausendealte Sprachgeschichte nicht nur vorstellbar, sondern auch zu einem amüsant geschriebenen Geschichtsbuch. Wie das Lexikon der schönen Wörter ist Von Achillesfersen und Trojanern eine Huldigung an die deutsche Sprache, vor allem ihrer Sprachgeschichte und Kultur, und nicht nur für Altphilologen und Germanistikstudenten interessant. Genaues Nachdenken über den Sprachgebrauch garantiert, Rechtschreibfehler in Facebook? Zumindest unwahrscheinlich.
| JENNIFER WARZECHA
Titelangaben
Karl-Wilhelm Weeber: Von Achillesfersen und Trojanern. Wie die Antike im Deutschen fortlebt
Stuttgart: Reclam 2012. 207 Seiten. 19,95 Euro