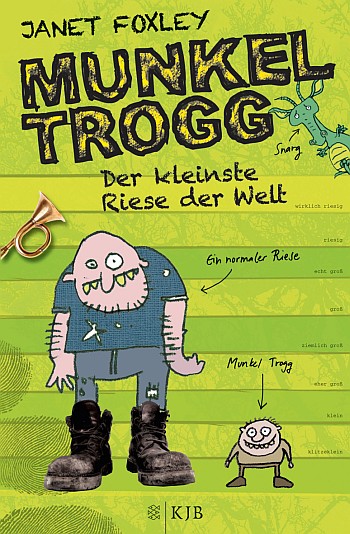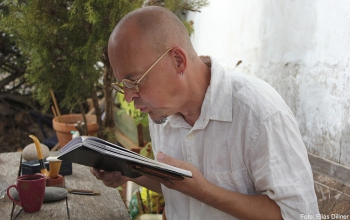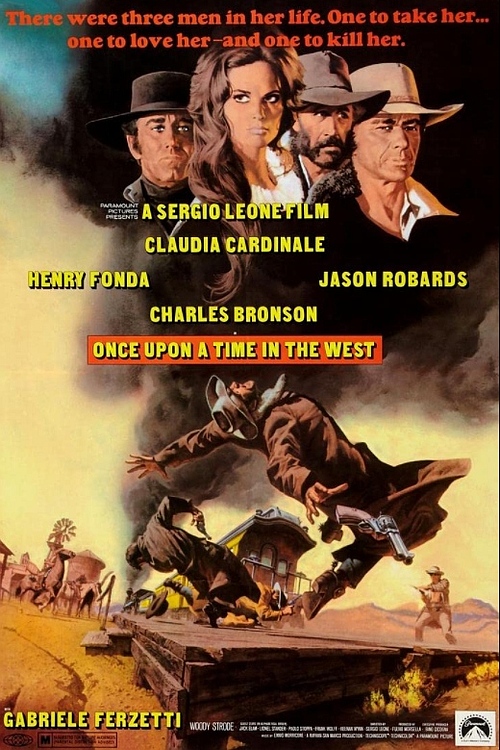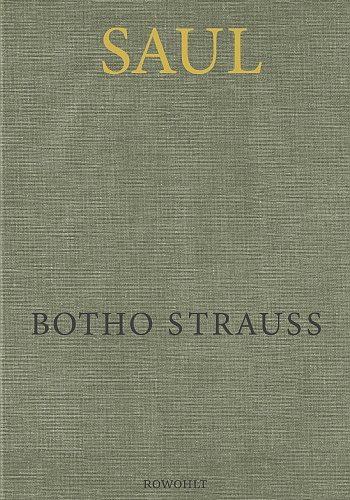Menschen | Zum 75. Geburtstag von Joyce Carol Oates
Unendlich viel hat Joyce Carol Oates schon geschrieben, zuletzt zwei bewegende autobiografische Romane, und in den letzten Jahren ist sie immer wieder als heiße Nobelpreiskandidatin gehandelt worden. Am Sonntag wird die amerikanische Schriftstellerin 75 Jahre alt. Von PETER MOHR
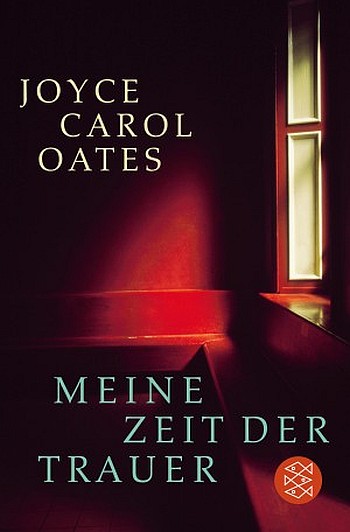
»Ich habe all diese hässlichen Wörter einfach hingeschrieben und bin dabei allmählich in Fahrt gekommen. Ein stiller Schreibrausch hat mich erfasst«, lässt Oates eine Figur in ihrem Roman Zombie (dt. 2000) erklären. Ein Resümee, das auch auf die Autorin zutrifft, die von der Literatur besessen ist und die von sich selbst sagt: »Wenn ich nicht schreibe, dann lese ich.«
Schon als Schülerin soll sie die ersten Geschichten verfasst haben, als junge Studentin (so die Legende) schrieb sie pro Semester einen Roman, die Veröffentlichung ihres ersten Bandes mit Kurzgeschichten liegt schon fast fünfzig Jahre zurück, und bereits 1969 erhielt sie für den Roman Them den National Book Award. Inzwischen sind es rund 60 (publizierte) Romane, über 100 Kurzgeschichten, dazu zahllose Essays, Theaterstücke, Drehbücher, Kritiken und wissenschaftliche Aufsätze.
Joyce Carol Oates, die am 16. Juni 1938 im ländlichen Städtchen Lockport im US-Bundestaat New York als Tochter eines verarmten Bauern geboren wurde, hat ein ausgeprägtes Faible für die epische Breite. Sie malt ihre Romanschauplätze mit fotografischer Präzision aus, selbst Handlungskomparsen werden wie mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Diese Beschreibungsmanie, die sie mit ihren Vorbildern James Joyce und Thomas Mann teilt, hat bisweilen auch zu einer anstrengenden Langatmigkeit geführt.
Den Vorwürfen der Vielschreiberei begegnet die in Princeton als Professorin für kreatives Schreiben lehrende Autorin mit Hinweisen auf ihre Arbeitsweise: »Leben heißt für mich arbeiten.« Da sie nach eigenem Bekunden nie länger als sechs Stunden schläft, bleiben pro Tag 18 Stunden, um zu schreiben, zu lesen oder zu lehren.
Nach dem inhaltlich etwas überfrachteten Roman Niagara (2007) hat sich Joyce Carol Oates noch stärker als früher künstlerisch an der eigenen Vita abgearbeitet.
2008 erschien der Roman Du fehlst, mit dessen Niederschrift sie kurz nach dem Tod ihrer Mutter begonnen hat, die 2003 an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist. Es geht darin einerseits um eine gestörte Mutter-Tochter-Beziehung und andererseits um ein blutiges Verbrechen, das den beinahe automatisierten Alltag in einer Kleinstadt nördlich von New York aus dem Rhythmus bringt.
Zwei Jahre später erschien unter dem Titel Geheimnisse die semi-fiktive Lebensgeschichte ihrer Großmutter, der sie die Widmung »für meine Großmutter Blanche Morgenstern, die Tochter des Totengräbers« vorangestellt hat. Ein bewegendes, ja geradezu unter die Haut gehendes Werk ist Oates‘ bisher letzter, in deutscher Übersetzung erschienener Band Meine Zeit der Trauer (2011).
»Mein Mann ist gestorben, mein Leben ist zerbrochen.« Dieser, dem Buch vorangestellte, ebenso einfache wie treffende Satz charakterisiert Joyce Carol Oates‘ gesamtes opulentes Erinnerungsbuch vorzüglich. 47 Jahre war die amerikanische Schriftstellerin mit ihrem Ehemann Raymond Smith verheiratet, als dieser völlig überraschend am 8. Februar 2008 gestorben ist. Die Autorin selbst hatte ihn in das Princeton Medical Center gefahren, die erste Diagnose lautete: Lungenentzündung.
Das Paar war davon ausgegangen, dass Raymond nur wenige Tage in der Klinik verbleiben müsste. Und dann der grausame Schock: Joyce Carol Oates‘ Ehemann war knapp eine Woche nach seiner Einlieferung an einer im Krankenhaus erlittenen Infektion gestorben. Als die Autorin alarmiert wurde und in die Klinik eilte, war ihr Mann bereits 20 Minuten tot. Oates beschreibt in diesem Buch die abrupt entstandene Leere in ihrem Leben, berichtet von lang anhaltender Schlaflosigkeit und starkem Gewichtsverlust, von teilweise völlig irrationalen Betrachtungen von Erinnerungsstücken bis hin zu monotonen Selbstgesprächen.
Diese singuläre emotionale Mischung von Trauer, Wut, Ratlosigkeit und Zorn, die authentisch beschriebene Achterbahnfahrt der Gefühle macht Meine Zeit der Trauer zu einem großen literarischen Werk und hat noch einmal nachdrücklich Joyce Carol Oates‘ künstlerischen Rang unterstrichen.
| PETER MOHR
Titelangaben
Joyce Carol Oates: Meine Zeit der Trauer
Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz
Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 2011
494 Seiten. 24,95 Euro