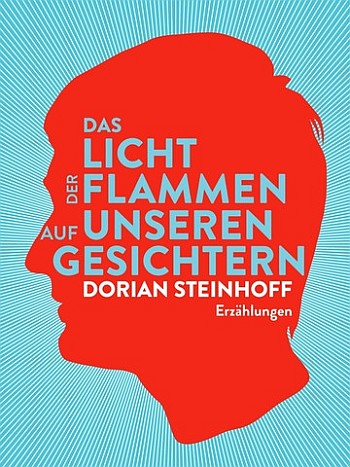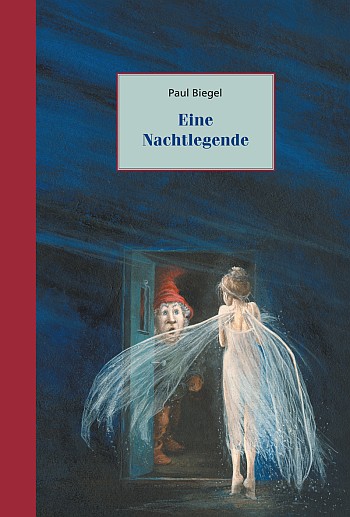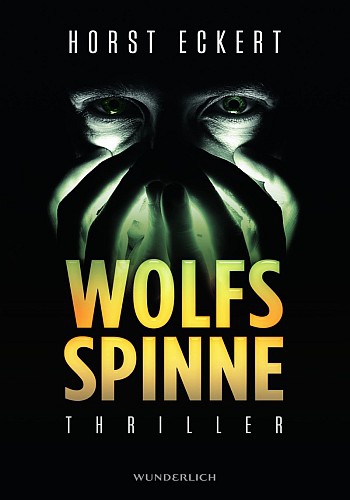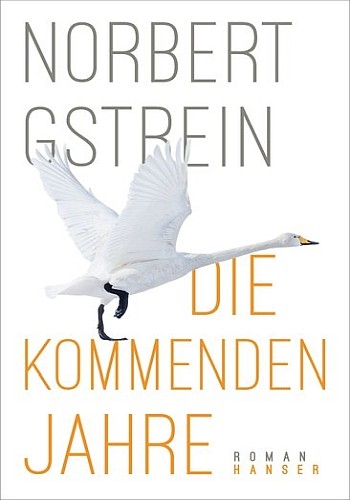Roman | Thomas Stangl: Die Regeln des Tanzes
Also gut, es geht nicht anders! Beginnen wir mit dem Zitat, dass fast alle Rezenten benutzt haben, weil es einfach genial ist: »Zwei bösartige Gnome wie aus einem schlechten Märchen haben mit einer Bande von Faschisten und Gaunern die Macht im Land übernommen«. Dieses Statement bezieht sich auf die politische Situation in Österreich im Februar des Jahres 2000 und ist die Ausgangslage von Thomas Stangls Roman Die Regeln des Tanzes. Rezensiert von WOLFGANG HAAN.
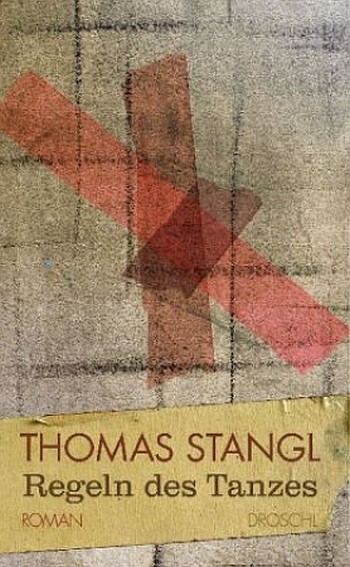
Obwohl Politik, mal offensichtlicher, mal unterschwelliger, eine wichtige Rolle in seinem vierten Roman spielt, ist es kein politischer Roman. Im Mittelpunkt der fein verästelten Handlungs- und Zeitstränge stehen die beiden Studentinnen Mona und ihre ältere Schwester, deren Namen man erst auf der vorletzten Seite des Romans erfährt. Gleich zu Beginn des Romans verlässt Mona die gemeinsame Wohnung – ohne eine Nachricht zu hinterlassen und hinterlässt ihre Schwester hilf- und ratlos.
Hilf- und Ratlosigkeit
Das Thema der Hilf- und Ratlosigkeit zieht sich durch den gesamten Roman und treibt auch den dritten Protagonisten um: Dieser lebt gleichfalls in Wien, doch ist es ein anderes, zukünftiges. Dr. Walter Steiner, Mittsechziger und seines Zeichens Gutachter, lebt im Wien des Jahres 2015 gemeinsam mit seiner Frau Pre und »vier- bis fünftausend Büchern und seinem Computer« in einer großzügigen Wohnung; Mercedes in der Garage. Vermutlich tritt er gerade seinen Ruhestand an. Dezidiert wird dies nirgendwo gesagt nur: »Er hatte nun wieder Zeit…«, und an einer anderen Stelle: »wie vor Jahrzehnten, als er noch Geheimnisse und kleine Wunder hinter jeder Ecke … erwartet hatte.«
Sowenig wie er mit seiner Frau redet, sowenig reden auch Mona und ihre Schwester miteinander. Alle drei leben in ihren inneren Welten, führen innere Monologe. Auf der Straße weichen sie anderen aus, und wenn sie Kontakt zu anderen haben, dann nur flüchtig: Auf ein Bier, lieblosen Sex oder um sich inmitten einer Demonstration bewusst einsam zu fühlen. Allen Dreien, und der Schilderung der Landschaft/Wiens/der Wohnungen, gemeinsam ist ein Akt der Verwahrlosung und des Verfalls. Sieht sich Dr. Steiner am Anfang des Romans noch wie »George Clooney in zehn Jahren«, so hält er sich nur einige Wochen später für einen »wirren alten Sonderling«. Mona isst und trinkt während ihrer kurzen Flucht kaum und so sind »ihre Augen dunkel und groß, ihre Wangen mager; ihre Haut ist grau und dann papierweiß unter dem Neonlicht.« Bei der dritten Protagonistin vollzieht sich die Verwandlung bewusst: Sie will in die Fußstapfen ihrer Schwester treten und Butoh lernen, einen japanischen modernen Ausdruckstanz. Doch nur der Tanz reicht ihr nicht. »Dabei weiß sie, es ist nur eine Nachahmung, sie ist nur eine Verdopplung, geht an Monas Stelle, lebt an Monas Stelle.« Und auch das prunkvolle Wien verfällt und »ist voll mit Papierfetzchen, Plastikflaschen, Zigarettenkippen, Flugblättern voller Fußspuren.«
Verbindung
Zwei Filmdosen mit analogen Kleinbildfilmen, die Dr. Steiner bei einem seiner ziellosen Spaziergänge in einer Mauernische findet, verbinden die drei Figuren des Romans: »… einen ganzen Film, in den er umsteigen könnte, wie in eine parallele, auf Zelluloidstreifen festgehaltene Existenz.« Die Fotos stammen aus dem Jahr 2000 und zeigen u.a. zwei junge Frauen; die Beerdigung von Monica und einen leeren Raum aus verschiedenen Perspektiven. Er lässt diese entwickeln und auf Fotopapier abziehen, um sie in Ruhe betrachten zu können: »Von all dem erzählt er Pre nichts…. Er sieht Pre auftauchen und verschwinden, als bewohne sie einen anderen Raum, eine parallele Welt, die sich zufällig über seine Wohnung gelegt hat«. Als Pre ihn kurz nach Beginn der Erzählung kommentarlos verlässt, unternimmt er auch keinen Versuch, sie wiederzusehen. Er meidet einfach Plätze, Straßen oder Veranstaltungen, bei denen er auf sie stoßen könnte und bemerkt nur, dass eines Tages einige Dinge in der Wohnung fehlen, die ihr gehört haben.
Eine zweite Welt in dieser Welt
Es laufen nun drei Handlungsstränge parallel zueinander ab: Mona tanzt sich zur Selbstvernichtung, die Suche der Schwester nach Mona und ihre Hinwendung zum Tanz und Walters Suche nach den Mädchen auf den Fotos. Dabei »ist es reizvoll (für Ihn), sich mit den Mädchen zu identifizieren, sich für eines von ihnen, nein, eben nur für beide zugleich, zu halten …«. Erzählt wird der Roman in der zweiten und dritten Form, wobei sich dabei kein klares Muster erkennen lässt, wann und warum der Wechsel erfolgt. Aber er folgt immer festen Strukturen. Aus der Bewegung heraus kommt es zum Stilstand. In diesem Zustand erfolgen Betrachtungen der jeweiligen Protagonisten, die dann wieder in Bewegung umgesetzt werden. Dies kann ganz klassisch sein in dem sie in einer U-Bahn sitzen und dann aussteigen. Aber es kann sein, dass sie vor einem Baum stehen und die Ästchen beginnen sich zu bewegen; oder das Rinnsal eines Baches wird beschrieben. Während dieser Phasen des Stilstandes wird viel über parallele Wirklichkeiten und Räume sowie deren Inhalte nachgedacht: »Fast immer ist ihr bewusst, dass es die parallele Wirklichkeit gibt, die sie genau so sehr betrifft und in der sie genau so wenig eine Rolle spielt … sie wünscht sich einen Mechanismus, mit dem sie zwischen diesen Wirklichkeiten hin- und herwechseln könnte…«
Dieser Wechsel von Bewegung und Stillstand macht sich auch im Stil von Stangl bemerkbar. Teils hetzt er den Leser von Aktion zu Aktion, teils berichtet er sehr ruhig vom Innenleben, ja wird richtig karg wie der Februarwald, den er so häufig beschreibt – Wiederholungen sind auch eine beliebte Methode des Autors. So kommt auch die oben beschriebene Stelle der Verschmutzung Wiens mehrfach in unterschiedlichen Zusammenhängen zur Sprache.
Die Spitze dieses wohldurchdachten und erstklassig konzipierten Buches ist die kargste Stelle im Buch, welche den Leser ob Ihrer Unbeflissenheit völlig überrascht: Walther ist besessen davon, die »Überlebende« zu finden; setzt alles daran; isst nicht, trinkt nicht, lässt die Wohnung verkommen. Und dann, als Finale seiner Suche, dieser Satz: »Einmal stößt er auf eine Adresse, die ihm absurd erscheint, Straßennamen und Postleitzahl klingen nach tiefster Pampa; er ruft die Nummer an und ist enttäuscht, als eine Männerstimme ihm antwortet;…«
Von hier bis zum Ende des Romans ist es nicht mehr weit – und wir überlassen es Ihnen, den Namen der älteren Schwester herauszufinden. Und, ob auch Walther auf seine alten Tage zum Butoh-Tänzer wird.
Fazit: Thomas Stangls ambitionierter Roman wird wohl so manchen Leser am Ende des Buches verwirrt zurücklassen. Er gibt keine Antworten auf die aufgeworfenen Fragen und man ist ihm schon dankbar, dass er wenigstens das Rätsel um den Namen der zweiten Schwester löst. Man muss sein Spiel der Wirklichkeiten, sein Eintauchen in eine Welt vor und nach dem Internet, mitmachen und sich darauf einlassen, dass Sätze häufig mehrfach gelesen werden müssen, um ein Verständnis der Dimension des Geschriebenen zu erreichen.
Sein Roman ist kunstvoll konzipiert aber nicht zu artifiziell, um ihn nicht verstehen zu können. Man sollte jedoch nicht versuchen, gleich beim ersten Auftauchen von bildhaften Metaphern diese zu entschlüsseln, weil sich erst aus dem Gesamtbild mit dem abrupten Ende diese Sinnbilder aufschlüsseln und verstehen lassen. Ein Roman, der zu Recht auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2013 gelandet ist.
| WOLFGANG HAAN
Titelangaben
Thomas Stangl: Die Regeln des Tanzes
Graz: Droschel Verlag 2013
280 Seiten, 22 Euro