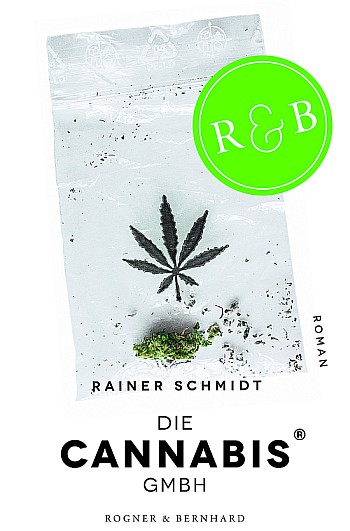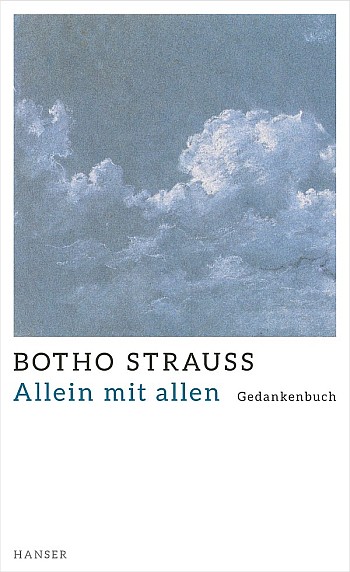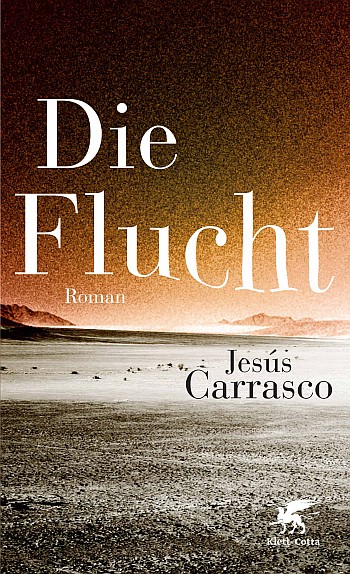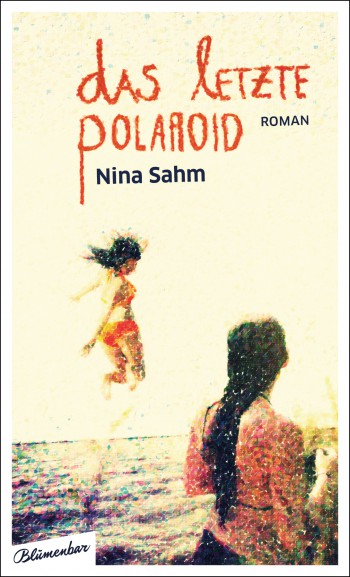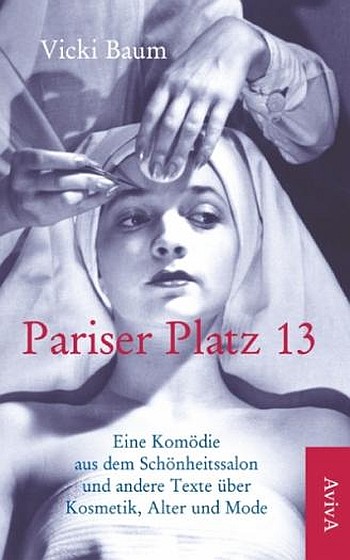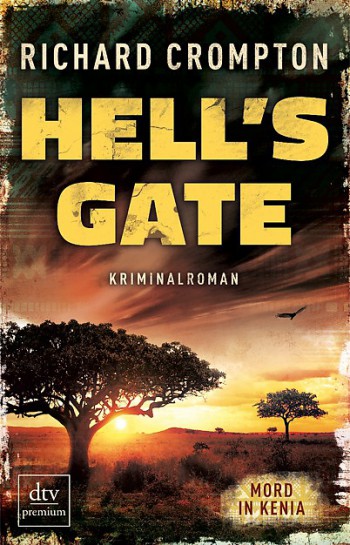Roman | Ulla Hahn: Spiel der Zeit
»Bitte nie vergessen: Ich habe einen Roman und keine Autobiografie geschrieben. Jeder weiß, wie Erinnerung funktioniert und wie trügerisch sie sein kann«, hatte Ulla Hahn kürzlich in einem Interview nach Erscheinen ihres dritten, stark autobiografischen Romans ›Spiel der Zeit‹ erklärt. Mit diesem opulenten Erzählwerk knüpft die einst von Marcel Reich-Ranicki als Lyrikerin geförderte Autorin beinahe nahtlos an die umfangreichen Vorgängerwerke an, den 500.000mal verkauften und später unter dem Titel ›Teufelsbraten‹ verfilmten Roman ›Das verborgene Wort‹ und den zweiten Band ›Aufbruch‹ (2009). Einen vierten Band hat Ulla Hahn bereits angekündigt. Von PETER MOHR
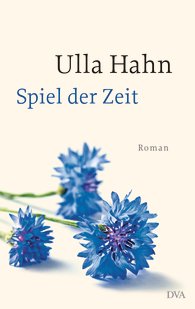 Im Mittelpunkt steht wieder Hildegard (genannt »Hilla«) Palm, Spross einer rheinischen Arbeiterfamilie aus dem fiktiven Dondorf. So ähnlich wie dieser Ort Dondorf der zwischen Düsseldorf und Köln gelegenen Kleinstadt Monheim ist, in der die heute 68-jährige Schriftstellerin aufgewachsen ist, so stark sind auch die Ähnlichkeiten (trotz der geäußerten Vorbehalte) zwischen Ulla Hahns Biografie und dem Lebensweg der literarischen Figur Hilla Palm.
Im Mittelpunkt steht wieder Hildegard (genannt »Hilla«) Palm, Spross einer rheinischen Arbeiterfamilie aus dem fiktiven Dondorf. So ähnlich wie dieser Ort Dondorf der zwischen Düsseldorf und Köln gelegenen Kleinstadt Monheim ist, in der die heute 68-jährige Schriftstellerin aufgewachsen ist, so stark sind auch die Ähnlichkeiten (trotz der geäußerten Vorbehalte) zwischen Ulla Hahns Biografie und dem Lebensweg der literarischen Figur Hilla Palm.
Die Protagonistin hat inzwischen das Provinznest verlassen und lebt in einem katholischen Studentenheim in Köln. Es ist die wilde Zeit der 68erBewegung, in der es um politische Aufbrüche, sexuelle Befreiung und allerlei Weltverbesserungseifer geht. Ein hoher Wiedererkennungswert für Angehörige der Ulla-Hahn-Generation ist garantiert.
»Erst vor dem Hintergrund des Erfundenen konnte ich aussprechen, was mir damals widerfahren ist«, hatte Ulla Hahn 2001 nach der Veröffentlichung ihres ersten Hilla-Palm-Romans ›Das verborgene Wort‹ erklärt. Durch den zeitlichen Abstand, durch gezielte fiktive Einschübe und nicht zuletzt durch das Medium Sprache selbst hat sich Ulla Hahn selbstbefreiend an der eigenen Biografie abgearbeitet.
Hilla hat mit gewachsener sprachlicher Kompetenz auch erheblich an Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Sprache fungiert als Brücke zur Welt, als Sprungbrett zum Verlassen des »Kleine-Leute-Milieus«. Da passt es beinahe trefflich ins Bild, dass ihr vermögender Verlobter Hugo aus gutem Hause stammt und ebenfalls Probleme mit seiner Familie hat.
Das Paar funkt nicht nur erotisch, sondern auch geistig auf der gleichen Frequenz. Mehr Neugierde als wirkliche Überzeugung treibt Hilla und Hugo an, wenn es um Rudi Dutschkes politisch-missionarische Reden, um Notstandsgesetze, Vietnamkrieg, den Ostermarsch oder andere Protestbewegungen geht. Feten in den Studentenkreisen dieser Zeit arten zu endlosen haschgetrübten politischen Debatten aus. »Für das Dondorfer Mädchen ziemlich viel große böse Welt an einem Abend.« Für das Paar ist die Affinität zur Sprache, die erwachende Liebe zur Poesie ein wichtiges Bindeglied. Wie sich die Studentin Hilla an der Lyrik Ezra Pounds abquält, liest sich – trotz des kapitalen Umfangs dieses Handlungsschlenkers – herrlich authentisch und emotional nachfühlbar.
Ulla Hahn schlägt wie in den Vorgängerwerken weite Bögen, erzählt anekdotenreich und manchmal eben auch sehr detailverliebt. Aber der atmosphärische Funkenschlag bleibt aus, die von immensem Idealismus beseelte Aufbruchstimmung als tragendes Lebensgefühl in den Studentenkreisen kommt nicht wirklich »rüber«.
»Seine Herkunft trägt man immer in sich. Das muss einem aber nicht zeitlebens als Bürde erscheinen. Es kommt darauf an, eine Last in Proviant zu verwandeln. In Erfahrung, von der man auf seiner Lebensreise zehren kann. Das ist dann noch mehr als Versöhnung«, hatte Ulla Hahn kürzlich erklärt und damit auch Hilla Palms Grundstimmung am Ende des Romans treffend auf den Punkt gebracht. Wir befinden uns im Jahr 1968, und die Protagonistin hat peu à peu innerlichen Frieden mit ihrer Familie geschlossen.
Spiel der Zeit lässt sich trotz einiger narrativer Längen als unterhaltsames und kluges Gesellschaftspanorama der späten 1960er Jahre lesen. Vor allem deswegen, weil es Ulla Hahn bewusst vermieden hat, die zurückliegende Epoche in irgendeiner Weise zu glorifizieren. Es war nämlich entgegen des Gassenhauers der Kölschband Brings keine »superjeile Zick«.
Titelangaben
Ulla Hahn: Spiel der Zeit
München: Deutsche Verlags-Anstalt 2014
603 Seiten. 24,99 Euro
Reinschauen
| Leseprobe
| Ulla Hahn in TITEL kulturmagazin