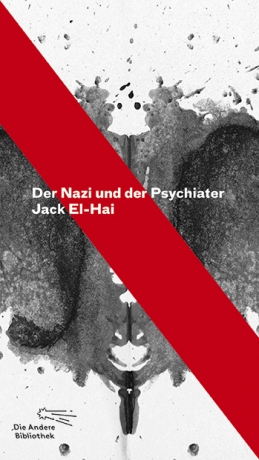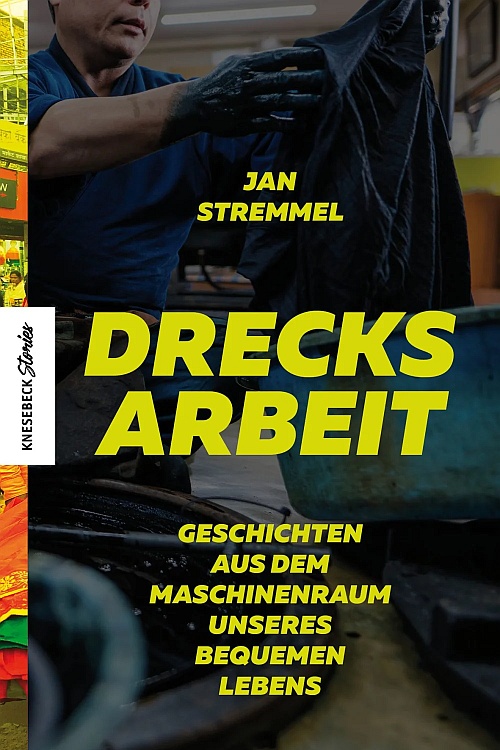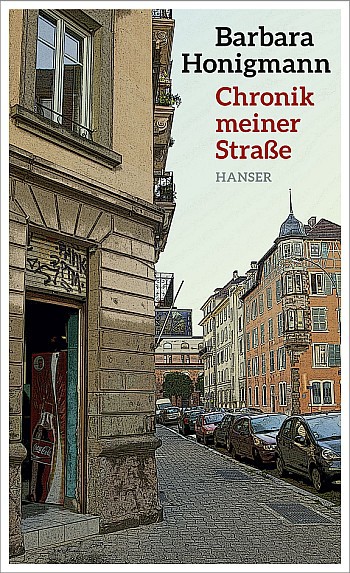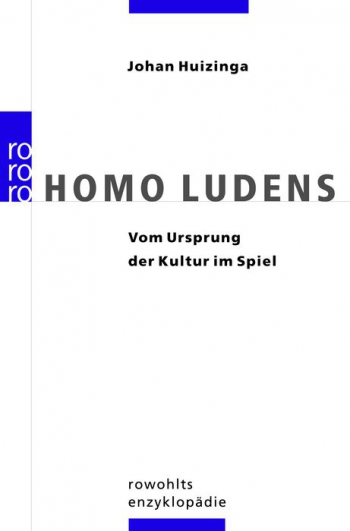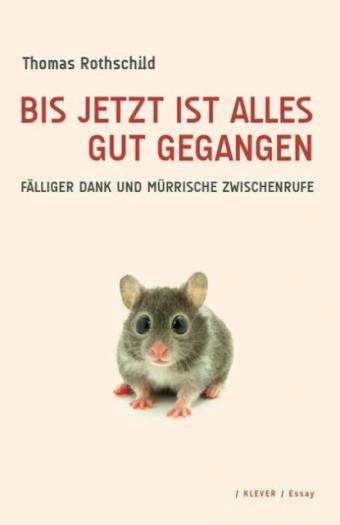Gesellschaft: Friedhelm Hengsbach: Teilen, nicht töten
JOSEF BORDAT untersucht die Gerechtigkeitsvorstellung des Sozialethikers Friedhelm Hengsbach und kommt zu einem geteilten Urteil.
 Friedhelm Hengsbachs engagierter Essay ›Teilen, nicht töten‹ entfaltet auf der Basis der Katholischen Soziallehre – mit Papst Franziskus im Rücken – eine Sozialethik, die Ungleichheit überwinden und Gerechtigkeit herbeiführen will. Der programmatische Titel ist plakativ, aber nicht unplausibel: die Alternative zum Teilen der Güter besteht tatsächlich nur in ihrer Verteidigung – innerhalb unserer Gesellschaft, in der Besitzstandswahrung die Chance auf Beteiligung »tötet«, aber auch global. Spätestens hier bedeutet das auch eine Verteidigung mit Waffengewalt, unter Inkaufnahme von Todesopfern.
Friedhelm Hengsbachs engagierter Essay ›Teilen, nicht töten‹ entfaltet auf der Basis der Katholischen Soziallehre – mit Papst Franziskus im Rücken – eine Sozialethik, die Ungleichheit überwinden und Gerechtigkeit herbeiführen will. Der programmatische Titel ist plakativ, aber nicht unplausibel: die Alternative zum Teilen der Güter besteht tatsächlich nur in ihrer Verteidigung – innerhalb unserer Gesellschaft, in der Besitzstandswahrung die Chance auf Beteiligung »tötet«, aber auch global. Spätestens hier bedeutet das auch eine Verteidigung mit Waffengewalt, unter Inkaufnahme von Todesopfern.
Gerechtigkeit als Gleichheit?
Tiefschürfend ist Hengsbachs Gedanke einer prozessualen Gerechtigkeit in der Leistungserstellung, also in der Produktion, bei der Projektierung, am Arbeitsplatz: nicht erst gerecht verteilen, sondern bereits gerecht herstellen, wozu auch zählt, gerecht zu entlohnen. Fragwürdig hingegen sein egalitaristischer Ansatz (mit dem Ziel, einen »egalitären Kapitalismus« zu schaffen) und seine Fundamentalkritik des Leistungsprinzips und der Preisbildung an der Nachfrage. Freilich werden ein Bundesligaspieler und eine Verkäuferin bei gleichem Arbeitsumfang ungleich bezahlt. Aber ist das schon »ungerecht«?
Gerechtigkeit ist etwas anderes als Gleichheit, soweit damit Resultate, nicht nur Bedingungen gemeint sind. Der Verfasser bringt aber beides sehr nah zusammen, so dass der Eindruck entsteht, er betrachte nahezu jeden Unterschied in unserer Gesellschaft als ungerecht, auch, wenn er sich aus freien Wahlentscheidungen ergibt (etwa aus der Entscheidung für einen bestimmten Beruf mit angenehmem Aufgabenprofil, aber unterdurchschnittlichem Einkommen).
Reicher Norden, armer Süden?
Fraglich ist außerdem, ob Hengsbachs stereotype Sicht auf die »Länder des Südens« wirklich immer noch verfängt. Unter diesen befinden sich eben nicht mehr nur arme Schlucker, sondern selbstbewusste Schwellenländer, die dabei sind, dem alten Europa wirtschaftlichen den Rang abzulaufen, man denke an die ABC-Staaten in Südamerika, an Mexiko, an die Golf-Staaten, an die neuen Giganten China und Indien, an Südostasien, aber auch an Südafrika. Hier hat sich die Globalisierung des letzten Vierteljahrhunderts nicht nur negativ ausgewirkt – bei allen nach wie vor offensichtlichen ökonomischen, ökologischen, politischen und sozialen Problemen.
Ob der Zentrum-Peripherie-Ansatz und die dependenztheoretisch fundierte Kritik globaler Ungleichheit aus den 1950er bzw. 1960er Jahren hier aber immer noch zielführend ist, darf zumindest bezweifelt werden, angesichts der neuen Ungleichzeitigkeiten, die es mittlerweile in den früheren Entwicklungsländern gibt, wo neben Elendsvierteln moderne Einkaufszentren entstehen – und Arbeitsplätze für die Nachbarn schaffen, die die Szenerie nicht als gegensätzlich, sondern als bereichernd erleben, die stolz sind auf den Glanz, den die Konsumtempel abwerfen.
Auch innerhalb Europas ist der Schwarze Peter schnell verteilt, wenn »Solidarität« verlangt wird, was konkret bedeutet: der Deutschen mit den »Ländern des Südens«. Ausgeblendet werden Ineffizienz und Produktivitätsschwäche, Rechtsunsicherheit und Korruption sowie ein aufgeblähter öffentlicher Dienst in eben jenen Ländern. Da fällt das Teilen leider schwer.
Gerechtigkeit: Prozess- oder Ergebnisorientierung?
Hier kommt es dann doch auf die Verteilungsgerechtigkeit an, die Hengsbach gegenüber den fairen Produktionsprozessen für sekundär hält. Dabei kann der Markt sicherlich nicht alles regeln, aber ohne ihn wird erst gar nichts entstehen, das verteilt werden kann. Staatliche Eingriffe sind nötig, wenn soziale und ökologische Grundfragen vom Markt nicht beantwortet werden, eine trotzige Generalskepsis dem Marktmodell gegenüber ist jedoch – schon mangels Alternative – etwas wohlfeil. Dass das System »Markt« Schwächen hat, dass es versagen kann, sollte nicht dazu führen, es als System insgesamt verwerfen zu wollen. Und das klingt bei Hengsbach zumindest an manchen Stellen durchaus an.
Insgesamt ist ›Teilen, nicht töten‹ ein wertvoller Beitrag eines Sozialethikers, der keinen Hehl aus seinem Willen macht, auf eine bessere, i. e. gerechtere Welt hinzuwirken. Es ist wichtig, dass der Papst mit seinen sozioökonomischen Forderungen und Vorschlägen der letzten beiden Jahre aus der theologischen Forschung und Praxis Rückendeckung erhält. Ob jedoch die Rezepte Friedhelm Hengsbachs ausnahmslos die richtigen sind, darf bestritten werden.
Titelangaben
Friedhelm Hengsbach: Teilen, nicht töten
Frankfurt am Main: Westend 2014
128 Seiten. 12 Euro