Film | Road to Shahriyar von Vahid Qazimirsaeid
Gedanken über das Filmfest Mannheim-Heidelberg sowie die kulturelle Unterschiede zwischen Ost und West von DIDER CALME
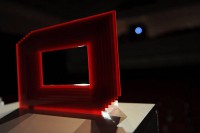 Das 1952 gegründete und zweitälteste deutsche Filmfestival Mannheim-Heidelberg, das zum 64. Mal stattfand und am 24. Oktober zu Ende gegangen ist, zeichnet sich durch eine Besonderheit aus:
Das 1952 gegründete und zweitälteste deutsche Filmfestival Mannheim-Heidelberg, das zum 64. Mal stattfand und am 24. Oktober zu Ende gegangen ist, zeichnet sich durch eine Besonderheit aus:
»Ausgeschlossen werden Filme, die auf folgenden Festivals zu sehen sind:
• Cannes (Wettbewerb, Semaine de la Critique, Quinzaine des Réalisateurs, Un Certain Regard)
• Venedig (Wettbewerb)
• Locarno (Wettbewerb)
• Berlinale
• und allen anderen deutschen Filmfestivals.«
Das bewahrt den Filmbeobachter vor dem, das ohnehin durch die Medien gehechelt wird.
Zudem dürfen in Mannheim-Heidelberg am Wettbewerb ausschließlich Regisseure teilnehmen, die allenfalls in ihrem Heimatland bekannt sind und noch nicht über ein internationales Renommée verfügen. Aus über tausend Einreichungen wählt das Festival jährlich nur 30 bis 40 Filme von neuen Autoren aus – gezeigt werden im Wettbewerbsbereich also tatsächliche internationale Erstaufführungen. Darunter befinden sich Filme, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einmal in Kinos außerhalb ihres Landes schaffen werden, ja möglicherweise nicht einmal ins spätnächtliche Filmkunstfernsehen des Auslands.
Wobei auch hier noch einmal darauf hingewiesen sein mag, wie außerordentlich doch der Unterschied zwischen einer Kinoleinwand und dem selbst größtformatigen Bildschirm ist. Zweifelsohne sind die technischen Möglichkeiten von Fernsehproduktionen enorm angestiegen, doch in dem eher überkommenen Blickwinkel des Filmbeobachters funktionieren für das Kino entwickelte bewegte Bilder nun mal völlig anders als diejenigen, bei deren Produktion bereits an den Bildschirm gedacht wird. Der Tatsache, dass in Mannheim-Heidelberg dieses Jahr zum ersten Mal auch ein Wettbewerb für Fernsehserien veranstaltet wurde, hat beim Filmbeobachter nicht unbedingt Begeisterung hervorgerufen; er will es jedoch hier nicht weiter thematisieren, es benötigte gesonderten Raum.
 Bei ›Road to Shahriyar‹, im Original ›Jade Shahriyar‹, dem Erstling des 1975 geborenen Iraners Vahid Qazimirsaeid, handelt es sich um eine dieser bemerkenswerten für die Leinwand bestimmten Raritäten, die auf dem Fernsehbildschirm an Reiz verlieren dürften, da die dunstig-flirrende Atmosphäre einer wüstenähnlichen Landschaft nur auf der Kinoleinwand zur Wirkung kommen kann, und um so mehr ist dem Filmfestival Mannheim-Heidelberg zu danken, dass es derartiges Kino ins Programm aufnimmt.
Bei ›Road to Shahriyar‹, im Original ›Jade Shahriyar‹, dem Erstling des 1975 geborenen Iraners Vahid Qazimirsaeid, handelt es sich um eine dieser bemerkenswerten für die Leinwand bestimmten Raritäten, die auf dem Fernsehbildschirm an Reiz verlieren dürften, da die dunstig-flirrende Atmosphäre einer wüstenähnlichen Landschaft nur auf der Kinoleinwand zur Wirkung kommen kann, und um so mehr ist dem Filmfestival Mannheim-Heidelberg zu danken, dass es derartiges Kino ins Programm aufnimmt.
Bei ›Road to Shahriyar‹ handelt es sich um ein vermutlich aus dem Alltag herausfallendes Szenarium eines Landes, das sich der westlichen Welt gegenüber abgeschottet hat. Zwar dringen immer wieder mal Informationsfetzen von einem tatsächlich, zumindest in der Metropole Teheran stattfindenden regen kulturellen Treiben nach außen, doch es bleibt im Allgemeinen nicht mehr als ein Ahnen und Vermuten.
Der Iran hat sich, als 1979 der Monarch von Persien, Mohammad Reza Schah Pahlavi, 1965 vom iranischen Parlament für sein Engagement gegen den Analphabetismus mit dem Titel ›Aryamehr‹ (Sonne der Arier) ausgezeichnet, der den Klerus als eines der Haupthindernisse auf dem Weg des Irans in die Moderne bezeichnete, außer Landes gejagt und durch den aus dem Pariser Exil zurückgekehrten Ruhollah Musawi, bekannter wohl unter Ajatollah Chomeini, zu einem islamischen Gottestaat revolutioniert worden war – es ist fraglich, ob allen Zuschauern der schriftliche Einschub ›Im Namen Gottes‹ im Vorspann aufgefallen sein dürfte –, dieses Land hat sich trotz, vermutlich wirtschaftlich begründeter, leichter Öffnung derart verändert, dass dem durchschnittlichen Mitteleuropäer, selbst dem, der die Ereignisse vor dieser Revolution in Erinnerung hat, lediglich der Versuch der Annäherung zu diesem Film gelingen kann, sind doch die kulturellen Unterschiede insgesamt zu elementar.
›Road to Shahriyar‹ lässt sich also nicht aus der hiesigen kulturellen Perspektive betrachten. Dennoch geschieht es, wie ein abschließendes Gespräch des Regisseurs Vahid Qazimirsaeid mit den Zuschauern hörbar machte. So gab es unter anderem scheinbar ›feministische‹ Einwände wie die, die Hauptdarstellerin (Baharan Baniahmadi) käme »als Frau zu schlecht weg«. Und Fragen wie diejenige, ob es sich bei dem während des Films ausgiebig in Anspruch genommenen ›Smartphone‹ um eines der Marke Apple gehandelt habe, trugen beim Filmbeobachter erheblich zur Irritation bei bzw. unterstrichen die Problematik westlich geprägter Sichtweisen auf andere Kulturen; die aktuelle Debatte um Flüchtlinge zwängt sich in die offensichtliche Verwunderung darüber, daß die aus dem Süden und Osten nach Europa Drängenden über solche technischen und augenscheinlich luxuriösen Mittel verfügten …
Vahid Qazimirsaeid hat zumindest vordergründig keinen politischen Film geschaffen. Innerhalb des Gespräches wurde gar der Begriff Komödie erwähnt. Und das erwiese sich, versuchte man die Position einer heutigen iranischen Mentalität einzunehmen, als durchaus vorstellbar, hat dieses Szenarium an der Straße nach Shahriyar doch tatsächlich einen komischen Grundton. Die für iranische Verhältnisse modern wirkende, sportliche – es stellt sich tatsächlich im zweiten Drittel des Films heraus, dass es sich bei ihr um eine Basketballspielerin handelt – junge Frau vornamens Niloufar begibt sich mit dem Kleinwagen ihres Bruders sozusagen auf eine Schicksalsreise; wobei bereits der Begriff Schicksal sicherlich einer wesentlich anderen kulturellen Bedeutung zugeordnet werden muss als in den hiesigen Breiten, in denen Irrationalitäten wie diese allenfalls belächelt oder karikiert werden, weil sie bedeutungsleer geworden sind.
Niloufar befindet sich auf dem Weg nach Teheran, der iranischen Hauptstadt und wuselnden Metropole, in der eine Internet-Bekanntschaft lebt, ein Mann, den sie nach ausgiebiger Korrespondenz nun persönlich kennenlernen möchte und dem sie ihr Kommen angekündigt hat. Die junge Frau trägt zwar den vorgeschriebenen Hidschāb, jedoch nicht den den gesamten weiblichen Körper unscheinbar bis unkenntlich machenden Tschador. Dieses im Land übliche Kopftuch verbirgt bei ihr allerdings nicht das gesamte Gesicht, sondern zeigt auch ihr Haar, ist zudem von einer schmückenden Spange gehalten. Überhaupt ist sie für provinzielle iranische Verhältnisse vermutlich eher modern, zumindest farbig ansprechend gekleidet, mit Jeans und Turnschuhen unter einem leichten Kleid, diese allem Anschein nach ausgesprochen selbstbewusste junge Frau. Als Hinweis darauf mag gelten, dass Niloufar sich bereits zu Beginn des Films mit einem tumben Tankwart anlegt, der, wie offenbar landesüblich, sie betrügt, weil das Weib, da es als minderwertiger gilt, als selbst der weitaus weniger intelligente Mann, nun einmal betrogen werden kann oder zumindest darf.
Und richtig, es handelt sich um diese Filmthematik: Es geht um die Rolle der Männer. Es geschieht in einer Weise, die letztlich dann doch wieder Assoziationen zu Verhaltensweisen zulassen, die auch hierzulande bekannt sind.
Vor dem einen Mann, zu dem sie unterwegs ist, warnt sie in einem die ersten zehn Filmminuten, überhaupt während der gesamten Fahrt offenbar nicht enden wollenden Telefonat eine tratschsüchtige Freundin, die nicht unbedingt den Verdacht aufkommen lässt, sie könnte Unabhängigkeit anstreben, auch nicht die vom anderen Geschlecht. Niloufar sei verrückt, wegen dieses einen Kerls, den sie nicht einmal kenne, eine so beschwerliche Reise anzutreten, und dann noch allein, zudem behindert (oder auch wehrlos?) durch einen vergipsten Arm. Männer seien ohnehin alle gleich und nicht wert, dass man sich um sie bemühe.
Bei dem nächsten Mann nach dem betrügerisch agierenden Tankwart, dem sie begegnet, handelt es sich um einen am Rand der Autobahn stehenden, den sie nach dem Weg nach Shahriyar – übrigens ein männlicher iranischer Vorname, der ›großer König‹ bedeutet und der in den persischen Erzählungen von ›1001 Nacht‹ vorkommt – , hier allerdings vermutlich ein Vorort, eine Vorstadt von Teheran vielleicht, wo ihr Chat-Partner lebt. Der Auskunftgebende bietet ihr zwei Wegemöglichkeiten an, eine längere sowie eine kürzere, jedoch schwieriger zu findende und auch zu befahrende, sehr schlechte Straße, auf der, worauf er sie ausdrücklich hinweist, nur sehr wenige Autos, mithin Menschen unterwegs seien. Sie entscheidet sich für den scheinbar rascheren, metaphorisch vielleicht ›direkteren, geraderen‹ Weg und gerät auf eine völlig abgelegene Schotterstraße inmitten eines wüstenartigen, wenn auch von schier unendlichen, monokulturellen Maisfeldern gesäumten Gebietes, entlang einer Bahnstrecke, auf der alle paar Minuten Züge lautstark vorbeidonnern. Sichtbar guter Dinge, allenfalls ein wenig genervt von der Freundin, die sie wegen Belanglosigkeiten immer wieder anruft, fährt sie langsam ihrem Ziel entgegen. Die Fahrt endet mit einem Halt, den sie einlegen muss, da sie ein ungewohntes Geräusch wahrnimmt. Der Reifen des linken Hinterrades ist platt.
Sie möchte den Reifen wechseln, doch da sie durch den vergipsten linken Unterarm behindert ist, scheitert sie bereits beim Versuch, die Radkappenblende abzunehmen. Sie bleibt dennoch gelassen und setzt sich, dessen harrend, was auf sie zukommt, eher, was vorbeikommt. Es dauert auch nicht allzu lange, bis ein Wagen anhält, ein gut aussehender Mittdreißiger auf der Beifahrerseite aus dem Auto steigt und ihr seine Hilfe anbietet. Er fragt nach dem Ersatzreifen, gibt jedoch rasch wieder auf mit der Begründung, in dem sehr unaufgeräumten Kofferraum den Schlüssel für die Radmuttern nicht gefunden zu haben. Es handelt sich ohnehin offensichtlich um eine Finte, denn er bietet der attraktiven Niloufar bald an, sie in seinem Wagen mitzunehmen, der übrigens, wie sich am Ende dieser Szene herausstellt, von einer Frau gesteuert wird. Doch er scheint Anzüglichkeiten abgesondert zu haben, worauf Niloufar den Wagen der gehobenen Mittelklasse eines offenbar von Einheimischen bevorzugten südkoreanischen Herstellers, in dessen Fond sie bereits Platz genommen hatte, wieder verlässt und sich wieder in den von ihrem Bruder ausgeliehenen Kleinwagen aus einheimischer Produktion zurückzieht.
Die nächste Begegnung in ihrer schicksalhaften Reihung von Männern ist ein Mann um die fünfzig, der auf der Fahrerseite aus seinem Auto aussteigt, um eine Zigarette zu rauchen. Unmittelbar darauf entsteigt der Beifahrerseite eine Frau, die immer lauter werdend auf ihn einredet, bis er schimpfend über die Bahngeleise in die Steppe entweicht, ihr zuruft, er wolle sie nicht mehr sehen, möge sie sterben, und schließlich allein wegfährt. Niloufar bemüht sich rührend um die Verlassene, die im Lauf des Gesprächs allerdings ihren Ehemann in Schutz, alle Schuld auf sich nimmt und dann zu Fuß entschwindet.
Bei dem nächsten Mann auf Niloufars mit Männern gesteinigtem Schicksalspfad handelt es sich um einen Geistlichen. Dessen Hilfsbereitschaft überzeugt sie, er packt auch sofort fachmännisch an, erzählt dabei nebenher, er habe als Junge mit seinem Bruder um die Wette Reifen gewechselt, das Gespräch entwickelt sich dann allerdings thematisch hin zur Rolle der Frau in der Gesellschaft, in der sie einmal mehr keine Wertschätzung erfährt, worauf Niloufar dem Fond ihres Autos einen schwarzen Tschador entnimmt und sich den über Kopf und Körper legt. Der Mullah referiert neben der Tätigkeit des Reifenwechsels unter anderem über die Unterschiede zwischen der weißen und schwarzen Färbung dieses islamischen Bekleidungsstücks für Frauen, der der Filmbeoachter wegen mangelnder Kenntnis iranisch-schiitischer Koran-Auslegungen nicht folgen konnte, aus der er allerdings, nicht zuletzt aufgrund der Erwähnung von Hosen tragenden Frauen, schloss, wie gering der Prediger diese schätze. Niloufars Anmerkung, seinetwegen, aus Respekt vor seiner Würde habe sie den Tschador umgelegt, ihr Vater hingegen zwänge sie nicht zum Tragen dieses ausschließlich für Frauen bestimmten Überwurfs, der von nichtislamischen Aufklärerinnen der scheinbar religionsfreien westlichen Welt auch schon mal als »Häftlingskleidung« bezeichnet wird, wischt der Mullah ohne weitere Begründung weg.
Wiederum nähert sich ein Auto, dieses Mal eines mit einer Ladefläche, dessen Fahrer ebenfalls seine Hilfe anbietet, zumal er den Prediger näher zu kennen scheint. Die beiden Männer handeln die endliche Hilfe beiläufig unter sich aus, der zwar mit einem kuttenartigen Gewand, dennoch leger gekleidete Geistliche steckt dem anderen Geld zu und entfernt sich anschließend. Die nun folgende Auseinandersetzung zwischen beiden am Ort Verbliebenen endet für die Frau erneut erniedrigend, zumal sich herausstellt, dass auch der Ersatzreifen platt ist, und der Reparateur meint, das sei einmal mehr ein Beleg dafür, wie lebensunfähig Frauen seien: Nicht nur allein im Auto, vor allem ohne Mann losfahren, und dann noch nicht einmal ein intaktes Reserverad mit sich führen. So entfernt sich auch dieser Mann vom Schicksalspfad der jungen Schönen.
Zwischendrin hatte sie es auf Empfehlung der Freundin mit einem Pannendienst versucht. Den erreichte sie zwar telefonisch, doch am anderen Ende dieser langen Leitung bedeutete man ihr, der Besitzer des Automobils habe anwesend zu sein, ihr könne man nicht helfen. Es scheint offensichtlich die unabhängige Frau zu sein, der Mann nicht helfen möchte.
Immer wieder hatte sie zwischenzeitlich auch versucht, das Ziel ihrer Reise, den Chatter aus dem Internet zu erreichen, auch ihn um Hilfe gebeten. Doch der ging nie ans Telefon.
Sie nimmt schließlich nach Einsetzen der Dämmerung den Rucksack mit ihrer Habe und macht sich zu Fuß auf, ohne zu wissen, wohin dieser staubige und steinige Schicksalspfad hinführt. Nach einigen Metern des Wegs hört sie ein Motorrad heranfahren. Der Pilot hält an, nimmt den Helm ab, und sie schaut in das Gesicht eines sympathischen gut aussehenden Anfangsvierzigers, zu dem sie auch sofort Vertrauen zu entwickeln scheint. Auch er bietet ihr Hilfe an. Während sie zum Auto zurückkehrt, sieht sie, wie sich ihr vorausgefahrener Helfer in dem zu schaffen macht. Wütend protestierend eilt sie hinzu, doch der Mann schlägt sie ins Gesicht, reißt ihr das Gepäck vom Leib und verschwindet.
Erneut ruft sie voller Schmerz ihren Sehnsuchts-Chatter an, klagt dem, auf dessen Anrufbeantworter, ihr Leid, schilt in gar einen Feigling, schließlich sei sie vergewaltigt worden.
Hierbei geriet der der persischen Sprache nicht mächtigen Filmbeobachter in arge Irritation; auch die untertitelnden Übersetzungen brachten keine Klärung: Vergewaltigung? Bedeutet in dieser iranisch-islamischen Kultur das reine Antun von Gewalt das Gleiche? Auch die kleine, überwiegend aus Frauen bestehende Gesprächsrunde nach Ende des Films erbrachte keine Antwort auf diese Frage; wie überhaupt einiges offenblieb.
Rätselhaft blieb auch der Schluss des Films. Die völlig erschöpfte, wegen des Faustschlags aus der Nase blutende Niloufar hatte sich auf den Fahrersitz gesetzt und war eingeschlafen, als ein Mann an die Scheibe klopft, dessen Gesicht beim Filmbeobachter die Assoziation zum Down-Syndrom hervorrief. Im Scheinwerferlicht sichtbar zündet der einen offenbar zuvor zusammengesuchten Holzstoß zu einem Lagerfeuer an, breitet behutsam zwei Teppiche aus, stellt einen für hiesige Verhältnisse seltsam altertümlich erscheinenden Kassettenrekorder auf und eine Kanne mit Tee hin, legt ein Band mit schwierig zu identifizierender Musik ein und wartet. Sie kommt, er reicht ihr eine Tasse – und schweigt. So sehr sie sich auch bemüht, ihn zum Reden zu bewegen – er schweigt. Es ist offensichtlich, dass er sie versteht. Er schweigt dennoch stoisch. Nach einiger Zeit steht er auf, wechselt das defekte linke Hinterrad, einen intakten Reifen auf Felge hat er mitgebracht, und fährt anschließend weg. Enttäuscht setzt Niloufar sich wieder ins Auto, fährt los, um ihre Reise zum Ziel fortzusetzen oder wieder zurückzukehren, das bleibt offen, als relativ kurz danach ein Signalton eine Kurzmitteilung ankündigt. Ihr ist zu entnehmen, ihrer beider Gespräche seien sehr angenehm, schön gewesen, doch der Satz endet mit »aber …«.
In der abschließenden kleinen Gesprächsrunde wurde ebenfalls darüber gerätselt, um wen es sich bei dieser Erscheinung gehandelt haben konnte. Eine der Damen führte an, es sei seitens des Regisseurs Vahid Qazimirsaeid, wenn auch zurückhaltend, aber mit einem bejahenden Nicken bestätigt worden: Es habe sich um den Chat-Partner gehandelt, dessen Gesicht während der Kurzmitteilung auf dem Display kurz gezeigt worden war, und zwar dargestellt als ein gut aussehender Mittdreißiger. Nach reiflicher Überlegung stimmt der Filmbeobachter dieser Betrachtungsweise zu, erscheint ihm dieser Schluss doch von durchaus konsequenter Logik.
Über die Beendigung der zuvor aufkeimenden Beziehung durch den Mann lassen sich allerdings nur Mutmaßungen anstellen: Hat Niloufar seine Erwartungen nicht erfüllt oder befürchtet er, die ihren nicht erfüllen zu können, sieht er allein aufgrund allzu elementarer Unterschiede in den Äußerlichkeiten beider keine Möglichkeit, zueinanderzufinden? Festzuhalten ist jedenfalls, dass es sich bei ihm um einen höchst liebevollen Menschen handelt, der sich ihr aufmerk- und sorgsam genähert hat. Deutlich bleibt: In Niloufar ist die Illusion von einer Partnerschaft wie eine Seifenblase zerplatzt. Möglicherweise wird sie keine weiteren derartigen Versuche mehr unternehmen.
 Das Bestechende ist, wie sehr sich die eigentlich kulturell absolut voneinander abweichenden Denkweisen einander annähern: da die eine, die sich in ihrer religiös bestimmten, diktatorischen Verordnung völlig abgeschottet hat gegenüber der anderen, die sich als demokratisch und von Vernunft bestimmt geriert. Doch diese Vernunft, die nach ihrer Geburt im ›Siècle des Lumières‹, dem Zeitalter der Lichter, der Aufklärung im Vorfeld der Französischen Revolution – die im übrigen in England, Portugal und Spanien ihre Anfänge nahm und die überdies weit über die Kritik an Religion und monarchischer Macht hinausging, genauer, die tief in Bereiche des Alltags hineinleuchtete, etwa in der von Denis Diderot und Jean-Baptiste le Rond d’Alembert herausgegebenen, zwischen 1751 und 1780 erschienenen ›Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers‹ (Enzyklopädie oder ein durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke), zumindest den des Lesens Fähigen alles erdenkliche Wissen (heutzutage) scheinbar belangloser Art vermittelte; aus heutiger Sicht wäre das beispielsweise die Benutzungsanleitung eines Computers oder Smartphones oder auch eine zum Reifenwechsel –, dieser Begriff Vernunft hat sich mittlerweile zu einem Sprachgebilde entwickelt, das gesellschaftskritische, philosophisch-geisteswissenschaftliche Töne, allem Anschein nach über curriculare Systeme politisch gesteuert, ausblendet und nur noch technische, naturwissenschaftliche, Effizienzen berechnende Ellen anzulegen bereit ist und in dem das Menschliche an sich immer weniger Erörterung findet.
Das Bestechende ist, wie sehr sich die eigentlich kulturell absolut voneinander abweichenden Denkweisen einander annähern: da die eine, die sich in ihrer religiös bestimmten, diktatorischen Verordnung völlig abgeschottet hat gegenüber der anderen, die sich als demokratisch und von Vernunft bestimmt geriert. Doch diese Vernunft, die nach ihrer Geburt im ›Siècle des Lumières‹, dem Zeitalter der Lichter, der Aufklärung im Vorfeld der Französischen Revolution – die im übrigen in England, Portugal und Spanien ihre Anfänge nahm und die überdies weit über die Kritik an Religion und monarchischer Macht hinausging, genauer, die tief in Bereiche des Alltags hineinleuchtete, etwa in der von Denis Diderot und Jean-Baptiste le Rond d’Alembert herausgegebenen, zwischen 1751 und 1780 erschienenen ›Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers‹ (Enzyklopädie oder ein durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke), zumindest den des Lesens Fähigen alles erdenkliche Wissen (heutzutage) scheinbar belangloser Art vermittelte; aus heutiger Sicht wäre das beispielsweise die Benutzungsanleitung eines Computers oder Smartphones oder auch eine zum Reifenwechsel –, dieser Begriff Vernunft hat sich mittlerweile zu einem Sprachgebilde entwickelt, das gesellschaftskritische, philosophisch-geisteswissenschaftliche Töne, allem Anschein nach über curriculare Systeme politisch gesteuert, ausblendet und nur noch technische, naturwissenschaftliche, Effizienzen berechnende Ellen anzulegen bereit ist und in dem das Menschliche an sich immer weniger Erörterung findet.
Im Iran finden sich aus religiös-ideologischen Gründen kaum Möglichkeiten, schon gar nicht für Frauen, selbstständig einen Partner zu finden. In konsumistisch-kapitalistisch orientierten – in christlichen Ländern ist mit dem Begriff ›Orientierung‹ häufig auch die Suche nach Gott gemeint; ›ex oriente lux‹: Aus dem Osten kommt das Licht – ist man aus Gründen zunehmend mangelnder Freizeit dazu übergegangen, das Internet, überwiegend via Smartphone, als Partnerschaftsbörse zu nutzen. Und so, wie sich in unseren ideologischen Breiten kaum mehr jemand um die sogenannte Privatsphäre schert, also nahezu jeder Mann und jede Frau seine Daten preisgibt, scheint es offensichtlich, wie sinnvoll es für etwa den iranischen Staat sein dürfte, diese Preisgabe zu fördern. Die zunehmende, immer rigider werdende Forderung des sogenannten sozialen Netzwerkes Facebook, ein verschiedene, vor allem aber die US-amerikanischen Geheimdienste belieferndes privates Aktienunternehmen, nach ›Echtnamen‹ drängt sich dabei auf. Hier dürfte sich auch dem Mullah-Staat ein ergiebiges Feld für das Einsammeln aller erdenklicher Daten aufgetan haben. Es ist davon auszugehen, dass dies mit ein Grund dafür sein dürfte, dass diese Kommunikationstechnik quasi nachhaltig gefördert wird. So lassen sich auch die Wege der Frauen ohne Weiteres kontrollieren; die verheirateten haben nach iranisch-islamischen Werten ohnehin zu Hause beim Ehemann zu bleiben und die Öffentlichkeit, vor allem aber fremde Männer zu meiden.
In einer Metropole wie Teheran verhält sich das nach Kenntnis des Filmbeobachters anders, dort lässt man die jüngeren Menschen gleich welchen Alters im wesentlichen gewähren, solange sie die Ideologie nicht gefährden, in der Provinz hingegen, wo die Überwachung den Sittenwächtern ohnehin leichter fällt, dürfte die Freiheit weit weniger grenzenlos sein. Also nimmt eine junge Frau wie Niloufar den Weg moderner Technik, wenn sie dabei auch auf einen recht holprigen Pfad der Erkenntnis gerät, den nämlich, dass die Sehnsucht nach Liebe immer auf einem Weg zu einem Nichtort namens Utopia lag und liegen wird.
Zudem darf nicht unbedingt als gesichert gelten, dass in Gegenden sogenannt religionsfreier, vernunftorientierter Gesellschaften die Rollen der Männer sich so erheblich von denen unterscheiden, die Vahid Qazimirsaeid in ›Road to Shahriyar‹, in dessen Weg ins iranische (N)Irgendwo schildert. Und dabei denkt der Filmbeobachter nicht unbedingt an die vielen jungen Männer, die zurzeit in Mitteleuropa ankommen. Man lausche mal den Gesprächen an einem deutschen, französischen, niederländischen oder sonst wo gelegenen Stammtisch; er muß sich keineswegs in einem Dorf befinden. Während des Zuhörens kann sich im Kopfkino durchaus ein Film davon herausbilden, wie es auf der Straße nach ›Shahriyar‹ zugehen mag.
Titelangaben
Jade Shahriyar
Regie/Buch: Vahid Qazimirsaeid
Musik: Music Mohamad Jafari
Darsteller: Baharan Baniahmadi, Farzin Mohades, Sohibanoo Zolghadr, Rahim Shahmoradkhani, Farid Ghoubadi
75 Minuten











[…] Diese hier leicht veränderte Filmbesprechung erschien zuerst im Oktober 2015 in Titel-Kulturmagazin: https://titel-kulturmagazin.net/2015/10/29/auf-dem-recht-holprigen-pfad-der-erkenntnis/#more-15590 […]