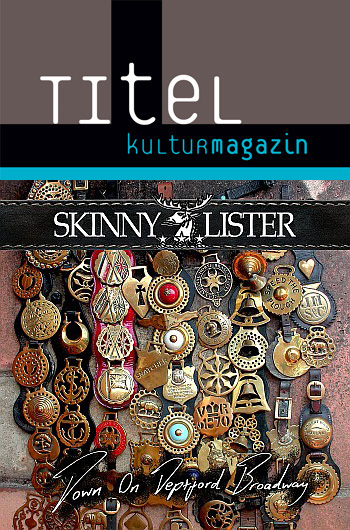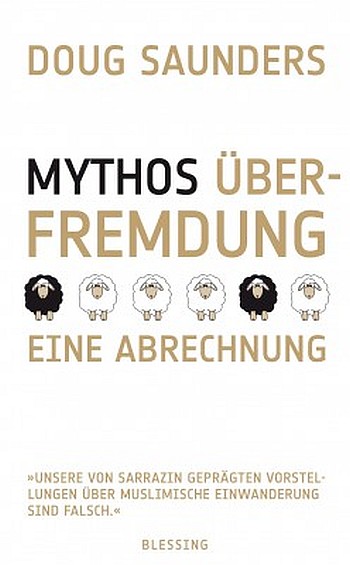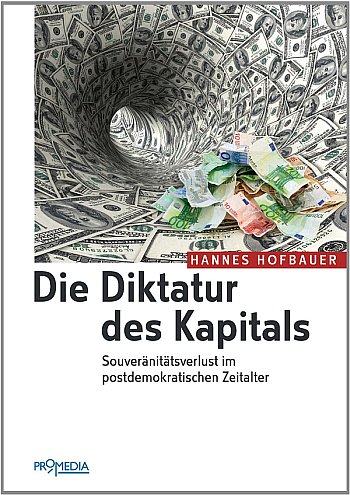Gesellschaft | Wolfgang Streeck: Aufsätze und Interviews, 2011-15
Wolfgang Streeck ist ein renommierter Soziologie, bis Oktober vergangenen Jahres leitete er das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Ende der neunziger Jahre war er an der Vorbereitung der Schröderschen Agenda 2010 beteiligt, er wirkte aktiv an der Politik sozialer Kürzungen mit. Von WOLF SENFF

Auflösung des Lagerdenkens?
Die ›New Left Review‹, London, erscheint seit 1960 im zweimonatlichen Rhythmus, sie ist führendes internationales Forum der marxistischen Intellektuellen, seit 2008 stehen die globale ökonomische Krise und ihre Auswirkungen im Mittelpunkt der Artikel. Der ›Merkur‹ nennt sich »deutsche Zeitschrift für europäisches Denken«, der ›Deutschlandfunk‹ ist konservativer öffentlich-rechtlicher Rundfunk, politisch seriös auftretender ›Mainstream‹.
Wolfgang Streecks Essay »The Crises of Democratic Capitalism« von 2011 wurde von Christopher Caldwell in der ›Financial Times‹ gelobt als »the most powerful description of what has gone wrong in western societies«, und für die ›Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung‹ vom 26. Oktober 2014 ist Streeck »ein vernünftiger Linker«. Zwar fragt man sich, nach welchen Maßstäben das Leib- und Magenblatt der deutschen Konservativen die politische Linke sortiert, aber das ist wohl letztlich eine überholte Fragestellung und stattdessen eher ein weiterer Beleg für die Auflösung politischen Lagerdenkens.
Diverse Publikationen
Streeck publizierte wenig später den oben erwähnten Beitrag »How will Capitalism end?«, er schrieb Beiträge auch für ›Lettre International‹. In seiner Publikation »Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus«, Berlin 2013, beschäftigt ihn der drohende Verlust der demokratischen Institutionen als Konsequenz aus der Wirtschafts- und Finanzkrise.
Im Januar 2015 erschien unter dem Titel »Das kann nicht gutgehen mit dem Kapitalismus« ein Streeck-Interview in der ›Wirtschaftswoche‹, und am vergangenen Sonntag sendete der Deutschlandfunk das bereits erwähnte Gespräch zwischen Wolfgang Streeck und Mathias Greffrath.
»Wohlstandsgesellschaft« bis Mitte der 70er
Diese Publikationen über das gesamte politische Spektrum hin ist ungewöhnlich. Streeck im Mainstream? Der Mainstream bei Streeck? Das wäre vermutlich recht hysterisch gefragt, und die Antwort führt niemanden weiter. Vielversprechender wäre, zu fragen, ob sich allen Alternativlos!-Alternativlos!-Kommandos zum Trotz womöglich doch etwas ändert hierzulande. Kümmern wir uns also um die Inhalte, die Streeck vertritt, und zwar in »How will Capitalism end?« in der ›New Left Review‹ vom Mai vergangenen Jahres, das dürfte der aktuellste Text sein. Ähnlich das erwähnte DLF-Gespräch »Alles kommt einmal zum Ende«.
Im Rückblick auf das vergangene Jahrhundert sieht Wolfgang Streeck die drei Jahrzehnte nach 1945 als paradigmatisch für eine gelungene kapitalistische Gesellschaft, erstmals mit einer gewissen sozialen Stabilität, jedoch als eine absolute Ausnahme in der rund zweihundertjährigen Geschichte des Kapitalismus. Seit Mitte der siebziger Jahre erleben wir, dass der liberale Kapitalismus sich erneut global durchsetze, und zwar als eine Reaktion auf den realen Rückgang der Gewinne. »Die Raubtiere entdecken, dass sie keine Milchkühe sind.«
Musik in Washington, New York
Generell sieht Streeck einen zentralen Konflikt zwischen nationalen demokratischen Strukturen und dem Kampf um die Ausweitung des »Marktes«, die als Globalisierung auftritt. Es ist jener Verteilungskampf, der von anderen Autoren als »Klassenkampf von oben« bezeichnet wird. Wachstumsschwäche, Ungleichheit, Verschuldung sind laut Streeck seit Mitte der siebziger Jahre wesentliche Tendenzen der kapitalistischen Welt: »the crash of 2008 was only the latest in a long sequence of political and eoconomic disorders that began with the end of postwar prosperity in the mid-1970s« (New Left Review).
Wesentlich sei zu wissen, dass die Musik in Washington und New York gespielt werde, und »dass der Verfall der amerikanischen Politik in der Ära Carter, Reagan, also nach Nixon, und heute sozusagen die komplette Stagnation der amerikanischen Innenpolitik, dass das eigentlich sozusagen das zentrale Problem dieses kapitalistischen Weltsystems ist« (DLF-Gespräch 12. April).
Eine Möglichkeit, all diesen Tendenzen zum Trotz doch wieder Vertrauen in politisches Handeln aufzubauen, sieht er in der Stärkung nationaler staatlicher Strukturen und hofft hier vor allem auf Europa. Das sind keine besonders neuen Positionen. In diesem Fall ist jedoch bemerkenswert, dass sie auch in Medien des gehobenen nationalen Mainstream vertreten werden.
Titelangaben
Wolfgang Streeck: The Crises of Democratic Capitalism
in: New Left Review 71, September-October 2011
ders., Wissen als Macht, Macht als Wissen. Kapitalversteher im Krisenkapitalismus
in: Merkur 9/10, September 2012
ders., How will Capitalism End?
in: New Left Review 87, May-June 2014
ders., »Das kann nicht gutgehen mit dem Kapitalismus«
Interview in der ›Wirtschaftswoche‹ vom 8. Januar 2015
ders., »Alles kommt einmal zum Ende«
Gespräch mit Mathias Greffrath, DLF, 12. April 2015, 9:30 Uhr