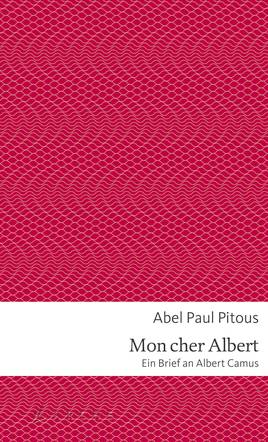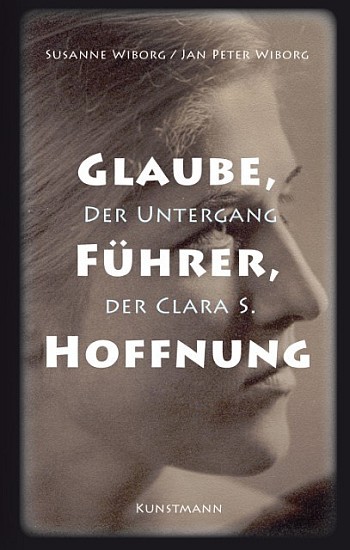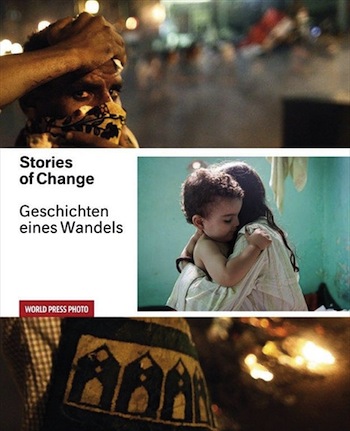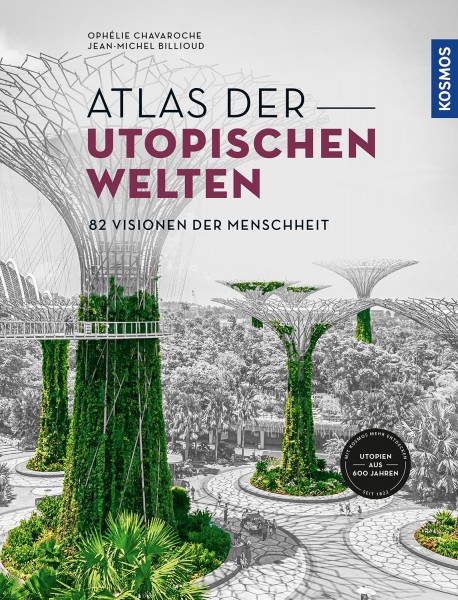Gesellschaft | Engelhardt: Völlig utopisch / Harvey u. Robinson: Einfach die Welt verändern
Dass ein anderes Leben möglich ist, ahnte sie irgendwie – wie das konkret aussehen könnte, erfuhr SUSAN GAMPER in der Aufsatzsammlung der Weltreporter: ›Völlig utopisch‹.
 Der »Wunsch, die Geschichten hinter den Nachrichten zu erzählen« treibt die Autoren des Netzwerks an: weltreporter.net verbindet freie Korrespondenten für deutschsprachige Medien aus mehr als 160 Ländern. 17 von ihnen haben Beiträge geliefert, die Geschichten aus 17 verschiedenen Ländern erzählen. Es sind Geschichten von Menschen, die ein anderes, besseres Leben wagen – weil sie mutig sind, weil sie optimistisch sind, weil sie nicht anders können.
Der »Wunsch, die Geschichten hinter den Nachrichten zu erzählen« treibt die Autoren des Netzwerks an: weltreporter.net verbindet freie Korrespondenten für deutschsprachige Medien aus mehr als 160 Ländern. 17 von ihnen haben Beiträge geliefert, die Geschichten aus 17 verschiedenen Ländern erzählen. Es sind Geschichten von Menschen, die ein anderes, besseres Leben wagen – weil sie mutig sind, weil sie optimistisch sind, weil sie nicht anders können.
Im Vorwort steuert der Kosmopolit Ilija Trojanow seinen Ärger über das »Mantra der herrschenden Verhältnisse« bei, und seine Freude über die »eigenwilligen Vorbilder alternativen Lebens«, die das Buch versammelt. Er kündigt Menschen an, die »nicht in die Knie gegangen sind«, die widerständig sind und Reichtum nicht über Arbeit, Geld und Erfolg definieren.
Chinas einzige Waldorfschule
Zwei dieser Menschen sind Robert Long und Catherine Steward, die in Neuseeland abgeschieden leben. Richtig abgeschieden. Robert, aus bürgerlichem Hause, wand sich als junger Mann von der Gesellschaft ab. Er wollte allein sein, mit der Natur, allein mit sich selbst. Er schlief im Wald, ernährte sich von Nüssen, sah wochenlang keinen anderen Menschen. Als er Catherine traf, wurde es anders: Eine Hütte bauten die beiden aus dem, was der Fluss anspülte. Sie begannen, Gemüse anzubauen, Felle zu verarbeiten, sich ein gemeinsames Leben einzurichten. Die beiden haben zwei Kinder – Robert, der Idealist, der Eremit, musste weitere Zugeständnisse machen: »den Kinderpo in einer zugefrorenen Pfütze zu säubern« ging seiner Frau zu weit. Ihre Tochter ist heute Führerin in einem Vogelpark, der Sohn Outdoor-Experte – die Nabelschnur zu beiden ist das Internet. Robert und Catherine werden in der Wildnis alt werden. Glück sei, »das zu wollen, was man hat«.
In »Völlig utopisch« lernen wir auch Huang Mingyu kennen, der im Norden von Peking Chinas einzige Waldorfschule gründete. Aus Indonesien erreicht uns der Bericht über Gunretno, der mit seiner Gemeinschaft der »Sedulur Sikep« radikal Autarkie fordert – und sich unnachgiebig für Freiheit, Gleichheit und Umweltschutz einsetzt. Wie schön ist es, von Viv und Bou zu lesen, einem deutsch-holländischen Paar, das seit vielen Jahren biodynamische Landwirtschaft betreibt und lehrt – in Serbien. Wir lernen auch Yael und Shuki kennen, die mit »einer Mischung aus Naivität, Kühnheit und Sturheit« in Israel einen Kibbuz gegründet haben, in dem 155 Menschen mit besonderen Bedürfnissen selbstbestimmt leben und arbeiten.
Weniger u- denn dystopisch
Das Schöne an diesem Buch ist dann auch die Nähe zu den Menschen, über die uns die Reporter berichten. Jeder einzelne Beitrag ist ein Schritt auf jemanden zu, in jemandes Leben – ein anderes Leben, manchmal ein besseres. Wir erfahren aber auch, was es kostet, ein Ideal zu verfolgen. Dass Viv und Bou auf ihrem Hof von früh bis spät schuften, dass Yael und Shuki für ihren Kibbuz in Konfrontation mit der Regierung gehen mussten, dass Huang Mingyus Schule nur gerade eben geduldet wird, eigentlich rechtswidrig ist. Diese Kosten erhöhen natürlich auch den Wert des Erreichten – für die Menschen, deren Geschichten erzählt werden ebenso wie für die Leser, die von diesen Geschichten beeindruckt sind.
Mir fehlt beim Buchtitel das Fragezeichen: Sind’s wirklich immer utopische, paradiesische Zustände, von denen da berichtet wird? Auch der Untertitel »17 Beispiele einer besseren Welt« ist irreführend. Sind’s nicht eher Beispiele einer »anderen« Welt?
Weniger u- denn dystopisch erscheint zum Beispiel der Bericht über Slab City, eine Wohnwagensiedlung in Kalifornien. Selbst der Reporterin war offensichtlich nicht ganz wohl bei der Sache. Einige Bewohner hießen sie zwar willkommen, andere schienen weniger wohlgesonnen. Schließlich scheinen nicht einmal die Siedler restlos überzeugt von ihren Lebensumständen: Schotterwege, Sperrmüll, Plumpsklo, Schrotflinten: »Anarchie bei 45 Grad im Schatten«. Die Lektüre des Berichts ruft schließlich eher Schaudern hervor, als den Wunsch in Slab City mitzutun.
Und insgesamt? Das Buch mit dem optimierten Titel »Völlig utopisch? 17 Beispiele einer anderen Welt« hat mich zum Nachdenken angeregt. Ich bin beeindruckt von der Willenskraft der Widerständigen. Ihre Motive haben mich interessiert, ihr Mut hat mich berührt. Irritiert bin ich vom Fatalismus mancher, abgestoßen vom postapokalyptischen Lebensstil anderer.
Vor einigen Jahren erschien die erste Auflage eines Büchleins mit dem Titel ›Einfach die Welt verändern‹. Es soll hier denjenigen angedient werden, die mit dem Welt-Retten zunächst im Nahraum beginnen möchten. Nigelnagelneue Erkenntnisse werden nicht präsentiert, welt-bewegende dennoch – es wird ausformuliert (und bebildert) worauf man mit wachem Blick und Geist eh schon kommt: Dass es besser wäre, beim Zähneputzen nicht das Wasser laufen zu lassen. Dass Blutspende eine gute Sache ist. Dass es schön wäre, mal wieder mit jemandem aus einer anderen Generation zu sprechen. Hübsch aufbereitete Aufforderung und Mahnung ist das Buch der britischen Initiative WeAreWhatWeDo. Es ist konkret, einfach und sinnvoll. Überdies ergibt es ein feines optimistisches Geschenk für (angehende) Gutmenschen.
Titelangaben
Marc Engelhardt (Hg.): Völlig utopisch. 17 Beispiele einer besseren Welt
München: Pantheon 2014
271 Seiten. 14,99 Euro
Eugenie Harvey, David Robinson: Einfach die Welt verändern. 50 kleine Ideen mit großer Wirkung
München: Piper 2012
112 Seiten. 9,99 Euro
Reinschauen
Seite zum Buch im Utopiesalon
Unruhe in Europas Hinterhof – Peter Blastenbrei zu Marc Engelhardt: Heiliger Krieg – heiliger Profit