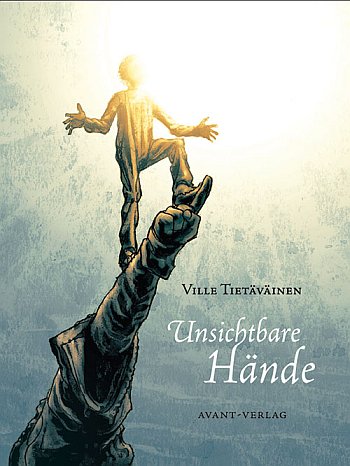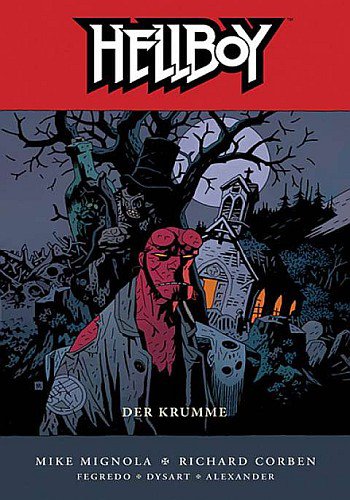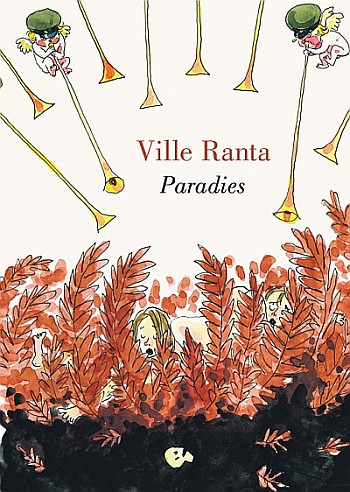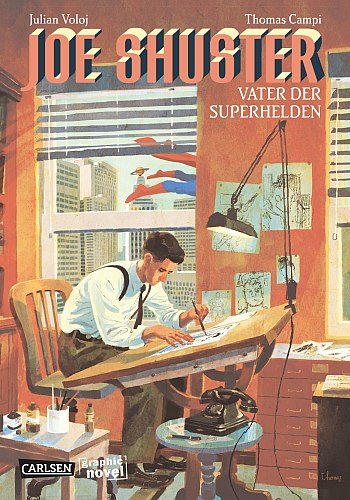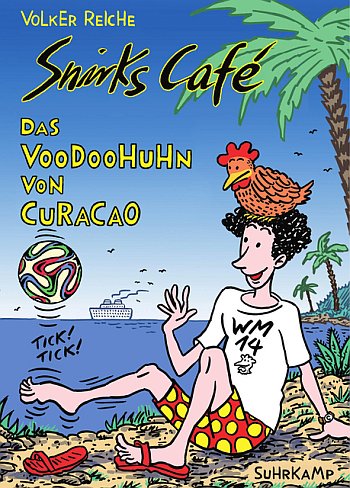Comic | ICSE 2016 Spezial: Interview mit Asaf Hanuka
Der Cartoonist Asaf Hanuka ist einer der wenigen Comic-Zeichner aus Israel, die auch in Europa bekannt sind, etwa durch Werke wie ›Der Realist‹ oder ›The Divine‹. Dieses Jahr war der Künstler auch auf dem Internationalen Comic Salon in Erlangen zugegen. PHILIP J. DINGELDEY hat sich dort mit Hanuka getroffen und über seine Cartoons, seinen Stil, seine Farbgebung und den politischen Gehalt seiner autobiographischen Geschichten unterhalten.

Abb: Darthradar
Asaf Hanuka: Der Titel kam eher zufällig zustande, denn die Zeitung, in der die Cartoons publiziert wurden, ist eine hebräische Zeitung mit dem Titel ›Economist‹. Also wollten sie einen Titel, das auch auf ›…ist‹ endet. Wir dachten an ›Der Realist‹. Und ich denke, mein Zeichenstil ist ein realistischer, während israelische Zeichnungen sonst eher typische und freie Cartoonzeichnungen sind, aber ich habe in Frankreich studiert. Das hat mich beeinflusst, realistischer zu zeichnen. Natürlich ist es nicht wirklich realistisch, ja. Aber ich mag den Titel, auch wenn ich ihn nicht ausgewählt habe. Das Buch heißt auch in Deutschland und den Vereinigten Staaten so.
Der Anfangspunkt jedes dieser Cartoons ist aber meine Realität. Dabei zeige ich ein Problem oder eine Herausforderung, und die Lösung ist dann surrealistisch oder fantastisch, etwa Superhelden oder Superkräfte. Das ist normal in der Popkultur. Aber ich starte mit meinem echten Leben, einem echten Problem, das mich hemmt oder beschäftigt. Mit etwas, das gelöst werden muss. Wenn ich es in Comics lege, weiß ich, dass ich maximal neun Bilder habe, um es zu lösen, und dabei wird es dann fantasievoll. Denn ich halte es für meine Pflicht, interessante Geschichten zu erzählen, indem ich die Geschichte ändere, denn es ist keine Dokumentation meines Lebens, sondern ich will etwas ausdrücken und dies visuell übertragen. Also lüge ich in gewisser Weise, aber wenn diese Lüge eine überzeugende Geschichte bietet, dann habe ich meinen Job gemacht.
Sie sagen, Ihr Zeichenstil unterscheidet sich von dem anderer israelischer Zeichner. Was ist der Unterschied zwischen diesen Stilrichtungen und Techniken?
Wenn jedes Land einen eigenen Zeichenstil hat – in Deutschland ist er etwa oft expressionistisch, auch der amerikanische Mainstream hat einen bestimmten Stil, und die Franzosen, Holländer und Belgier haben einen besonderen Stil -, was ist dann eigentlich der israelische Stil? Ich glaube, der israelische Stil ist es schlicht und ergreifend, schlecht zu zeichnen. Es gab dort keine Kultur des Bilderschaffens. Alles drehte sich darum, Texte zu lesen und zu schreiben, und Text ist heilig und abstrakt im Judentum, denn Gott ist im Text. Bilder sind also wirklich gegen diese Religion. Im Gegensatz dazu wurden im Christentum Bilder genutzt, um Gott zu sehen und in Kirchen biblische Geschichten bildhaft darzulegen. In der jüdischen Kultur und Tradition kann man das nicht tun. Die Künstler wussten daher nichts über Perspektiven oder Anatomie, also die ganz grundlegenden Dinge des Zeichnens.
Ich unterrichte aber auch Zeichnen, und die neue Generation des Internetzeitalters kann besser zeichnen, denn das Internet unterminiert in gewisser Weise räumliche Grenzen und macht mehr Bilder und Techniken zugänglich, was großartig ist. Und ich habe mir den Stil der Franzosen als Vorbild genommen, der auch realistische Details, wie die Falten von T-Shirts betont, sodass die Illustration wie ein Foto aussieht. Aber ich werde nie so malen können – und habe versucht, meinen eigenen Stil in Israel zu entwickeln. Das mache ich jetzt seit 20 Jahren und erkenne langsam, dass das Wichtigste für mich eigentlich die Idee ist, die sich in der Zeichnung entwickelt. Die Zeichnung selbst ist im Vergleich dazu nicht so wichtig.
Warum sind Ihre Cartoons autobiographisch und dabei oft so pessimistisch?
Die Leute fragen mich oft, warum ich so depressiv bin. Sie sind pessimistisch, weil ich meinen Fokus auf ein Problem lege. Wenn ich glücklich bin und einen guten Tag hatte, gibt es nichts, worüber ich schreiben könnte. Aber ich schreibe und zeichne, weil mein Leben hart ist. Das Subjekt ist das Problem, das Problem ist die Idee und das Konzept, das am einfachsten eine dramatische Geschichte erzeugt, denn Dramen sind von Konflikten beherrscht. Da stehen sich Probleme gegenüber. Etwa wäre ich gerne dünn, aber werde fetter. Das ist die dramatische Struktur. Darum nutze ich die Fantasie in der Realität. Auch das sind zwei Extreme, die mir mit dem Konflikt helfen können.
Im ›Realist‹ sagen Sie, Sie hätten keine politische Agenda. Nun schreiben und zeichnen Sie aber darin über ihren Alltag in Tel Aviv, was eigentlich sehr politisch zu sein scheint. Glauben Sie, dass ›Der Realist‹ politische Kunst ist?
 In Israel kann man nicht unpolitisch sein! In Israel gibt es viel größere Probleme als mein Leben, aber ich bin Teil des Problems, ob ich will oder nicht. Ich glaube, die politische Seite übt Herrschaft über mich aus. Aber ich versuche, die Geschichten über meine Familie als eine Metapher für größere Probleme zu nutzen, denn ich glaube, in Familienbeziehungen geht es um Macht. Etwa ich bin stärker und verantwortlich für meine Kinder. Ich kann sie zwingen etwas zu tun, und ich muss es zu ihrem eigenen Wohl auch tun. Diese Machtbeziehung existiert auch in der Politik. Ich versuche also Parallelen zu ziehen, quasi über die israelische Politik zu reden, ohne politisch zu sein. Denn wenn ich eine Geschichte kreieren würde, über den Krieg oder über Benjamin Netanjahu, dann würde ich als politischer Cartoonist betrachtet werden und keiner würde mir mehr zuhören. Viele würden sagen »Oh, er ist ein Linker, der Netanjahu kritisiert. Das interessiert mich nicht«. Aber wenn ich ihnen eine Geschichte über eine Familie gebe, hören sie zu und werden es bis zum Ende lesen, weil dort ein Witz oder eine Idee vorkommt. Und ich möchte, dass die Leser die politische Botschaft verstehen, wenn sie die Geschichte beendet haben, und es schon zu spät ist, weil die Botschaft dann schon in ihren Köpfen ist. Das ist ein humanistischer Anspruch, und es ist ein Trick, der die Leute ansprechen soll.
In Israel kann man nicht unpolitisch sein! In Israel gibt es viel größere Probleme als mein Leben, aber ich bin Teil des Problems, ob ich will oder nicht. Ich glaube, die politische Seite übt Herrschaft über mich aus. Aber ich versuche, die Geschichten über meine Familie als eine Metapher für größere Probleme zu nutzen, denn ich glaube, in Familienbeziehungen geht es um Macht. Etwa ich bin stärker und verantwortlich für meine Kinder. Ich kann sie zwingen etwas zu tun, und ich muss es zu ihrem eigenen Wohl auch tun. Diese Machtbeziehung existiert auch in der Politik. Ich versuche also Parallelen zu ziehen, quasi über die israelische Politik zu reden, ohne politisch zu sein. Denn wenn ich eine Geschichte kreieren würde, über den Krieg oder über Benjamin Netanjahu, dann würde ich als politischer Cartoonist betrachtet werden und keiner würde mir mehr zuhören. Viele würden sagen »Oh, er ist ein Linker, der Netanjahu kritisiert. Das interessiert mich nicht«. Aber wenn ich ihnen eine Geschichte über eine Familie gebe, hören sie zu und werden es bis zum Ende lesen, weil dort ein Witz oder eine Idee vorkommt. Und ich möchte, dass die Leser die politische Botschaft verstehen, wenn sie die Geschichte beendet haben, und es schon zu spät ist, weil die Botschaft dann schon in ihren Köpfen ist. Das ist ein humanistischer Anspruch, und es ist ein Trick, der die Leute ansprechen soll.
Ich will aber kein Teil der Diskussion sein. Ich will über normale Menschen erzählen, und wenn es dann eine Schlussfolgerung gibt, die auch zu anderen Bereichen führt, dann glaube ich, ich habe ich meinen Job gemacht. Ich versuche nicht das Subjekt zu sein, was seltsam klingt, da die Geschichten doch autobiographisch sind. Aber ich glaube, mein Leben ist durchschnittlich, und darum können die Geschichten nicht damit enden. Es muss etwas Größeres werden. Wenn das gelingt, dann ist die Kunst mehr als der Autor oder der Protagonist. Die Geschichte ist eine geschlossene Einheit mit einer Metapher, einem Subtext und einer visuellen Idee, und die Charaktere sind nur ein Teil davon.
In Ihren Cartoons kommen immer wieder Superhelden als fantastische Lösung vor. Welche Rolle spielen sie?
Sie spielen eine zentrale Rolle, weil ich mit Superhelden aufgewachsen bin und ihre Geschichten gelesen habe, ich war sogar süchtig nach ihnen. Denn ich bin in einer sehr grauen Umgebung aufgewachsen, und Superhelden waren so bunt und interessant, hatten eine geheime Identität und Superkräfte. Ich mag sie als Symbole, als ein Potenzial für einen Wechsel und Wandel. Sie zeigen einem: Man kann etwas Neues werden. Und das steht diametral zur grauen Realität, denn das gibt eine Perspektive. Darum werde ich in den Cartoons oft zum Superhelden, denn davon habe ich früher immer geträumt, aber ich habe nie Superkräfte bekommen, und mit dem Alter wurde ich schwächer. Ich bin 40 Jahre alt, und viele aus meiner Generation lasen als Jugendliche Marvel-Comics und träumten davon, ein Mutant aus X-Men zu sein. Und als Teenager ändert sich auch der Körper. Ich glaube, Comics nehmen diesen Verlust von Unschuld und die Metamorphose des Erwachsenwerdens perfekt auf.
Farben scheinen für Sie sehr wichtig zu sein und in Ihren Comics eine symbolische Bedeutung zu haben. Etwa haben Kinder manchmal eine andere Hautfarbe als Erwachsene, und manchmal reden Sie über Ihre Hautfarbe, die anders ist, als die anderer Israelis, weshalb Sie sich seltsam fühlen. Wie nutzen Sie Farben?
Ich nutze Farbe sehr oft für die Haut, denn ich habe eine Frau geheiratet, deren Familie aus Russland und Polen kommt. Und meine Mutter wurde in Bagdad, im Irak geboren. Also bin ich ein arabischer Jude, und sie ist ein europäischer Jude, ich bin braun, und sie ist weiß, und unsere Kinder geraten optisch eher nach ihr. Aber was ich zu sagen versuche: In Israel hat man zwei Arten von Juden. Ich glaube, das ist in Deutschland schwer nachzuvollziehen, das ist wohl ein interner Aspekt der israelischen Gesellschaft. Ich glaube, es gibt ein großes Identitätsproblem in Israel für die arabischen Juden. Israel wurde von der zionistischen Bewegung gegründet, die von europäischen Juden stammt. Meine Familie und die arabischen Juden werden davon nicht repräsentiert. So weiß ich fast nichts über die Geschichte meiner Familie, aber alles über den Holocaust, denn was sie in der Schule unterrichten, ist die Geschichten der Juden in Europa. Aber was ist die Geschichte der arabischen Juden? Wir hatten keinen Holocaust. Wir hatten Beziehungen mit Muslimen und muslimischen Ländern, und das ist wichtig für mich. Der Dialog und Konflikt mit den Palästinensern wäre beispielsweise einfacher, wenn wir uns als eine Gesellschaft ansehen würden, die auch Araber beinhaltet.
Ich kümmere mich also nicht darum, ob die Farben und die Zeichnungen schön sind. Sie sind ein Hilfsmittel im Erzählen der Geschichte, um den Leser zu zeigen, was wichtig ist, und um eine Atmosphäre zu schaffen. Aber wenn ich alles sehr schnell mache, gehe ich nur das Grundsätzliche an, und wenn da etwas Wichtiges ist, dann koloriere ich das, damit das Auge des Lesers darauf aufmerksam wird. Oft hilft mir das, den Konflikt zu verstärken. Wenn etwa die reale Welt etwa schwarzweiß und die fantastische Welt bunt ist, generiere ich so eine Balance.
Was werden Ihre nächsten Projekte sein?
Ich habe gerade ein Projekt mit meinem Bruder abgeschlossen, eine amerikanische Version eines Mangas. Ich arbeite auch noch am ›Realist‹: Ein dritter Band wurde gerade in Frankreich veröffentlicht, und ich arbeite gerade am vierten Buch. Ich würde gerne noch eine größere Geschichte schreiben und zeichnen, aber es hängt noch viel an der Organisation und der Finanzierung. Ich würde gerne eine großen Graphic Novel schaffen, aber ich lote noch aus, wie ich es genau mache.
| Interview und Übersetzung aus dem Englischen: PHILIP J. DINGELDEY
Reinschauen
| Webseite des Autors
| ›Der Realist‹ – vorgestellt in TITEL kulturmagazin