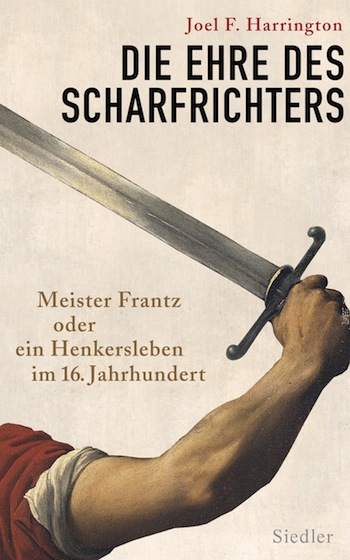Menschen | Interview mit Terézia Mora
Terézia Mora wird in diesem Jahr mit der wichtigsten literarischen Auszeichnung Deutschlands, dem Georg-Büchner-Preis, geehrt. Zu diesem Anlass veröffentlichen wir erneut das Interview, das THOMAS COMBRINK mit Terézia Mora über ihren ersten Roman ALLE TAGE und über ihre Arbeit als Übersetzerin geführt hat.
TITEL: Im traditionellen Roman werden zu Beginn fast immer mit großer Selbstverständlichkeit die Raum und Zeit Koordinaten festgelegt. Ihr Roman spielt mit diesen konventionellen Festlegungen; Sie lassen die Handlung mit den Worten beginnen: »Nennen wir die Zeit jetzt, nennen wir den Ort hier.« Ist dieser ungewöhnliche Anfang der Tatsache geschuldet, dass ALLE TAGE Ihr erster Roman ist?
 TERÉZIA MORA: Ich glaube, ich werde mir auch beim nächsten Roman dieselbe Frage stellen: Wie sind Zeit und Raum ins Erzählen zu bringen – zumal, wenn man sich für eine einigermaßen »realistische« Welt entscheidet. Denn prinzipiell könnte man ja ganz auf Plausibilität pfeifen und »unmögliche« Kapriolen durch Zeit und Raum schlagen – die Sprache kann schließlich alles.
TERÉZIA MORA: Ich glaube, ich werde mir auch beim nächsten Roman dieselbe Frage stellen: Wie sind Zeit und Raum ins Erzählen zu bringen – zumal, wenn man sich für eine einigermaßen »realistische« Welt entscheidet. Denn prinzipiell könnte man ja ganz auf Plausibilität pfeifen und »unmögliche« Kapriolen durch Zeit und Raum schlagen – die Sprache kann schließlich alles.
Grundsätzlich ist es so, dass ich vom Ende her erzähle, das heißt, dass das, worauf es hinauslaufen soll, früher feststeht, als das, womit es anfangen soll. Eine Entscheidung für das Ende zu treffen, scheint mir leichter (natürlich gibt es kein »wirkliches« Ende), vielleicht, weil man weiß, dass man davor die Möglichkeit haben wird, eine Komplexität aufzuzeigen, die das Ende erklärt. Der Anfang hingegen muss »ganz alleine dastehen«.Vielleicht hat ALLE TAGE deswegen mehrere Anfänge. Die Welt und das Erzählte sind sehr komplex, das Gebäude, das wir betreten, groß, mit vielen Eingängen, wir (in diesem Fall: der Held, die Autorin und der Leser) müssen uns permanent für eine Tür und eine Richtung entscheiden, von der wir (dieses »wir« ist jetzt nur noch der Held und der Leser) nicht wissen können, wo sie uns genau hinführen wird.
Würden Sie sagen, dass ALLE TAGE nicht nur eine Geschichte hat, sondern unendlich viele, und so das Buch unserer, oftmals fragmentarischen und zusammenhanglosen Wirklichkeit damit sehr nahe kommt?
Natürlich ist es nicht nur eine Geschichte. So was kommt generell selten vor. Es gibt keine »einfachen« Geschichten (nachdem wir nicht mehr in archaischen Zeiten leben). Selbst wenn sich eine Erzählung einfach gibt – jede (wenn sie gut ist) hat x Schichten. Ich habe mich bei ALLE TAGE dafür entschieden, mich (also: den Text) nicht einfach zu geben, sondern zu versuchen, ein Äquivalent für die hohe Kompliziertheit des Lebens in Sprache und Aufbau zu finden. Nicht zufällig hat der Roman eine Präambel, in der es heißt, wovon ich rede sind solche und solche GESCHICHTEN. Nicht zufällig verdient der Held seinen Lebensunterhalt mit der Übersetzung skurriler Storys. Nicht umsonst reden die anderen Figuren soviel und erzählen neue Geschichten. Nicht umsonst hat der Held einige Sinne, die »zu gut« funktionieren und andere, die unterdrückt sind: Beides führt dazu, dass er permanent Reizen ausgesetzt ist, immer entsteht aus seinem eigenen Zustand eine neue »Gefahr«, und wenn nicht, dann kommt, willkürlich, von außen etwas auf ihn zu. So ist die Welt, so ist unser Leben. Eine Fülle – was gut und schlecht sein kann.
(In Klammern: Es war eine positive Überraschung für mich, dass verschiedene Rezensionen sich auf verschiedene Aspekte konzentriert haben: mal war es die Sprache, mal Gott, mal die Panik. Ich befürchtete im Vorfeld, man würde sich mit dem Flüchtling begnügen, also eine vereinfachende Interpretation wählen.)
Steckt in den vielen Geschichten, die erzählt werden, auch Geschichte im Sinne von Historie drin? Mir scheint, dass das Buch sich weniger an der kollektiven Vergangenheit, sondern mehr an den Lebensläufen der einzelnen Charaktere orientiert.
Nun, es gibt ja keinen »Einzelnen«. Natürlich sind diese sich individuell gebenden Geschichten immer eine Spiegelung des größeren Zusammenhangs. Zum Beispiel: Ich schreibe über Abels (Kingas, Konstantins etc.) Alltag, und in diesem herrscht kein Bürgerkrieg. Der Krieg ist »außerhalb« – siehe im Delirium: »Sie wissen genau, was draußen ist!« –, hier finden keine Kampfhandlungen statt, es wird noch nicht einmal konkret über welche berichtet, dennoch: »dass geschehen ist, was geschehen ist« beeinflusst das Leben der Figuren im Hier und Jetzt. Beispiel: Ilias Zurückweisung. Ich bezeichne diese Szene gerne als den »falschen Verdächtigen«. Denn natürlich ist so etwas nicht schön, aber das Wesentliche ist doch, dass all das deswegen so irreversibel und daher so tragisch geworden ist, weil gleich danach Kampfhandlungen ausgebrochen sind, sodass Abel hinausgeschleudert worden ist aus seiner Welt. Und wenn man einmal den Boden unter den Füßen verloren hat, werden selbst die kleinen Dinge übergroß. Weil die Welt aus den Fugen ist, empfinden wir (das nehme ich einfach mal an), die eigentlich nichtigen, lächerlichen etc. Vorkommnisse im Leben der Figuren als existentiell. Wobei es natürlich auch um wirklich existenzielle Dinge geht: wovon sollen wir leben, wen können wir wie lieben etc. Auch dass z.B. Danko so verloren ist, wie er eben ist, ist kein individuelles Problem. Um ihn herum ist alles Gewalt – darum geht es.
Was hat es eigentlich mit diesen wunderbar wohlklingenden Eigennamen auf sich?
Das hat meist persönliche Gründe. Manchmal sind es Zitate. Abel, wegen »Abel im Dickicht« von Áron Tamási (ein Siebenbürger Autor). Oft heißen die Menschen, die mich zu den Figuren inspiriert haben, tatsächlich Kinga, Konstantin, Tatjana, Erik oder Andor. Beim Nachbarn Halldor Rose habe ich nur den Vornamen ein wenig geändert. Und die relevanten Frauenfiguren tragen alle Varianten des Namens »Maria«. Im Großen und Ganzen habe ich mich bemüht, die Namen kulturell nicht zu sehr festzulegen. Schließlich tragen die Menschen in unserer tumultuösen westlichen Welt sowieso keine traditionellen Namen mehr. (Also: lieber Melvin als Franz Josef, wie der Großvater. Ich kenne einen Zweijährigen, der Helio heißt.)
Abel trägt doch seinen Namen auch wegen der vielen Sprachen, die er kann, und der klanglichen Nähe zum biblischen Babel, oder?
Nein, das ist Zufall. Und ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es mein Lektor bemerkt hat, das war nie Thema. Komisch, aber so etwas passiert manchmal.
Die Hauptfigur von ALLE TAGE Abel Nema beherrscht also zehn Sprachen, und doch nutzt er diese Fähigkeit im Kontakt mit anderen Menschen kaum aus. Ist es nicht schwer gewesen, einen Charakter in das Zentrum eines über 400seitigen Buches zu rücken, der sprachlich nur sehr wenig von sich gibt?
»Schwer« war das ganze Unternehmen, aber ich würde nicht sagen, dass die Figur daran »Schuld« war. Da dass Leiden immer die leere Stelle in einer Geschichte ist, das, was man nicht in Worte fassen kann, war es von Anfang an klar, dass die Figur, die dieses Leiden zentral verkörpert, eine mehr oder weniger stumme sein musste. Dass sie so ist, wie sie ist, korrespondiert mit dem Thema. Es gehörte mit dazu, es dem Leser fortgesetzt schwer zu machen, auf sie »scharf zu stellen«. Um so mehr konnte ich mich dem Spaß hingeben, der in den anderen Figuren steckt, die alle miteinander eher gesprächig sind.
In diesem Zusammenhang sei auf das doppelte Spiel im Delirium-Kapitel (das Zentrum des Labyrinths, wo, wie wir wissen, das Monster und die Lösung wohnt) hingewiesen: doppelt deswegen, weil zwar hier das Ich, das sich Abel nennt, spricht, aber a) tut er es unter Drogen und b) was weiß ein Ich schon wirklich von sich. Und c) alles, was dieses Ich von sich sagt, sagt der Autor (die Autorin) über ihn, wir müssen also, wie der gute Faust, sehen, dass wir nichts wissen können.
Nun kommen Sie auf das Spiel mit den Erzählperspektiven zu sprechen. Wenn Sie sagen »was weiß ein Ich schon wirklich von sich«, so könnte doch die Freudsche Vorstellung, dass das Subjekt nicht Herr im eigenen Hause ist, Sie vielleicht dazu geführt haben, auf einen allwissenden Erzähler zu verzichten, um die Erzählstimmen ständig zu wechseln.
Das Problem des erzählenden Ichs zu lösen, war tatsächlich die Hauptaufgabe beim Schreiben von ALLE TAGE. Die Beschäftigung damit hat mich die ersten zwei von vier Jahren der Arbeit gekostet. Solange ich das nicht gelöst hatte, hatte der Roman auch keine Sprache. Sehr merkwürdige Erfahrung: es gab Inhalte, aber keine Form.
Dass man ALLE TAGE nicht als Ich-Erzählung erzählen kann, war natürlich klar. Mit dem allwissenden Erzähler habe ich auch ein Problem. Insofern, da ich ihn für längst nicht mehr angemessen erachte. Einer, der mir weißmachen will, alles zu wissen, dem vertraue ich nicht, von einem Erzähler, der verschleiern will, das hier erzählt wird, fühle ich mich für dumm verkauft. Aber: ein permanent selbstkommentierendes Erzählen ist auch nicht meine Sache. Das wiederum käme mir zu klugscheißerisch vor, außerdem schafft es eine Distanz, die ich an vielen Stellen von ALLE TAGE nicht brauchen konnte. Neben all dem war mir natürlich klar, dass es immer ein erzählendes Subjekt in einem Text gibt. Gombrowicz kann noch so oft »Nicht ich« hinschreiben, trotzdem ist jemand (er) da, der erzählt. Ich habe also hin- und herprobiert, was könnte eine »natürliche« Lösung sein und beobachtet: Wie sprechen wir eigentlich. Und es ist mir aufgefallen, dass wir, wenn wir z. B. ein Ereignis nacherzählen, permanent die Perspektive ändern. Mal sagen wir ich, dann du, dann man etc. Manchmal handelt es sich dabei um verschiedene Blickwinkel, aus denen wir das Ereignis betrachten, manchmal arbeiten wir einfach mit sprachlichen Panels. Zum Beispiel würden wir »wieso überrascht mich das nicht« eher selten in der Form »wieso überrascht sie/ihn das nicht« sagen. Oft ist es so, dass zwar nur einer redet, dennoch bringt er Sprachgebilde hervor, als wäre er mehrere, als würde er mit sich selbst Rede und Gegenrede führen. Dieses »Durcheinanderreden« schien mir als die geeignete Form, eine – jetzt kommt wieder das Wort – komplexe Welt darzustellen. Wenn es in einem Text um Desorientierung und Fragmentarität geht, ist es gut, wenn die sprachliche Form das auch widerspiegelt.
Schriftsteller äußern häufig Sätze wie: »Das kommt von der Sprache« oder »Die Sprache gibt das vor«. Sprache scheint autonom zu sein und kann wohl auch ohne einen direkten Bezug zur Wirklichkeit auskommen; Wirklichkeit befindet sich somit in der Sprache. Können Sie damit etwas anfangen? Die Frage stelle ich, weil Sie von »sprachlichen Panels« redeten.
Ja, das glaube ich auch. Dass Wirklichkeit in der Sprache ist. Etwas, das gesagt ist, ist wirklich, egal, ob es »real« ist oder nicht. Das ist faszinierend. Welt entsteht durch Formulierung.
Wahrscheinlich macht jeder, der schreibt, diese Erfahrung: dass einem etwas »herausrutscht“, von dem man gar nicht wusste, dass man’s weiß. Häufig erscheinen einem Werke klüger, als ihre Verfasser. Es kommt sogar vor, dass die Verfasser tatsächlich nicht wissen, nicht erfassen können, was sie da geschrieben haben. »Er hat ein gutes Buch geschrieben und weiß es nicht.« Sowas kommt vor. Und, auf der anderen Seite, macht man häufig die Erfahrung, dass man denkt, etwas zu wissen, aber man kann es nicht ausdrücken. (Interessante Frage: Kann man es dann tatsächlich »wissen«?) Fakt ist, dass die Sprache, da notwendig für die »Arbeit«, den Menschen zum Menschen gemacht hat und das bis heute tut. – Deswegen ist die Übersetzertätigkeit so gewinnbringend. Da man dazu gezwungen ist, Lösungen in der Zielsprache zu finden, die es bis dahin nicht gegeben hat, und auch dadurch, dass man erkennen muss, dass immer Lücken bleiben werden, dass Sprachen nicht deckungsgleich sind, dass gewisse Sachverhalte in der einen Sprache ausgedrückt werden können und in der anderen nicht. – Die letzte Konsequenz, die sich für mich in ALLE TAGE aus der Auseinandersetzung mit der Sprache ergeben hat, war jener Kauderwelsch-Vierzeiler im Delirium. Das Lied, das gesungen wird, in einer nichtexistenten Sprache. Ich hatte das Gefühl, dass es genau so sein muss, weil es nicht mehr wichtig ist, zu verstehen, was genau in dem Lied gesungen wird. Auf dem Höhepunkt des Totentanzes erklingt ein Lied in einer anonymen Sprache. Was müssen wir mehr wissen.
Haben Sie beim Schreiben Bilder im Kopf, die Sie in Sprache umsetzen, oder sind diese Bilder, Vorstellungen etc. meist schon sprachlicher Natur?
Oh, oh, jetzt wird’s richtig kompliziert. Bitte erwarten Sie nicht von mir, dass ich alles über Sprache und Denken als solches weiß. Ich habe höchstens Vermutungen – und das reicht fürs fiktionale Schreiben ja auch aus. Meine Kunstlehrerin hat behauptet, Zeichnen sei der Beginn des Denkens. Ich denke, es wird schon einen Grund dafür geben, weshalb wir nicht bis heute mit Höhlenzeichnungen kommunizieren.
Konkret ist es so, dass es mal so und mal so losgeht mit dem Schreiben. Manchmal ist es ein Bild (eine Situation), das ich dann beschreibe, manchmal ist es ein Wort (Satz), der zu einem Bild führt, und dann immer so hin und her: Bild ergibt Wort, ergibt Bild, ergibt Wort. Das sieht man, glaube ich, auch recht deutlich an ALLE TAGE. Manchmal ist das Verbindungselement zwischen zwei »Einheiten« etwas Bildliches und manchmal eben etwas Sprachliches.
Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Helmut Heißenbüttel und viele andere haben in ihrer Literatur auch sehr stark mit und über Sprache gearbeitet. Können Sie mit »solcher« Literatur etwas anfangen?
Ich liebe »solche« Literatur sehr, ich habe großes Vergnügen beim Lesen – insbesondere, weil es so selbstreflexiv ist! – und habe großen Respekt für diese Autoren. Von Arno Schmidt kenne ich nur ein paar Erzählungen. Ein guter Autor, ein Könner und ein Leider, einer, der zu sehr großem Leiden fähig ist (ja, das ist eine Fähigkeit, und das macht ihn mir sympathisch), aber keiner, der mich in meinen Grundfesten erschüttert hätte – wie z. B. erst der kluge Borges, und dann später Cortázar und noch mehr Barthelme. Und sowieso Esterházy, der sprachlich vielleicht der Begabteste ist, allerdings stehen mir die anderen Genannten in ihrer »Ernsthaftigkeit« etwas näher.
Welchen Anteil hat Ihre Übersetzung von Péter Esterházys HARMONIA CAELESTIS an der Entstehung von ALLE TAGE. Würde Ihr Buch jetzt anders ausschauen, wenn Sie den Text nicht übertragen hätten?
Sicher würde es anders aussehen, schließlich hinterlässt alles, was uns begegnet, seine Spuren in uns. Die Arbeit an HARMONIA CAELESTIS hat mir in mehrerer Hinsicht geholfen. 1. Hat sie mir Zeit verschafft. Sowohl nach innen als auch nach außen. Nach außen konnte ich mich darauf herausreden, ich würde gerade ein sehr langes Buch übersetzen und könne demnach nicht sofort (d.h. innerhalb von zwei Jahren) das nächste Buch veröffentlichen. Nach innen konnte ich während der Übersetzung in aller Ruhe über mein nächstes Buch nachdenken. Oder nicht in aller Ruhe, denn: 2., sich so intensiv mit einem Text auseinanderzusetzen, der so viel kann, bringt einen natürlich ins Grübeln. Man stellt sich grundsätzliche Fragen: Was bedeutet es mir, Schriftsteller zu sein? Was ist mein Ziel? (Antwort: Nicht irgendwelche Geschichten zu erzählen, sondern GUTE Literatur zu schreiben.) Was ist für mich gute Literatur und wie kann ich sie verwirklichen? Was sind meine Stärken, was meine Schwächen – Péter Esterházys HARMONIA CAELESTIS hat mir geholfen, mich von meinen Skrupeln zu befreien. Es hat mir gezeigt, wo die Messlatte liegt und mir zur Einsicht verholfen, dass etwas anderes, als das absolut Beste zu versuchen, nicht lohnt. Es hat mich endgültig davon überzeugt, was ich schon vorher ahnte: man muss mutig sein, man muss die eigene Kleingläubigkeit überwinden, man muss streng zu sich sein und keine billigen, halben Lösungen zulassen usw. Kurz, wer etwas erreichen will, z.B. etwas zu schaffen, dass ihm selbst nicht als überflüssig erscheint, und für das er sich am Ende nicht schämen muss, muss ebenso demütig und fleißig wie selbstbewusst: arbeiten.
Zusammengefasst: Ich habe von Péter Esterházy Arbeitsethos und Mut gelernt.
Halten Sie das Übersetzen für eine poetische Tätigkeit? Die meisten Übersetzer sind keine Schriftsteller. Ist der Schriftsteller beim Übersetzen im Vorteil?
Zumindest freuen sich die Autoren immer, wenn sie von einem anderen Autor übersetzt werden. Ja, ich denke, das hat seine Vorteile – vorausgesetzt, die beiden Autoren passen zusammen. Ich glaube, im Allgemeinen übersetzen Autoren mutiger und weniger germanistisch. Sie können nicht alles erklären, was sie wieso gemacht haben, sie verlassen sich auf ihr Sprachgefühl, ihren Instinkt. Allerdings dürfen sie sich das auch erlauben – einem »Nur-Übersetzer« würde dasselbe Lektorat für dieselben Lösungen vielleicht auf die Finger klopfen.
Und wie sind Sie zum Übersetzen gekommen?
Nach Aufforderung. 1999 war ja Ungarn Gastland bei der Frankfurter Buchmesse. Im Vorfeld fragte man quasi jeden, aber gerne junge Autoren, ob sie nicht übersetzen wollten. Ich habe einige kurze Texte für Anthologien übersetzt. Und dann kam eines Tages Péter Esterházy auf mich zu, und seitdem gibt es immer neue Anfragen. Manche mache ich, manche nicht. Das ist auch eine Zeitfrage.
Sie schreiben auch Drehbücher. Müssen Sie bei dieser Art des Schreibens (für das Fernsehen) nicht mehr Kompromisse eingehen, um einer bestimmten Adressatengruppe gerecht zu werden?
Das ist eine Legende. Ich schreibe seit 1999 keine Drehbücher mehr. Ich musste mich einfach für zwei Sachen entscheiden, und ich habe mich für Prosa und Übersetzen entschieden, ja, vielleicht auch deswegen, weil hier die Kompromisse verschwindend sind, verglichen mit dem Film, der viel mehr darunter leidet, ein industrielles Produkt zu sein. Ein Drehbuchautor ist nur solange ein Künstler und frei, bis er das Skript jemandem zum Produzieren gegeben hat – danach ist er im Grunde geliefert.
| THOMAS COMBRINK
| Foto: User:Amrei-Marie, Terézia Mora 20100304 edited, CC BY-SA 3.0
Titelangaben
Terézia Mora: Alle Tage
München: Luchterhand Literaturverlag 2004
430 Seiten, 22,50 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe