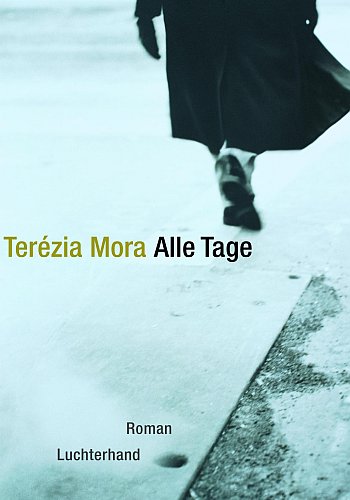Bühne | Shakespeares Richard III. im Stadttheater Pforzheim
Es ist kein Stück wie jedes andere und noch dazu sehr selbst-reflexiv – William Shakespeares (1564 – 1616) ›Richard III‹ (in dieser Fassung als Stückprojekt nach der gleichnamigen Tragödie von Shakespeare, in Deutsch von Thomas Brasch) erobert das Podium und die Zuschauer des Stadttheaters Pforzheim. JENNIFER WARZECHA war dabei.
Wenngleich »erobern« eigentlich das falsche Wort ist, denn Markus Löchner als Richard III, der Ende des 15. Jahrhunderts herrschte, bildet in Reden und Handeln sämtliche Tiefen der menschlichen Psyche ab, wie die der Egomanie, des Größenwahns, kindlicher Geltungssucht und Richards Verlangen, seine Gegner bzw. seine ganze Familie auszulöschen gemäß denen, die sich ihm in den Weg stellen und ihm damit Macht wegnehmen.

Als Gegenpart und quasi gefangen unter dem Dach agiert Clemens Ansorg in der Rolle der anderen, quasi derer, die einen Gegenpol zu Richard III bilden und die er umgebracht oder sonst wie aus dem Weg geräumt hat, zum Beispiel seinen Diener Sir James Tyrrell oder seine Frau Lady Anna. Wie Thomas Münstermann, der die Leitung, Idee und Konzeption des Stückes als Intendant innehatte, in der Nachbesprechung des Stückes berichtet, sind alle außer Richard III, der selbst unter grausamen und entwürdigenden Umständen ums Leben kam, Opfer.
Richard, dessen Leiche erst vor einigen Jahren direkt unter einem Parkplatz in Leicester gefunden und der erst Anfang 2015 beigesetzt wurde, verkörpert laut Münstermann all die Bösewichte der neueren Zeit wie den Entführer von Natascha Kampusch, den Amokläufer von Winnenden oder den Kannibalen, die sich im gegenseitigen Einverständnis selbst aufaßen, was Münstermann im Gespräch gemäß seiner Mimik, Gestik und Stimmlage sichtlich schockt. Dementsprechend war es sein Ansinnen, zusammen mit Ansorg und Chefdramaturg Peter Oppermann, über den Weg der Dekonstruktion einerseits neue Erkenntnisse aus dem Stück zu gewinnen und eine neue Ebene hineinzubringen.
Reflexion trotz der Einsicht nicht
Motive des ursprünglichen Werks lassen sich wiedererkennen, nicht aber der komplette ursprüngliche Text. Dies soll es dem Zuschauer ermöglichen, sich seine eigenen Gedanken zum Werk zu machen und seinen Horizont zu erweitern. Richard IIIs chaotische Figur entspreche, so die Intendanz, auch dem Bild des modernen Menschen, der zusehends eine zweite Identität in der virtuellen Welt suche. Der Abend werde, so Münstermann, dementsprechend zu einer »Studie fortschreitenden Wahnsinns, den gerade auch Jugendliche als Zuschauer durchaus ernst nähmen und nachvollziehen könnten«.
Löchner selbst zeigt immer wieder Gesichtszüge des Wahns, stellt Sofa und Sessel vor die Bühnenwand, auf der all die vorherigen Herrscher, Bediensteten und Personen, welche Ansorg verkörpert, angepinnt sind. Er spricht in verstellter Stimme und in verteilten Rollen mit ihnen, verfremdet Lebensmittel wie Wackelpudding und redet mit einer Kinderstimme wie ein Prinz, der sich an die Geburt seiner Brüder und Ähnliches erinnert.
Ansorg schickt immer wieder über einen Laptop schmerzverzerrte Gesichtszüge, einmal mit zusätzlich rot geschminkten Lippen, an Richard III, nur um ihm das Leid seiner Opfer leibhaftig vorzuführen. Zwischendurch blitzt und donnert es an der Decke, auch die in Ansorg verkörperten Personen und er leiden. Ansorg wird gar zum Über-Ich Richards und besucht ihn, mal wieder auf dem Sofa sitzend, gegen Ende des Stückes, erinnert ihn an seine Taten, packt ihn am Hals und an der Gurgel und erwürgt ihn nach und nach. Als er bereits auf dem Boden liegt, hängt er ihn zusätzlich kopfüber auf, entfernt ihm theatralisch seine Eingeweide und lässt ihn bluten. Dies bringt zusätzliche theatralische Spannung ins Stück, denn der reale Richard III wurde von seinen Peinigern ebenfalls gequält und zur Schau gestellt.
Dem Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Podium des Stadttheaters gefällt es und es klatscht begeistert. Beeindruckend!
Titelangaben
Richard III.
Stückprojekt nach William Shakespeare
Theater Pforzheim (Podium)
Termine
Fr., Sa., So. 06.-08. Juli, Beginn: 20:00 Uhr