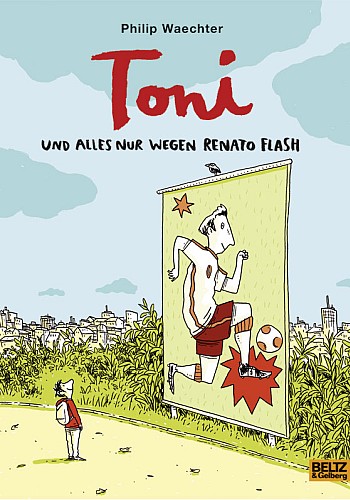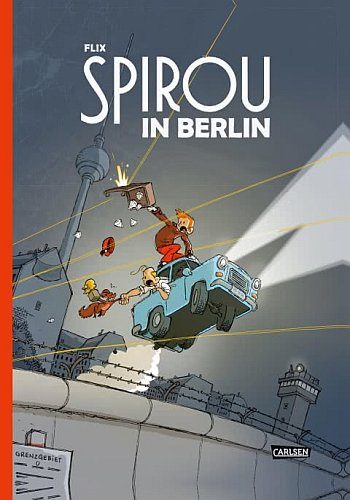Menschen | Zum Tod des Schriftstellers Dieter Forte
»Manchmal denke ich, ich bin ein Fremder auf dieser Welt«, bekannte der Schriftsteller Dieter Forte 1998 in einem Interview. Sein großes literarisches Sujet stellte sich tatsächlich quer zum Zeitgeist: Die seelischen Verwundungen der Nachkriegszeit, die unsichtbaren Narben und Traumata, die durch Hunger und totale Zerstörung des Lebensraumes ausgelöst wurden, hat Forte zum Thema seiner vier großen Romane gemacht, die seit 1992 erschienen sind. Ein Porträt von PETER MOHR
Zuvor hatte er reichlich Bühnen- und Fernseherfahrung gesammelt, in den frühen 1960er Jahren am Düsseldorfer Schauspielhaus bei Karl-Heinz Stroux und danach als Regieassistent beim NDR-Fernsehen unter der Ägide von Egon Monk. Sein großer künstlerischer Durchbruch gelang ihm 1970 mit dem in Basel uraufgeführten Theaterstück ›Martin Luther & Thomas Münzer oder Die Einführung der Buchhaltung‹, das in der Folge auf mehr als 40 Bühnen inszeniert wurde.
Dieter Forte, der am 14. Juni 1935 in Düsseldorf geboren wurde und seit mehr als 40 Jahren in Basel lebte, hat in den 70er und 80er Jahren vor allem Theaterstücke (er war fünf Jahre Hausautor des Basler Theaters) und anspruchsvolle Fernsehspiele verfasst. Der brillante Romanautor Forte ist eine Entdeckung der 1990er Jahre, als er mit seiner opulenten semi-autobiografischen Romantrilogie – bestehend ›Das Muster‹ (1992), ›Der Junge mit den blutigen Schuhen‹ (1995) und ›In der Erinnerung (1998)‹ – bei Kritik und Publikum auf eine äußerst positive Resonanz stieß.
»Dem Jungen fiel das Atmen schwer. Ein Zustand, der Tag und Nacht anhielt. Er lag in einer Ecke des Kellers und las, lag in einer engen Bücherhöhle, las alle die Bücher, die die Familie für ihn gesammelt hatte, aus zerstörten Häusern und Kellern und von der Straße«, heißt es im Roman ›Der Junge mit den blutigen Schuhen‹, und hinter diesem Heranwachsenden darf man den seit frühester Jugend asthmakranken Dieter Forte vermuten.
Der totalen Zerstörung, dem unendlichen individuellen Leid setzt er immer wieder gekonnte Naturbilder entgegen, die eine Art Licht am Ende eines dunklen Lebenstunnels symbolisieren. Diese scheinbaren Antagonismen gehören in Fortes Oeuvre zu einem prägenden Stilmittel. So heißt es im 1998 erschienenen Roman ›In der Erinnerung‹: »Wieder ein Sonnenaufgang, wieder ein Hoffnungsschimmer.« Doch danach wird die Hauptfigur mit Brachialgewalt abrupt auf den Boden der bedrückenden Realität zurückgeholt: »verglühte Kirchenschiffe, die Silhouette einer untergegangenen Stadt mit ihren schroffen Konturen.«
Sein absolutes erzählerisches Meisterwerk legte Forte 2004 mit seinem Roman ›Auf der anderen Seite der Welt‹ vor, dessen Handlung in den frühen 50er Jahren angesiedelt ist, in einer Zeit, als die Waffen längst schwiegen, als emsig der Wiederaufbau betrieben wurde, aber im gesellschaftlichen Abseits noch immer der Tod unbarmherzig zuschlug. Ein asthmakranker Jugendlicher, der sich in einem Lungensanatorium auf einer Nordseeinsel befindet, steht im Mittelpunkt des Romans. Anders als in Thomas Manns ›Zauberberg‹ wird bei Forte keine philosophische Konversation betrieben, hier werden die letzten Sätze geröchelt, Lebensbeichten heraus gestöhnt, hier gehen durch den Krieg gekrümmte Lebenslinien zu Ende – nicht im mondänen Schicki-Micki-Ambiente, sondern in der von kräftigen Stürmen zerzausten Inseleinöde. Diese Klinik kommt wie eine Wartehalle des Todes daher, nicht zufällig befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Friedhof.
»Ich arbeite eigentlich wie ein Maler. Ich schreibe Szenen und Bruchstücke, schreibe die oft auch wahllos durcheinander, nicht kontinuierlich«, hatte der Autor über seine eigene Arbeitsweise befunden.
Sein letztes bedeutendes Erzählwerk (›Das Labyrinth der Welt‹, 2013) präsentierte eine Mischung aus Essay, Erzählung, Autobiografie, philosophischen Sequenzen und unaufgeregter Liebeserklärung an seine Wahlheimat Basel.
Dieter Forte gehörte zeitlebens zu den unterschätzten deutschsprachigen Gegenwartsautoren. Den einen oder anderen Preis hat er zwar erhalten, aber die bedeutenden literarischen Auszeichnungen gab es für ihn noch nicht. Forte war fraglos Büchner-Preis-würdig, und auch die Stadt Köln hätte für den Heinrich-Böll-Preis kaum einen adäquateren Preisträger finden können. Die gemeinsame rheinische Herkunft, die thematischen Analogien und die Affinität zur Erzählperspektive aus dem Blickwinkel der »Verlierer« ließen ihn uns wie einen jüngeren Bruder Heinrich Bölls erscheinen.
Ein letztes, schmales Bändchen ist gerade erschienen. Darin sagt eine Frau fast lapidar: »Der Mensch ist ein zerstörerisches Wesen.« Ein schnörkelloses Buch, ein kurzer Satz – ein Vermächtnis!
Am Ostermontag ist Dieter Forte in Basel im Alter von 83 Jahren gestorben.
Titelangaben
Dieter Forte: Als der Himmel noch nicht benannt war
Frankfurt: S. Fischer Verlag 2019
92 Seiten, 17 Euro