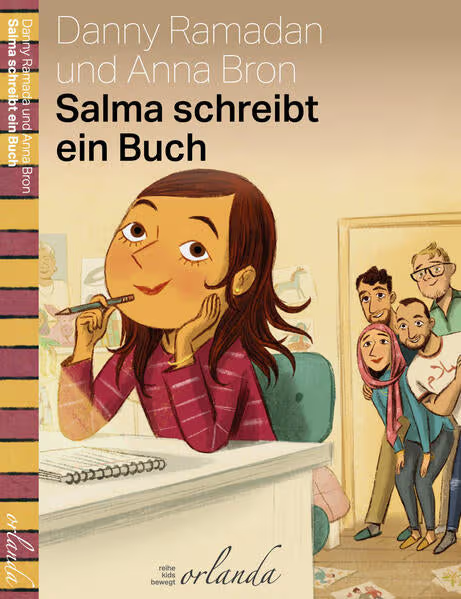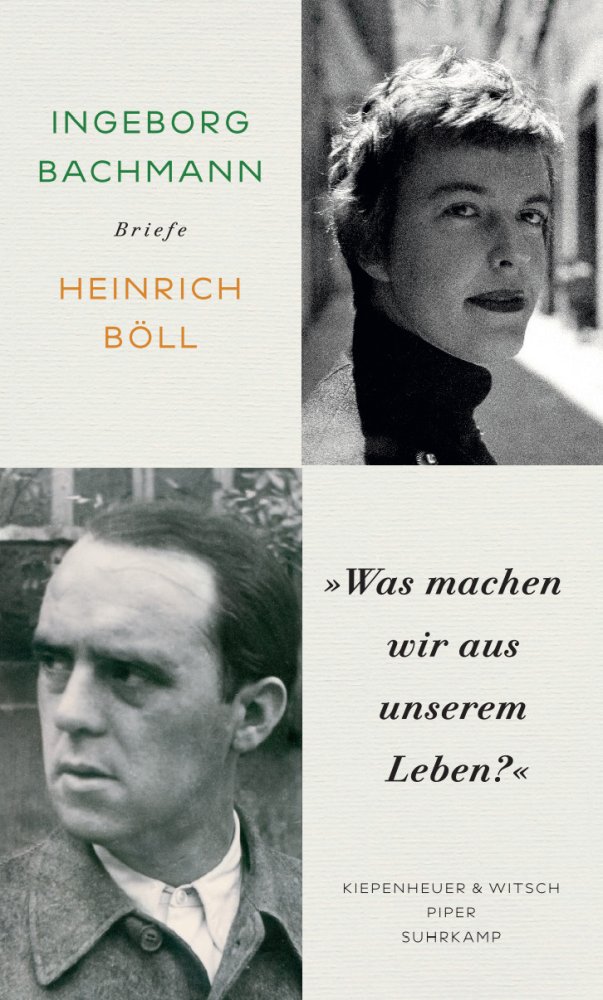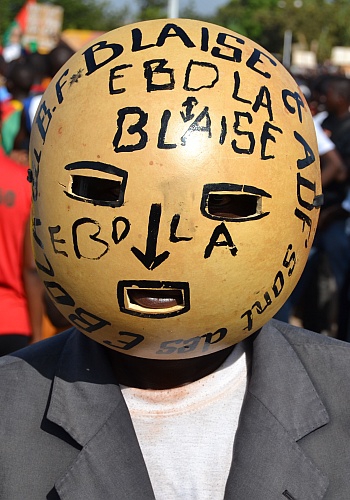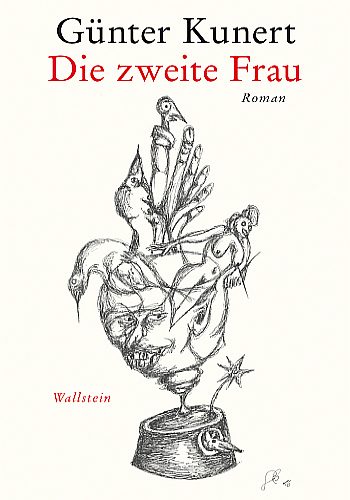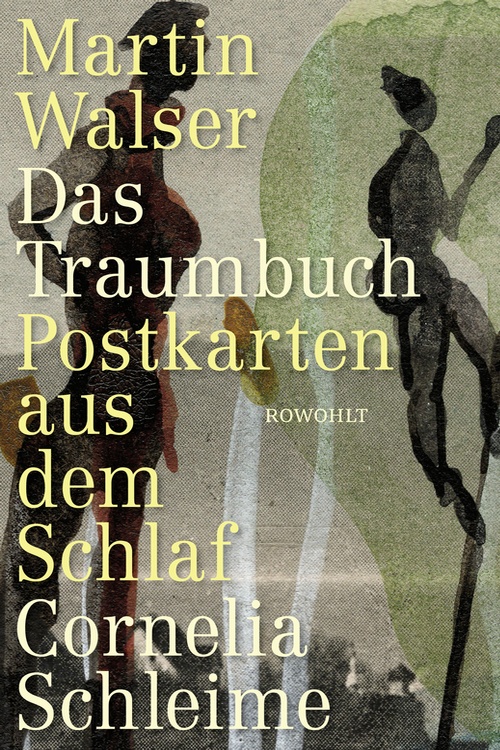Im Interview mit RUDOLF THOMAS INDERST spricht Sascha Heller über die Geschichte queerer Figuren im Gaming, über Fortschritte und Fehltritte digitaler Repräsentation und darüber, weshalb Normalisierung in Spielen weit mehr bedeutet als nur Sichtbarkeit.
Rudolf Thomas Inderst: Guten Tag Sascha Heller, vielen Dank, dass Sie sich für unser Gespräch über Ihr Buch Einmal queer gespielt. Über die Rolle der Repräsentation von LGBTQIA+-Identitäten im Videospiel (erschienen 2025 bei Springer) Zeit nehmen. Bitte stellen Sie sich unseren Leser:innen kurz vor und beschreiben Sie Ihren Arbeitsalltag.
 Sascha Heller: Sehr gerne und danke für Ihr Interesse! Ich bin Medienwissenschaftler und angehender klinischer Psychologe. Seit dem ersten Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft beschäftige ich mich in- und außerhalb der Universität mit Videospielen als Medium und Forschungsgegenstand. Das Thema lässt mich nun schon seit 2015 nicht los und wird – sofern möglich – von mir gerne um eine Perspektive auf queere Identität und Lebensrealitäten ergänzt. Das Ganze und alles, was mich darüber hinaus wissenschaftlich interessiert, versuche ich verständlich und besprechbar zu machen. Dafür gibt es mich auf den sozialen Medien und auch als Podcast unter dem Label ›Medienmonolog‹.
Sascha Heller: Sehr gerne und danke für Ihr Interesse! Ich bin Medienwissenschaftler und angehender klinischer Psychologe. Seit dem ersten Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft beschäftige ich mich in- und außerhalb der Universität mit Videospielen als Medium und Forschungsgegenstand. Das Thema lässt mich nun schon seit 2015 nicht los und wird – sofern möglich – von mir gerne um eine Perspektive auf queere Identität und Lebensrealitäten ergänzt. Das Ganze und alles, was mich darüber hinaus wissenschaftlich interessiert, versuche ich verständlich und besprechbar zu machen. Dafür gibt es mich auf den sozialen Medien und auch als Podcast unter dem Label ›Medienmonolog‹.
Mein Arbeitsalltag hingegen besteht zurzeit aus der Arbeit in der sozialpädagogischen Familienhilfe: Im Auftrag des Jugendamtes sind ich und meine Kolleg*innen für Familien da und unterstützen so gut es geht, um in Sachen Erziehung, Alltag und Krisen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und neben dieser Tätigkeit befinde ich mich – wie bereits erwähnt – im Masterstudium der klinischen Psychologie.
In Ihrem Buch spannen Sie einen weiten Bogen von Queer Studies über Medienpsychologie bis hin zu Game Studies. Welche besondere Stärke entfaltet diese interdisziplinäre Perspektive für die Analyse von Games?
Als queere Person und Psychologiestudent*in ergab sich mir eigentlich gar keine andere Perspektive. Es ging mir beim Recherchieren und Schreiben um die Verknüpfung relevanter Aspekte: Ich betrachte Videospiele als Produkt einer Gesellschaft, mit einer (unter)bewussten Reproduktion der Realität und ihrer Anteile. Es ist dieselbe Gesellschaft, die eine Norm cisgeschlechtlicher und heterosexueller Menschen konstruiert, also ein richtig und falsch aufspannt, auf das auch Medienprodukte zugreifen. Mittendrin sind queere Menschen, die ein Medium nutzen, das sie oft nicht mitdenkt – in einer Gesellschaft, die sie nicht mitdenkt. Deshalb ist es ergänzend dazu auch aus (medien)psychologischer Perspektive interessant, wieso Videospiele gespielt werden und was sie auch emotional mit und für uns tun – positiv wie negativ.
Sie zeichnen nach, wie queere Figuren und Narrative seit den 1980er-Jahren Eingang in Video- und Computerspiele gefunden haben. Welche Entwicklungen haben Sie dabei am meisten überrascht – positiv wie negativ?
Positiv überrascht hat mich definitiv die Existenz eines queeren Videospiels im Jahre 1989. C. M. Ralph schuf mit Caper in the Castro die erste lesbische Detektivin im Gaming. So früh hatte ich Queerness in der Videospielgeschichte ehrlich gesagt nicht erwartet. Seitdem nahm auch der Umfang an Queerness zu. Viele erwarten beim Thema »Queerness in Videospielen« oft queere Charaktere, aber wie schon das LGBTQ Video Game Archive zeigt, kommt Queerness in vielen Formen. Und seien es eben die Post-Mastektomie-Narben als einzufügende Körpermodifikation in Die Sims 4. Oder ein Trank zum Wechseln des Charakter-Geschlechts in Fable. Repräsentation ist so vielseitig!
Repräsentation ist in Ihrem Buch ein zentrales Stichwort. Was macht für Sie eine gelungene queere Repräsentation in Video- und Computerspielen aus?
Ich wünsche mir eine Normalisierung von LGBTQIA+ – Identitäten. Gesellschaftlich und auch im Spiel. Charaktere im Spiel dürfen ganz nebenbei die Information fallen lassen, als Mann mit einem Mann verheiratet zu sein. Oder – wie in Star Trek: Deep Space 9 – ein bereits bekannter Charakter mit einem neuen Namen auftaucht. All das ist normal, nichts Besonderes, es ist Teil der Welt und des menschlichen Erlebens. Darüber hinaus will ich Sichtbarkeit und Anerkennung: Queere Identitäten sollen sichtbar sein, als eine von vielen Charaktereigenschaften. Die lesbische Kriegerin liebt ihre Familie, isst gerne Suppe, hasst laute Kneipen. Und gleichzeitig können wir anerkennen, dass gerade eine Eigenschaft wie »lesbisch« eben nicht nur Eigenschaft ist, sondern einen Teil der Biografie (mit)beschreibt, der Coming-outs, Selbstfindung, Diskriminierung und Gewalt implizieren kann.
In einem Kapitel beschreiben Sie Video- und Computerspiele auch als Lebenswelt, die Selbstwirksamkeit und Identitätserfahrungen ermöglicht. Welche Rolle spielen Games für queere Spieler:innen in diesem Zusammenhang?
Je nach Biografie können Videospiele der erste Raum für queere Gamer*innen sein, in dem sie sie selbst sein dürfen. Vielleicht der erste Raum für eine trans Person, einen neuen Namen, andere Pronomen oder andere Kleidung auszuprobieren. Gleichzeitig haben queere Menschen natürlich dieselben Bedürfnisse wie jeder Mensch. Und dort, wo eine queerfeindliche Gesellschaft sich negativ auf bspw. den Selbstwert, die soziale Einbindung und Verbindung zu anderen oder Autonomie auswirkt, da können Videospiele womöglich einen Ausgleich darstellen. Ein*e nichtbinäre Schüler*in wird womöglich in einer Schulklasse ausgegrenzt und abgewertet, könnte aber in einer Gilde in einem online Rollenspiel Rückhalt und Akzeptanz erfahren. Videospiele sind ein Teil unserer Lebenswelt und können Räume mit Möglichkeiten aufmachen, die wir außerhalb nicht haben.
Gleichzeitig weisen Sie auf Stereotypisierung und Diskriminierung in Spielen hin. Gibt es Beispiele, wo queere Figuren besonders problematisch dargestellt wurden und was lässt sich daraus Ihrer Meinung nach lernen?
Diskriminierung umfasst ja nicht nur eine negative Darstellung, sondern auch die wiederholte Nicht-Darstellung oder die eingeschränkte Besprechung und Relevanz der Thematik. Spielwelten, in denen es zahlreiche heterosexuelle Interaktionen gibt, aber keine einzige queere Interaktion. Oder eben die Games, in denen die Sexualität nur eine bloße Variable ist und auf ein oder zwei Szenen beschränkt, ohne wirklichen Anteil an der Geschichte des Charakters. Aber eine negative Repräsentation findet sich bspw. auch in Capcoms Final Fight und Street Fighter. Der Charakter Poison wurde ursprünglich als Frau geschrieben, aber da es bei der Veröffentlichung in den USA verpönt wäre, Frauen zu schlagen, schrieb man sie um als trans Frau. Was einhergeht mit der immer noch anhaltenden nicht-Anerkennung des Frauseins von trans Frauen sowie der Normalisierung von Gewalt ihnen gegenüber. Und in Deadly Premonition 2 aus dem Jahr 2020 gibt es einen trans weiblichen Charakter. Nachdem die Transidentität »öffentlich« wird, wird der Charakter vom Player-Charakter durchweg mit dem Deadname (also dem Namen vor der Transition) angesprochen. Daraus lässt sich durchaus mitnehmen, dass wir weder gesellschaftlich noch in der Videospielwelt so weit sind, Diskriminierung loszuwerden. Und, dass Diskriminierung nicht erst beim extravagant-bunten und exzentrischen schwulen Stereotyp anfängt.
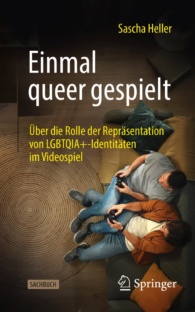 Es geht in Sachen Diskriminierung auch um das Missverstehen queerer Identität, um ein »Benutzen« queerer Identitäten als Plot-Twist, als komödiantische Pointe oder als Abgrenzung zu »den Normalen«. Dabei sind es auch Aspekte wie in Bully, wenn der Spielercharakter die Männer und Frauen anflirten und küssen kann. Einfach so. Ohne näher darauf einzugehen oder etwas Besonderes daraus zu machen. Denn am Ende des Tages ist eine queere Identität genau das: nichts Besonderes. Eine von vielen Eigenschaften, mit einer von vielen Ausprägungen. Anders, als es uns eine cis-hetero-normative Gesellschaft weismachen möchte.
Es geht in Sachen Diskriminierung auch um das Missverstehen queerer Identität, um ein »Benutzen« queerer Identitäten als Plot-Twist, als komödiantische Pointe oder als Abgrenzung zu »den Normalen«. Dabei sind es auch Aspekte wie in Bully, wenn der Spielercharakter die Männer und Frauen anflirten und küssen kann. Einfach so. Ohne näher darauf einzugehen oder etwas Besonderes daraus zu machen. Denn am Ende des Tages ist eine queere Identität genau das: nichts Besonderes. Eine von vielen Eigenschaften, mit einer von vielen Ausprägungen. Anders, als es uns eine cis-hetero-normative Gesellschaft weismachen möchte.
Zum Schluss: Wenn Sie ein zukünftiges Spiel designen könnten: Welche queeren Themen oder gesellschaftlichen Fragen würden Sie darin gerne behandelt sehen?
So spontan hätte ich Lust auf ein Story-getriebenes Actionspiel, bei dem wir in die Rolle eines unreflektierten, queerfeindlichen Protagonisten schlüpfen, der im Laufe des Spiels mit liebenswerten, queeren Menschen konfrontiert wird, den strukturellen Umfang von Queerfeindlichkeit sieht und erlebt und von Kapitel zu Kapitel mehr als Ally agiert.
Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre weitere Forschung!
Titelangaben
Sascha Heller: Einmal queer gespielt
Über die Rolle der Repräsentation von LGBTQIA+-Identitäten im Videospiel
Wiesbaden: Springer 2025
122 Seiten, 17,99 Euro
Weiterlesen
| Webseite von Sascha Heller
| Instagram-Seite: Medienmonolog
| BlueSky-Auftritt Medienmonolog