Gesellschaft | Marlène Schnieper: Nakba – Die offene Wunde
Die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser 1947/49, Kern und Ausgangspunkt des heutigen Palästinakonflikts, ist in Deutschland nur in Umrissen bekannt. Die Schweizer Publizistin Marlène Schnieper, 2006-2008 Korrespondentin des Züricher Tages-Anzeiger in Israel und Palästina, bietet mit ihrem Buch Nakba – die offene Wunde eine knappe, aber umfassende Darstellung dieser ersten großen ethnischen Säuberung im Nahen Osten. Von PETER BLASTENBREI
 Früh in der Geschichte des Zionismus macht die Autorin aus, was zum roten Faden ihrer Darstellung wird. Denn die Idee des Transfers der einheimischen arabischen Bevölkerung aus dem angeblichen »Land ohne Volk für das Volk ohne Land« findet sich schon beim Gründervater Herzl. Die Kolonialmacht Großbritannien spielte in der Zeit ihres Mandats über Palästina eine zwielichtige Rolle gegenüber den zionistischen Siedlern, die an der Schaffung unumkehrbarer Fakten arbeiteten. Anfangs Komplize, williger Vollstrecker und schließlich betrogener Betrüger? Die palästinensische Führung der 1920er und 1930er Jahre hatte der britisch-zionistischen Doppelstrategie jedenfalls nichts entgegenzusetzen.
Früh in der Geschichte des Zionismus macht die Autorin aus, was zum roten Faden ihrer Darstellung wird. Denn die Idee des Transfers der einheimischen arabischen Bevölkerung aus dem angeblichen »Land ohne Volk für das Volk ohne Land« findet sich schon beim Gründervater Herzl. Die Kolonialmacht Großbritannien spielte in der Zeit ihres Mandats über Palästina eine zwielichtige Rolle gegenüber den zionistischen Siedlern, die an der Schaffung unumkehrbarer Fakten arbeiteten. Anfangs Komplize, williger Vollstrecker und schließlich betrogener Betrüger? Die palästinensische Führung der 1920er und 1930er Jahre hatte der britisch-zionistischen Doppelstrategie jedenfalls nichts entgegenzusetzen.
Je konkreter der zionistische Staat im Staat im historischen Palästina Formen annahm, umso mehr verengte sich der Gedanke eines wie auch immer gearteten Transfers zur gewaltsamen Vertreibung. Die arabische Gesellschaft in Palästina, seit dem Aufstand 1936/39 führerlos und entwaffnet, reagierte 1947 auf den absurd einseitigen UN-Teilungsbeschluss zwangsläufig mit einem harten Nein. Da war die Nakba (arabisch Katastrophe) so oder so längst beschlossene Sache.
Marlène Schnieper hat acht Palästinenser nach ihren Erinnerungen befragt, die entweder noch als Kinder Flucht und Vertreibung miterlebt haben oder als Nachkommen von Flüchtlingen geboren wurden. Mit Ahmed Yousuf, Berater von Ismail Haniye in Gaza, und dem Wissenschaftler und früheren Arafat-Berater Sari Nusseibeh in Jerusalem sind auch zwei heutige Prominente darunter. Eigene Erfahrungen, Berichte der Eltern und Verwandten und Erlebnisse der Zeit nach 1949/48 aus dem Exil in und außerhalb Palästinas, eben die Folgen der Nakba, reihen sich hier aneinander.
Legalisierter Raub
Was sie zu berichten wissen, gleicht sich, egal ob Stadtbewohner, Dorfbewohner, Beduinen, Arme, ehemals Wohlhabende oder Menschen sprechen, die es im Exil durch Fleiß und Ausdauer erneut zu etwas gebracht haben. Die Palästinenser sahen sich 1947/49 einem entschlossenen und denkbar skrupellosen Gegner gegenüber, der seine ideologischen Vorgaben umsetzte, koste es, was es wolle. Gute Nachbarschaft, selbst schriftliche Waffenstillstände mit jüdischen Kolonien galten nichts mehr. Die militärisch überlegene israelische Armee trieb die arabischen Palästinenser erbarmungslos vor sich her, begleitet vom Einsatz schwerer Waffen gegen Zivilisten und Massakern an Unbewaffneten, ein Vorgehen, das die Spitzen des neuen Staates angeordnet und gewollt hatten.

Eine überzeugende Methode
Die Berichte der Interviewpartner sind dicht verwoben mit allgemeineren Übersichten und historisch-politischen Analysen der Nakba aus den Veröffentlichungen palästinensischer Historiker und der israelischen sogenannten Neuen Historiker von Benny Morris bis Ilan Pappe. So wird aus jedem Interview das Exempel eines zentralen Aspekts der palästinensischen nationalen Katastrophe, aber auch ein Beleg für die zentrale These der Autorin. Schnieper betrachtet nämlich, ganz zu Recht angesichts von Rechtsverweigerung, Sippenhaftung, Hauszerstörungen, willkürlichen Verhaftungen oder der Zwangsansiedlung der Negevbeduinen, die Nakba als einen »nach vorne offenen Prozess«, als fortdauernden Angriff auf das Existenzrecht der Palästinenser also.
Umfassende Literaturkenntnis, empathische Gesprächsführung und eine souveräne Beherrschung der in der wissenschaftlichen Oral History entwickelten Methode machen das Buch zu einer spannenden, ungewöhnlich informativen und für alle Nahost-Interessierten unverzichtbaren Lektüre. Weder das Fehlen des (bei deutschen Journalisten so beliebten) Wortlauts der Interviews noch die regionale Konzentration auf Süd- und Zentral-Palästina sind ein Manko. Im Gegenteil, man kann die mit sicherer Hand getroffene Auswahl und die intelligente Verarbeitung der Informationen aus verschiedensten Quellen nur bewundern. All dies bietet die Autorin in einem ruhigen, geradezu würdevollen Ton ohne alle Schockeffekte dar – die pure Faktenaufzählung ist schockierend genug.
Bleiben zwei kleinere Sachfehler zu berichtigen: die Zahl der freiwilligen Muslimbrüder bei der ägyptischen Palästinaarmee 1948/49 überstieg nie Bataillonsstärke; 2007 putschte nicht die Hamas in Gaza, sondern wehrte einen Fatah-Putsch ab.
| PETER BLASTENBREI
Titelangaben
Marlène Schnieper: Nakba – die offene Wunde. Die Vertreibung der Palästinenser 1948 und die Folgen
Zürich: Rotpunktverlag 2012
380 Seiten, 28 Euro
Reinschauen
Leseprobe



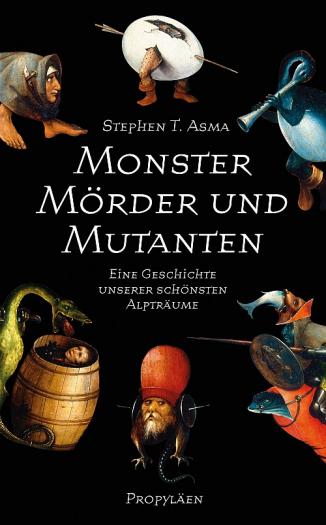

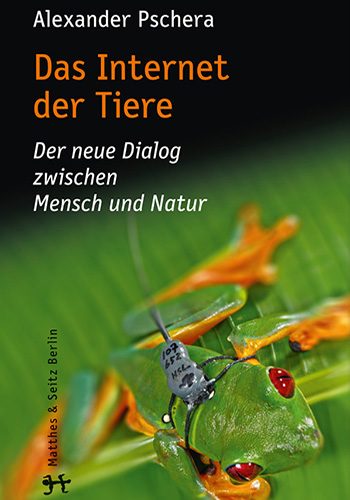


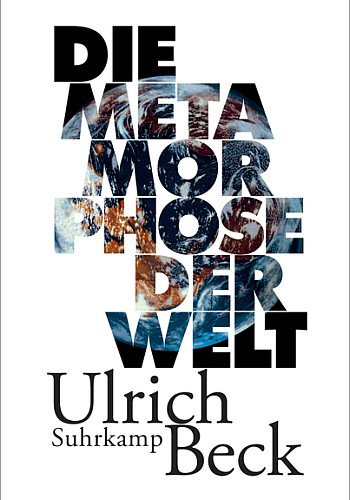
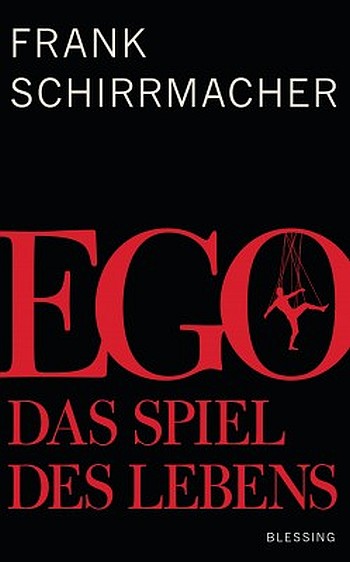

[…] tut das mit einem unbeirrbaren Gerechtigkeitssinn und scheut auch nicht das arabische Wort dafür, nakba Haifa. Ihr Buch kommt ohne Bilder aus, und es braucht auch keine. Yfaat Weiss erzählt so bildhaft […]