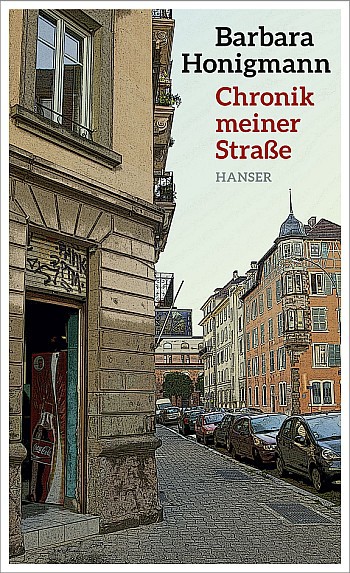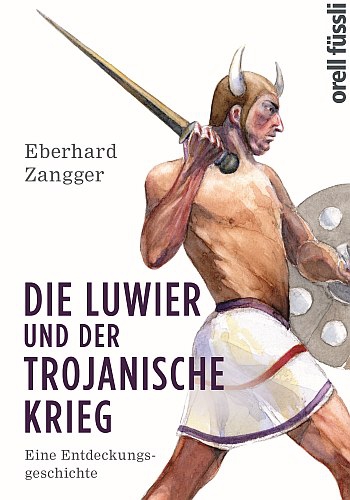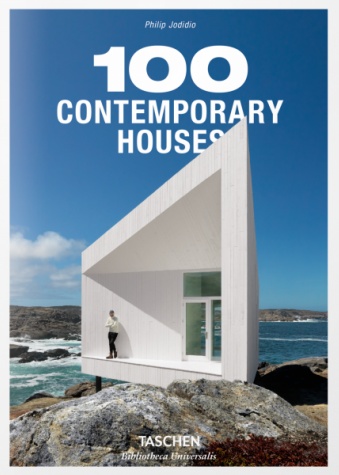Es gibt das Sprichwort von der Diskussion im luftleeren Raum. Ganz leer ist der Raum zwar nicht, in dem das Buch Die intellektuelle Ehe von Hannelore Schlaffer argumentiert, aber die Luft ist sehr dünn. Das Philosophenpaar Sartre und Beauvoir oder der Theatermensch Brecht werden als herausragende Beispiele dieser Idee präsentiert, deren Uneinlösbarkeit maßgeblich zu ihrem Reiz beiträgt. Von BASTIAN BUCHTALECK
 Bis heute ist die intellektuelle Ehe ein ebenso intellektuelles Konstrukt. Sie ist einer modernen Partnerschaft sehr ähnlich – mit dem Unterschied, dass sexuelle Freiheit nicht ausgeschlossen, sondern gewünscht ist. Wenn beide Partner das Primat des Geistes über den Körper anerkennen, so die These, dann sind ihre körperlichen Bedürfnisse frei für vielfältige Begegnungen. »Erotische Toleranz wurde zum moralischen Grundgesetz der intellektuellen Ehe«.
Bis heute ist die intellektuelle Ehe ein ebenso intellektuelles Konstrukt. Sie ist einer modernen Partnerschaft sehr ähnlich – mit dem Unterschied, dass sexuelle Freiheit nicht ausgeschlossen, sondern gewünscht ist. Wenn beide Partner das Primat des Geistes über den Körper anerkennen, so die These, dann sind ihre körperlichen Bedürfnisse frei für vielfältige Begegnungen. »Erotische Toleranz wurde zum moralischen Grundgesetz der intellektuellen Ehe«.
Die Vordenker dieser Idee sprachen von Freiheit und Offenheit. Gemeint haben sie die Freiheit, die eigenen sexuellen Bedürfnisse auszuleben und die Offenheit, dies nicht vor dem Partner verbergen zu müssen. Bisher waren die treibenden Kräfte hinter der intellektuellen Ehe immer Männer. Die Autorin porträtiert die Beziehungen von Otto Gross, Jean Paul Sartre und Bertholt Brecht zu Frauen. Dabei war das Ausleben der eigenen Lust nur die eine Seite. Genauso wichtig war es, das bürgerliche Establishment zu brüskieren.
Randphänomen
Da die Aristokratie, das Bürgertum und das Proletariat aus verschiedenen Gründen kaum an diesen Liebesexperimenten interessiert sein können, wie Schlaffer überzeugend darstellt, bleiben nur die bourgeoisen Freigeister als Interessenten dieser Idee. Das Buch behandelt also ein Randphänomen, dessen Entwicklungspotential angezweifelt werden darf. Zwar formuliert Schlaffer die zentrale Kritik an der intellektuellen Ehe selbst: Immer würden Frauen leben, was Männer erdacht haben. Daraus entwickelt sie jedoch keine kritische Betrachtung des Konzepts insgesamt.
In der Theorie entstehen in der intellektuellen Ehe keine Verletzungen durch körperliche Untreue, weil die Freude über die Freiheit des Partners überwiegt. Wer hier nicht einhakt, kennt die Eifersucht nicht. Gerade die Eifersucht ist der Antagonist einer sexuell offenen Beziehung und kann bis heute nicht als überwunden gelten – sofern dies möglich sein sollte. Und selbst wenn es Einzelnen gelingt, sind diese Einzelnen die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Im Buch wird die Eifersucht erst spät erwähnt und leider viel zu schnell abgehandelt. Dies ist die entscheidende Schwachstelle des Buchs. Schlaffer beschreibt die intellektuelle Ehe, kritisiert sie aber nicht. Dabei beschreibt Schlaffer in den Porträts, dass Eifersucht auch bei den Prototypen der intellektuellen Ehe vorlag und dort verschwiegen wurde, weil sie der Vereinbarung des geistigen Primats zuwiderläuft. Freiheit und Offenheit unterliegen der Eifersucht.
Eine literaturwissenschaftliche Arbeit
Stilistisch ist das Buch zweigeteilt, auch wenn der Bruch kaschiert wird. Der erste Teil erinnert im Stil an ein Sachbuch, kommt aber nicht auf den Punkt, bleibt beschreibend und bietet keine Bewertung. Anhand von Romanzitaten rund um das 19. Jahrhundert erarbeitet die Autorin den zweiten Teil des Buchs, der deutlich trockener ist und stark an eine literaturwissenschaftliche Arbeit denken lässt. Die Zwischenüberschrift »Das Material der Untersuchung« ist ein sicheres Zeichen.
Insgesamt ist die intellektuelle Ehe mehr ein Etikettenschwindel, denn ein ernst zu nehmendes Konzept. Der Name legt nicht nur fälschlicherweise nahe, dass diese Form der Partnerschaft eine besonders kluge sein müsse, vor allem der Begriff der Ehe ist fehl am Platz. Bislang ist die Idee der intellektuellen Ehe immer nur als demonstrativer Ausbruch aus der bürgerlichen Gesellschaft geprobt worden. Für die Mehrheitsgesellschaft scheitert die intellektuelle Ehe spätestens an der Eifersucht und auch Schlaffers Buch schafft es nicht, zu zeigen, was den normalen Bürger an dieser Idee reizen könnte. Die intellektuelle Ehe macht den Anschein einer literaturwissenschaftlichen Arbeit und als solche funktioniert sie gut – als Sachbuch nicht.
Titelangaben
Hannelore Schlaffer: Die intellektuelle Ehe
Der Plan vom Leben als Paar
München: Carl Hanser 2011
224 Seiten. 18,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe