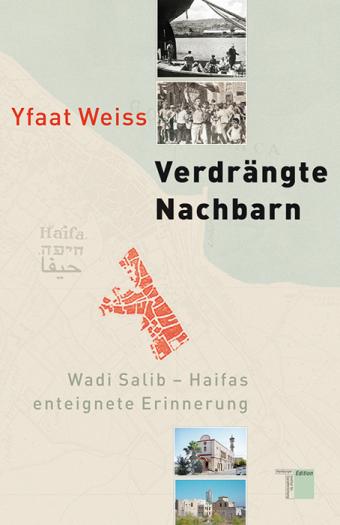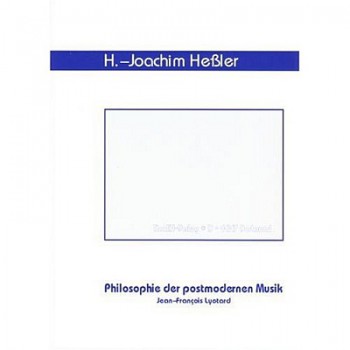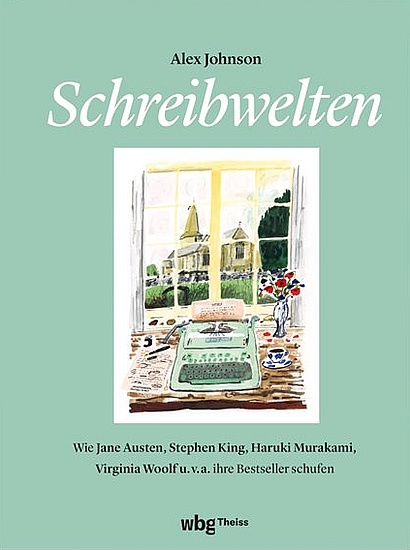Kulturbuch | Ehn / Löfgren: Nichtstun
Die Muße einer Siesta wird heute immerhin nicht mehr überall als unproduktiver Gegensatz zur Arbeit verteufelt. Auch Nicht-Tätigkeit hat ihre sozialkompatiblen Funktionen. Aber wie sieht das bei den vielen anderen kleinen und größeren »Leerzeiten« aus – Rumstehen an Bushaltestellen oder vor Supermarktkassen beispielsweise? Ist das nicht »verlorene Zeit« fürs Individuum wie fürs Kollektiv? Im Gegenteil, zeigen Billy Ehn und Orvar Löfgren in ihrer fulminanten Studie Nichtstun. Eine Kulturanalyse des Ereignislosen und Flüchtigen. Von PIEKE BIERMANN
 Die Frage, wie homo sapiens und seine femina so ticken und was alles sich daraus für dero Sozialfähigkeit ergibt, ist vermutlich so alt wie die seltsame Species selbst. Die Antworten darauf sind entsprechend zahlreich und unterschiedlich, aber die klügeren heutigen Köpfe nutzen dafür das normal-banale Alltagsleben als fruchtbares Erkundungsgebiet. Denn so wie sich Rechtsbewusstsein und innere Friedlichkeit einer Gesellschaft nicht an verbrecherischen causes célèbres ablesen lassen, sondern an ihrer Alltagskriminalität und dem Umgang damit, so erzählt auch das »Drama des Alltäglichen« mehr über die innere Befindlichkeit einer Gesellschaft als alle spektakulären, prominenten Ereignisse zusammen.
Die Frage, wie homo sapiens und seine femina so ticken und was alles sich daraus für dero Sozialfähigkeit ergibt, ist vermutlich so alt wie die seltsame Species selbst. Die Antworten darauf sind entsprechend zahlreich und unterschiedlich, aber die klügeren heutigen Köpfe nutzen dafür das normal-banale Alltagsleben als fruchtbares Erkundungsgebiet. Denn so wie sich Rechtsbewusstsein und innere Friedlichkeit einer Gesellschaft nicht an verbrecherischen causes célèbres ablesen lassen, sondern an ihrer Alltagskriminalität und dem Umgang damit, so erzählt auch das »Drama des Alltäglichen« mehr über die innere Befindlichkeit einer Gesellschaft als alle spektakulären, prominenten Ereignisse zusammen.
Die Forschung über scheinbar Unscheinbares hat spätestens seit Georg Simmel und Walter Benjamin vieles davon ans Licht gebracht. Inzwischen weiß man zum Beispiel auch, dass die Muße einer Siesta keineswegs der unproduktive Gegensatz zur Arbeit ist. Aber was ist eigentlich mit anderen vermeintlich ereignislosen Nicht-Tätigkeiten? Auf diese Frage stießen die schwedischen Ethnologen Billy Ehn und Orvar Löfgren während einer Untersuchung über Wartende. Es begann mit einer Mikroanalyse: Jemand steht in der Schlange einer Supermarktkasse, still und nicht weiter auffällig, wie alle anderen, aber in seinem Kopf tobt ein hektischer Wettkampf – Hab ich die schnellere Schlange gewählt? Bin ich effizienter, also Sieger? Daraufhin befragten sie anonym ihre Studenten und stellten fest, dass praktisch jeder aus solchen vermeintlich ereignislosen »leeren«, »zähflüssigen«, »toten« Zeiten wahre Abenteuer inszeniert.
Fröhliche Wissenschaft
Ihr Staunen darüber: »Wenn nichts zu geschehen scheint, ist eine Menge los – aber was?« wird zum Ausgangspunkt einer breit angelegten Studie über das Nichtstun, die 2010 und zuerst auf Englisch in den USA erschienen ist. Herausgekommen sind 300 Seiten richtig »fröhlicher Wissenschaft«, ein ganz unakademisch leichtfüßiger Bericht, der immer auch über ihr eigenes Abenteuer des Suchens, Forschens, Denkens und Schreibens erzählt. Das Abenteuerliche liegt in der Natur der Sache: Eine kulturhistorische und -ethnologische Analyse von weitgehend Unsichtbarem, Unfassbarem, Flüchtigem erfordert zuallererst eine unkonventionelle bis wilde Methodologie, die ständig neu justiert werden will. Drei Kapitel sind drei typischen Ereignislosigkeiten gewidmet: dem Warten, den Routinen und dem Tagträumen. In allen geht es darum, wie individuelle Mikrovorgänge eingebettet sind in Makrobedingungen – und umgekehrt.
Zum Beispiel: Menschen stehen ethnokulturell gesehen sehr verschieden Schlange, auch weil sie unterschiedliche Zeitgefühle haben; wer gelernt hat zu warten, hat Selbstbeherrschung, also sozialpsychologisch wertvollen Triebaufschub gelernt; Routinen können zwar Kreativität und Erotik veröden, aber sie verschaffen einem auch existenzielle Sicherheit und Zeit zum Nachdenken über alles Mögliche; Tagträume sind auch ein Ort für die Kristallisation utopischer, gar revolutionärer Ideen und eine Spielart der Meditation. Jede/r von uns erfährt das andauernd am eigenen Leib (und Hirn) – morgens beim Zähneputzen, beim Stehen im Stau oder an der Haltestelle, beim Rumsitzen in Wartezimmern oder Geschirrspülen, beim wohligen Dösen in einer Arbeitspause.
Blick in die Hinterhöfe
Im vierten Kapitel lassen Ehn und Löfgren noch einmal Revue passieren, wie unausgewogen unser Verständnis modernen Lebens ist, wenn es sich »auf nur wenige Schauplätze und Prozesse« konzentriert, »die sich durch Dramatik, Ereignisreichtum und eine hohe Sichtbarkeit auszeichnen«. Dagegen, und frei nach Lichtenbergs stets erfrischendem Sudelbuch-Prinzip: »Wenn auch meine Philosophie nicht hinreicht, etwas Neues auszufinden, so hat sie doch Herz genug, das längst Geglaubte für unausgemacht zu halten«, setzen die beiden Autoren den Blick in die »Hinterhöfe der Moderne«. Sie fahren, wie schon in den vorangegangenen Kapiteln, jede Menge »Augenzeugen« auf – anonym bleibende ebenso wie namhafte, in verschiedensten Disziplinen forschende Menschen aus fast aller Welt, dazu Dichter und Denker, Maler und Musiker allerlei Geschlechts. Und Neues ist dabei sehr wohl auszufinden. So beherzt, wie sie all die scheinbar disparaten Splitter amalgamieren, gewinnen Ehn und Löfgren – und wir lesend auch – die Erkenntnis: Genau im angeblichen Leerlauf, den unsere eventgeile, schaff-und-raff-fixierte time-is-money-Kultur so verächtlich findet, steckt in Wahrheit aufregend viel soziale und kulturelle Kompetenz.
Eine erste Version dieser Rezension wurde am 4. Juni 2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.
| PIEKE BIERMANN
Titelangaben
Billy Ehn / Orvar Löfgren: Nichtstun. Eine Kulturanalyse des Ereignislosen und Flüchtigen
Aus dem Englischen von Michael Adrian
(The Secret World of Doing Nothing, 2010)
Hamburg: Hamburger Edition 2012
303 Seiten. 24 Euro
Reinschauen
Leseprobe