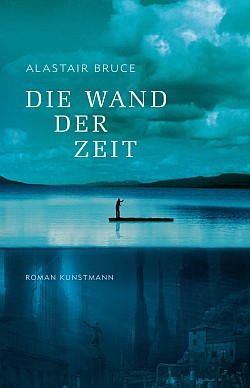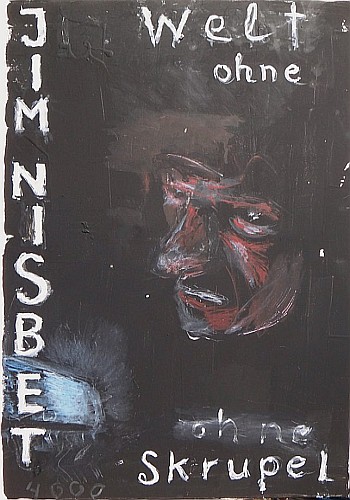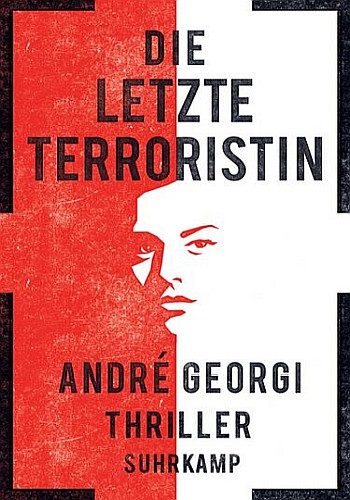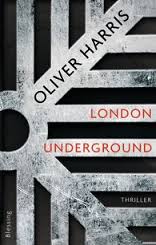Roman | Klaus Modick: Klack
Klaus Modicks Zeitreise durch das Nachkriegsdeutschland. Gelesen von PETER MOHR

Er ist schon seit ewigen Zeiten eine feste Größe im Literaturbetrieb. Als Übersetzer, Essayist, Kritiker und fleißiger Romancier hat sich der promovierte Literaturwissenschaftler einen Namen gemacht, doch der ganz große Durchbruch blieb dem 61-jährigen Klaus Modick bisher dennoch verwehrt.
Dabei versteht es der gebürtige Oldenburger vorzüglich, sich ernsten Themen in einem flotten, unangestrengten Plauderton zu widmen. Modick bewegt sich stets auf einem schmalen Grat zwischen E- und U-Literatur, eine »Mischung«, die im anglophonen Sprachraum längst salonfähig ist, in der deutschsprachigen Literaturszene aber immer noch ein Naserümpfen auslöst.
In seinem dreizehnten Roman nimmt uns Modick mit auf eine Zeitreise in die frühen 1960er Jahre. Sein Ich-Erzähler Markus ist 14 Jahre alt, als er auf dem Dachboden eine alte Fotokamera findet, eine »Agfa Clack«: »einlinsiges Objektiv, Rollfilm, Format 6 x 9«. Fortan dokumentiert er alles, was ihm vor die Linse kommt – Opas Beerdigung, die neue Eisdiele in der Nachbarschaft und vieles mehr. Mit dem Fotografieren, mit dem »Klack« des Auslösers wird ein Stück Gegenwart eingefroren.
Es ist eine Zeit der gewaltigen Zäsuren: vom Mauerbau bis zur Kubakrise, von der Eichmann-Verhaftung bis zur Veröffentlichung der Blechtrommel, die damals als Pornografie gegeißelt wurde. Doch nicht nur die Welt, die Modick immer wieder in die norddeutsche Kleinstadt einfließen lässt, befindet sich im Umbruch – auch Markus’ eigenes Leben verändert sich rasant. Der Apothekersohn lernt nämlich Clarissa Tinotti kennen, ein bildhübsches Mädchen aus Apulien, dessen Vater eine Eisdiele eröffnet hat.
Und damit befinden wir uns mitten im prallen Leben – zwischen ersten pubertären Wirrungen und detailreicher Erinnerungsreise in das Wirtschaftswunder-Deutschland. Modick baut alte Schlager, Werbeslogans und immer wieder Nachrichtenmosaike in seine Handlung ein. So entsteht ein facettenreiches Soziogramm der 1960er Jahre, das uns Einblick in das Denken der einfachen Leute gewährt, das uns den Zeitgeist atmen lässt, der noch immer von der NS-Zeit geprägt ist.
Wir erleben »aufgestandene« Kriegsverlierer, für die die Fußballweltmeisterschaft 1954 eine große Wende im eigenen Selbstwertgefühl markierte. Nicht nur für die Vertriebenenverbände sind die Ostgebiete weiterhin deutsch, und der Alltagsrassismus macht auch vor Markus’ Familie nicht halt. Seine strenge Oma sagt ganz offen, dass sie die »Spaghettifresser« nicht mag.
Modicks Geschichte wirkt unendlich weit weg, das Leben erscheint in einem leicht eingetrübten Sepiaton. Die Tanzstunde war ein bahnbrechendes Ereignis, die Raupenfahrt auf der Kirmes sorgte für erhöhten Blutdruck. Hier wird ein Lebensgefühl aus einer »anderen Zeit« evoziert, man atmet als Leser förmlich die etwas muffige Luft dieser Epoche ein.
»Ich bin nicht mit dem Erzähler identisch, der ist ja auch fünf Jahre älter als ich. Ich brauchte für die Geschichte einen Jugendlichen, der in der Pubertät ist, weil ich eine Pubertätsgeschichte erzählen wollte, und einen, der die Zeitsituation besser durchschaut als ich als Zehnjähriger«, hatte Klaus Modick in einem Interview erklärt.
Unabhängig von der Frage nach dem autobiografischen Anteil hat Modick diese Geschichte mit reichlich Herzblut und viel Liebe zu seinen Figuren erzählt. Hier gibt es kein besserwisserisches Moralisieren und keine Noten für political correctness. Da stehen die Ewiggestrigen unkommentiert neben der arroganten Schwester und der autoritären Lehrerschaft. Der Roman Klack liefert ein authentisches Zeitpanorama, einen erzählerischen Rückblick ohne jeden Zorn und wunderbar leicht erzählt.
Dass dieses Buch ganz stark an die Werke von Walter Kempowski erinnert, ist gewiss kein Zufall, denn beide Autoren kannten sich gut und schätzten einander sehr. Jetzt wünschen wir Klaus Modick (ganz ungeniert) eine ähnlich große Leserschaft. Verdient hätte er es längst.
| PETER MOHR
Titelangaben
Klaus Modick: Klack
Köln: Kiepenheuer & Witsch 2013
221 Seiten. 17,99 Euro
Reinschauen
Leseprobe