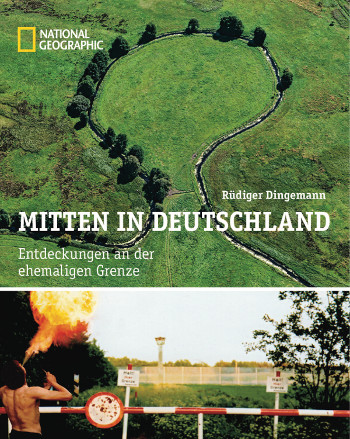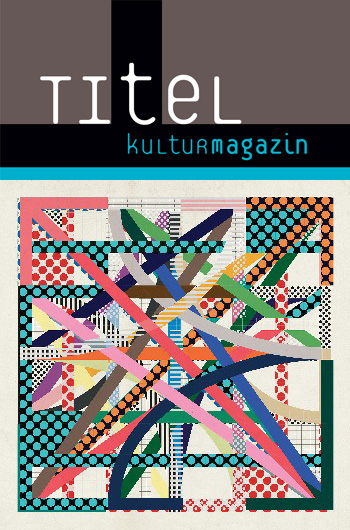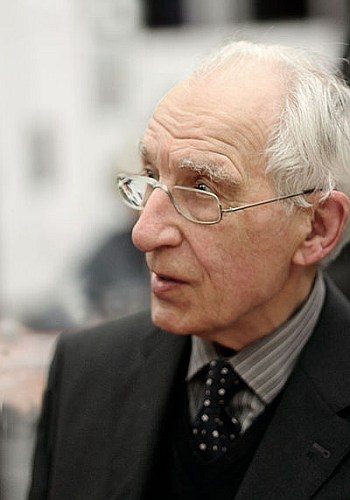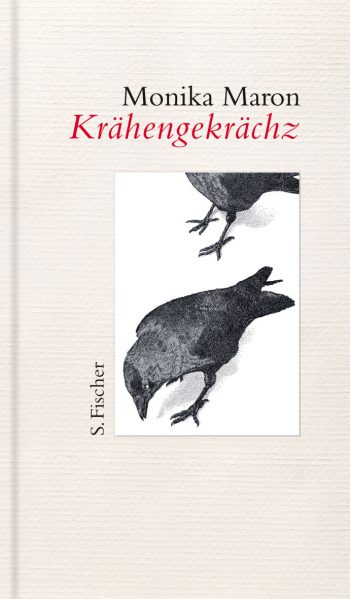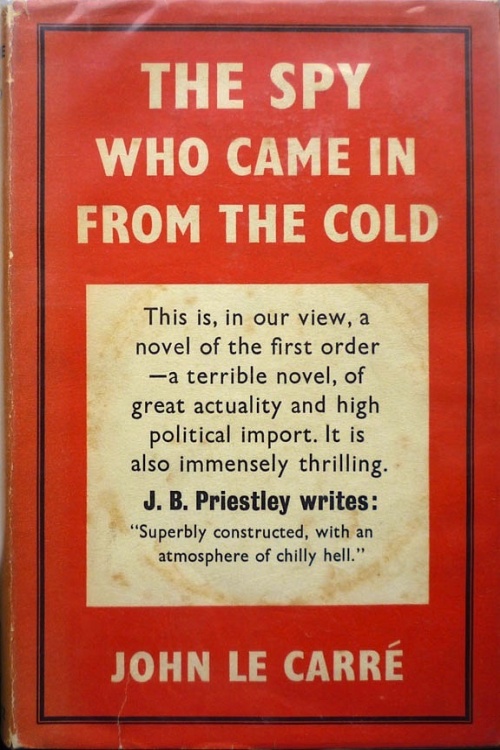Menschen | Marianne Birthler: Halbes Land. Ganzes Land. Ganzes Leben
Fünfundzwanzig Jahre nach dem Mauerfall analysieren prominente Gesichter Ursachen und Folgen der deutschen Wiedervereinigung. Marianne Birthler ist eine der bekanntesten Figuren auf dem Schachbrett der deutsch-deutschen Geschichte. Sei es als Oppositionelle in Ostberlin, als Abgeordnete der Bündnisgrünen im Deutschen Bundestag oder schließlich als Hüterin der menschenverachtenden Dokumente des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR. Ihre Erinnerungen lesen sich als bewegendes Dokument des kollektiven Gedächtnisses einer wiedervereinten Nation. VIOLA STOCKER hörte zu.
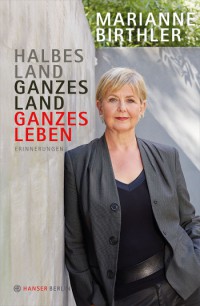 Marianne Birthler nimmt es mit dem Titel ihrer Erinnerungen sehr genau. Exakt nach der Hälfte des Buches ist man bei der Thematik der deutschen Wiedervereinigung angelangt. Dies verdeutlicht von vornherein zweierlei: Die Ereignisse im Oktober und November 1989 sind das für alle Welt sichtbare Ergebnis jahrzehntelangen Widerstands und hätten ohne die grundlegende Vorbereitung basisdemokratischer Strukturen seit den späten siebziger Jahren nie stattfinden können. Zum Zweiten befindet Birthler sich zu dem Zeitpunkt in der Mitte ihres Lebens, ein neues, interessantes und unentdecktes Land tut sich für die engagierte Mutter von drei Töchtern auf. Es ist kein Ende, sondern ein Anfang.
Marianne Birthler nimmt es mit dem Titel ihrer Erinnerungen sehr genau. Exakt nach der Hälfte des Buches ist man bei der Thematik der deutschen Wiedervereinigung angelangt. Dies verdeutlicht von vornherein zweierlei: Die Ereignisse im Oktober und November 1989 sind das für alle Welt sichtbare Ergebnis jahrzehntelangen Widerstands und hätten ohne die grundlegende Vorbereitung basisdemokratischer Strukturen seit den späten siebziger Jahren nie stattfinden können. Zum Zweiten befindet Birthler sich zu dem Zeitpunkt in der Mitte ihres Lebens, ein neues, interessantes und unentdecktes Land tut sich für die engagierte Mutter von drei Töchtern auf. Es ist kein Ende, sondern ein Anfang.
Unangepasste Kindheit
Marianne Radtke wird am 22. Januar 1948 als Kind von Erika und Andreas Radtke geboren. Andreas Radtke war als Soldat im Zweiten Weltkrieg stationiert in Litauen und Serbien. Erika Radtke wurde zusammen mit der Erstgeborenen nach Sandow evakuiert, ihre zweite Tochter starb an den Folgen der prekären medizinischen Versorgung. Marianne Birthler, die dritte Tochter der Radtkes, überlebt schließlich in den schwierigen ersten Nachkriegsjahren die riskante Säuglingszeit.
Dass Birthlers Vater als Selbstständiger in der DDR einen Wein- und Spirituosenhandel betreiben kann, ist bezeichnend für die immanenten Schwächen eines totalitären Systems. Als er an den Folgen einer Tuberkulose 1956 verstirbt, übernimmt Erika Radtke das Geschäft ihres Mannes. Schnell hat sie unter der zunehmenden Reglementierungswut des sozialistischen Wirtschaftssystems zu leiden, Warenlieferungen erfolgen nur unregelmäßig und nach längerer Zeit der Gängelung gibt Erika Radtke die Selbstständigkeit auf. Marianne ist zu dieser Zeit bereits im sozialistischen Schulsystem integriert und erfährt erste Diskriminierungen als Tochter einer Selbstständigen.
Lernen zu schweigen
Als roter Faden zieht sich durch Birthlers Biografie, wie notwendig es war, im Alltag der DDR sich der Tatsache bewusst zu sein, dass jedes öffentliche Wort dem Individuum zum Nachteil gereichen könnte. In Birthlers Fall betrifft das vor allem die Auswahl der Lektüre und das erwachende Interesse am protestantischen Glauben. Vor allem ihre zunehmende Religiosität bedeutet einen strategischen Nachteil, Birthler tritt schließlich aus der FDJ aus und riskiert damit, vom Abitur ausgeschlossen zu werden.
Es ist der grundlegenden demokratischen Organisationsstruktur der evangelischen Kirche zu verdanken, dass sich innerhalb des sozialistischen Staates liberalere Parallelstrukturen aufbauen können – obwohl die Stasi sicherlich allgegenwärtig war. Birthler beginnt, sich neben Schule und Berufsausbildung zur Außenhandelskauffrau zunehmend in der Kirche einzubringen. Aufgrund ihres persönlichen Werdegangs wird ihr ein Hochschulstudium vorerst verwehrt.
Rückzug ins Private
Der zunehmenden Unzufriedenheit im Berufsleben entflieht Marianne Birthler durch die Ehe mit dem Tiermediziner Wolfgang Birthler. Das Paar wohnt schließlich in Schwedt, Birthler entscheidet sich für ein vorläufiges Leben als Hausfrau und Mutter dreier Töchter und engagiert sich weiterhin stark in der Kirche. Sie absolviert eine zusätzliche Ausbildung zur Katechetin und arbeitet bis zur Trennung von ihrem Mann auch als lizenzierte Buchhändlerin.
Nach der Scheidung zieht sie wieder zurück nach Berlin, wo sie sich in die Jugendarbeit des evangelischen Pfarramts, vor allem im Prenzlauer Berg, einbringt. Hier knüpft sie neben privaten Freundschaften erstmals Kontakte zur organisierten Opposition. Dank der Unterstützung der evangelischen Kirche gelingt es Birthler, oppositionellen Gruppen Räume für Treffen und eine Plattform im Kirchenblatt anzubieten. Sie selbst ist vor allem in der »Initiative für Frieden und Menschenrechte« tätig.

Als die politischen Signale aus der UdSSR und Polen einen demokratischen Umbruch erkennbar werden lassen, verbünden sich verschiedene Oppositionsgruppen und organisieren wiederholt Demonstrationen und öffentlichkeitswirksame Aktionen. Als infolge der Unruhen und zunehmenden Machtlosigkeit der SED der ruinöse Zustand der DDR publik wird und bald darauf Mauerfall und Reformen eine Wiedervereinigung ankündigen, sitzt Marianne Birthler für das Bündnis 90 mit am runden Tisch.
Das Buch lässt deutlich spüren, wie sehr der Mauerfall für Marianne Birthler nur ein Teil einer spannenden persönlichen Geschichte ist. Während hier vielleicht der Höhepunkt einer Biographie gesehen werden kann, geht für Birthler die Geschichte schnell weiter. Sie wird Abgeordnete im ersten gesamtdeutschen Bundestag und im brandenburgischen Landtag unter Manfred Stolpe Regierungsmitglied. Allerdings verlassen sie und Matthias Platzeck als Landesminister die Bündnis-90-Fraktion im Sommer 1992, um Nachrückern Platz zu machen und die Legislative stärker von der Exekutive zu trennen. Nachdem Stolpes Stasi-Verstrickungen wenig später publik werden, tritt Birthler aus Protest auch als Ministerin zurück.
Geburt einer Autorität
Vielleicht ist es auch diese unbeirrbare persönliche Konsequenz Marianne Birthlers, mit der sie ihre ethischen Überzeugungen verficht, die sie immer wieder für prestigeträchtige Aufgaben prädestiniert. So ist sie Präsidiumsmitglied des Evangelischen Kirchentages, mehrfach Mitglied der Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten und bekommt 2011 das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern für ihr ehrenamtliches Engagement verliehen.
2000 wird sie Nachfolgerin von Joachim Gauck als Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Aus der Gauck-Behörde wird die Birthler-Behörde und wieder hat Marianne Birthler zu kämpfen, diesmal für die konsequente Öffnung der Akten und den Erhalt der Behörde. Für sie ist die Aufarbeitung eine notwendige Konsequenz aus der Abwicklung der Hinterlassenschaften der DDR.
Rückblick ohne Bitterkeit
Am meisten fällt an der Lektüre auf, wie ruhig und selbstsicher Birthler erzählt. Es ist eine sehr persönliche Biografie, die ohne voyeuristischen Schnickschnack und ohne Selbstmitleid auskommt, dafür auch nach Jahren immer noch streng jene verurteilt, die sich nicht integer verhalten hatten. Birthler scheut offensichtlich selten Konflikte und bleibt sich dabei immer treu, nicht ohne auch schriftlich zu beteuern, dass manche unbedachte oder gar falsche Behauptung ihrerseits sie heute sehr reue. Das eröffnet die Möglichkeit, mit einer soliden Mischung aus Distanz und Anteilnahme die Geschehnisse in der DDR und nach der Wiedervereinigung zu verfolgen, ohne dass Birthler für ihre Darstellung einen Absolutheitsanspruch verfechten würde. So werden ihre Erinnerungen zu einer solch angenehmen Lektüre, die ohne erhobenen Zeigefinger auskommt.
Titelangaben
Marianne Birthler: Halbes Land. Ganzes Land. Ganzes Leben. Erinnerungen
München: Hanser Verlag 2014
424 Seiten. 22,90 Euro
Reinschauen
| Leseprobe