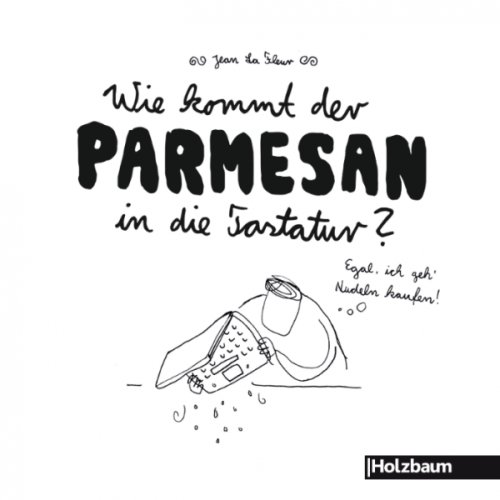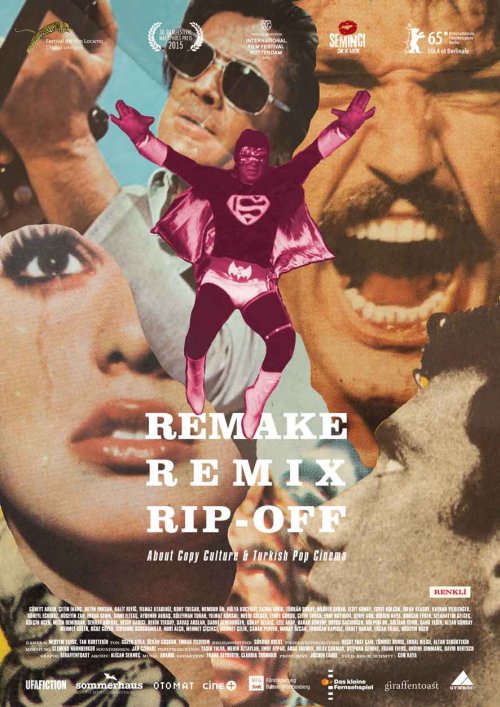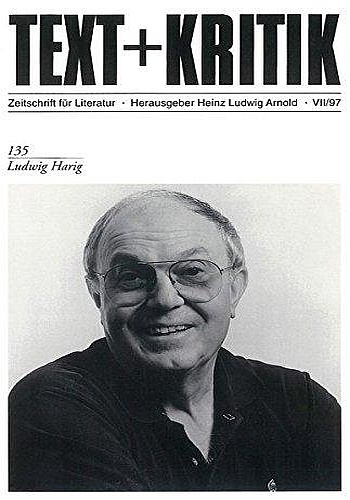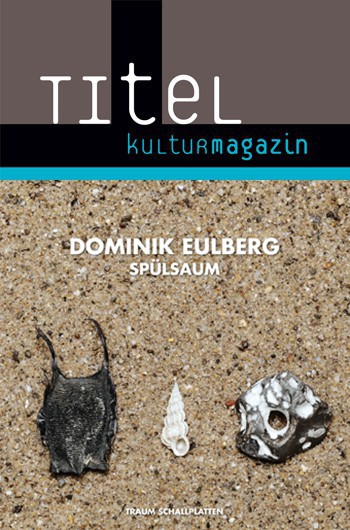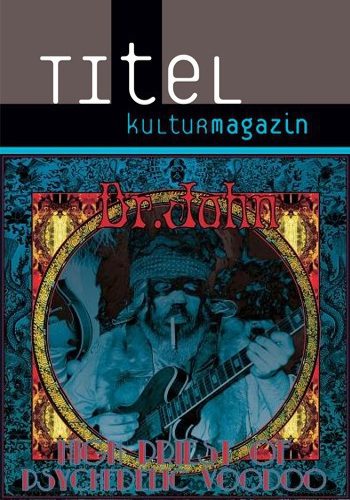Menschen | Camilo José Cela zum 100. Geburtstag
Als Camilo José Cela 1989 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, zeigten sich die internationale Fachwelt und auch der ausgezeichnete Autor überrascht von der Entscheidung der Stockholmer Akademie, in deren Begründung es hieß: »Mit der Auszeichnung wird die reichhaltige und intensive Prosa Celas gewürdigt, die in ihrem subtilen Mitgefühl ein eindrucksvolles Bild von der Verletzlichkeit des Menschen zeichnet. Mit Cela wird die führende Kraft der literarischen Erneuerung Spaniens während der Nachkriegszeit ausgezeichnet.« PETER MOHR gratuliert Literatur-Nobelpreisträger Camilo José Cela, der am 11. Mai vor 100 Jahren geboren wurde.

Abb: ÁWá
Den Ruf eines Enfant terrible hatte sich Cela schon anderweitig erworben. Seine zeitweise Nähe zum Franco-Regime brachte ihm immer wieder Kritik ein. Auch seine abfälligen Bemerkungen über Homosexuelle sorgten für Wirbel. Bei Auftritten im Fernsehen vermochte Cela, der zeitweise auch als Beamter, Maler und Schauspieler tätig war, mit Kraftausdrücken zu provozieren; sein »Diccionario secreto«, ein Wörterbuch der obszönen Sprache, hingegen und seine »Enciclopedia del erotismo« wirkten in Spanien geradezu befreiend.
1994 hatte Cela schon einmal einen hoch dotierten Preis, den Premio Planeta, erhalten (rund 300000 Euro), der ihm für den Roman La cruz de San Andrés zugesprochen worden war. Dieser Roman brachte den Nobelpreisträger sogar vor Gericht – wegen eines Plagiatvorwurfs der Schriftstellerin Maria del Carmen Formosa, den der Nobelpreisträger allerdings bestritt.
Camilo José Cela wurde am 11. Mai 1916 in Iria Flavia (Provinz La Coruña) als Sohn einer englischen Mutter und eines galizischen Vaters geboren. 1925 übersiedelte die Familie nach Madrid. Dort begann Cela ein Medizinstudium, wandte sich aber bald der Literatur zu und schloss auch sein Jurastudium nicht ab. In den 1930er Jahren arbeitete er als Journalist bei der Zeitung »Arriba«. Im Bürgerkrieg schloss er sich den aufständischen Franco-Truppen an und wurde schwer verwundet. Nach dem Krieg schrieb Cela zunächst für Blätter der faschistischen Organisation Falange und arbeitete als Zensor des Franco-Regimes.
Sein 1942 erschienener Roman Pascual Duartes Familie, in dem Cela seine Kriegserlebnisse verarbeitete, fiel allerdings selbst der Zensur zum Opfer und wurde verboten. Mit ihm hatte Cela die realistische Literaturform des »tremendismo« geschaffen, die sich durch eine düstere, raue und gewaltsame Sprache auszeichnete und die Literatur in Spanien und Lateinamerika stark beeinflusste. 1956 gründete Cela das einflussreiche spanische Literaturmagazin »Papeles de Son Armadáns«. Ein Jahr später wurde er in die Spanische Akademie aufgenommen.
Auch vom Nobelpreiskomitee wurde Pascual Duartes Familie noch als das herausragende Werk in Celas Œuvre gerühmt und als der nach Don Quijote meistgelesene Roman der spanischen Literatur bezeichnet. Über diesen Roman, eine fast dokumentarische Lebensbeichte eines fehlgeleiteten Mörders in der Zeit des Bürgerkriegs – ein Sujet, das Cela später mannigfaltig variiert hat –, sagte der Autor selbst: »Ich ließ Tat auf Tat, Blut auf Blut folgen.«
Cela schuf insgesamt mehr als 70 Werke, darunter 14 Romane. Er betonte häufig, dass er mit jedem seiner Werke etwas vollständig anderes versucht habe. Trotz des wiederkehrenden Motivs des Spanischen Bürgerkriegs fällt es tatsächlich schwer, einen verbindenden Bogen zwischen dem in viele Sprachen übersetzten Debütwerk und den nachfolgenden Romanen Der Bienenkorb (1951) und Mrs. Caldwell (1953) zu schlagen. In Pascual Duartes Famile betrieb Cela eine Art subjektive Vergangenheitsbewältigung und gleichzeitig einen Akt der kollektiven Selbstreinigung des »verführten« spanischen Volkes.
La colmena (Der Bienenkorb) spielt im Madrid der ersten Jahre nach dem Bürgerkrieg. Cela beleuchtet darin mit großer Intuition das Leben des unteren Mittelstandes und der Proletarier. Thematisch gegenüber seinem Debütwerk eigentlich nichts Neues, doch Der Bienenkorb ist formal viel komplexer und stilistisch ein wahres Meisterwerk. Aus Hunderten kleiner Bilder, aus Impressionen des düsteren Madrider Lebens und unzähliger, teils nur fragmentarisch beleuchteter Biografien stellt Cela seinen wabenartig konstruierten Roman zusammen – insofern ist der Titel durchaus sinnstiftend.
In Mazurca para dos muertos (Mazurka für zwei Tote) von 1983 lässt Cela in seiner galizischen Heimat noch einmal den Bürgerkrieg ausbrechen. Aus der historischen Distanz versucht der Autor keineswegs, ein authentisches Bild nachzuzeichnen, sondern er gestaltet mit Hilfe von grotesken Verzerrungen, Anleihen aus der Märchenwelt und des reichen galizischen Legendenschatzes eine moderne, prosaische Moritat.
In den 1970er Jahren schrieb Cela, der Pio Baroja als sein dichterisches Vorbild nennt: »Ich halte mich für den bedeutendsten spanischen Romancier seit der 98er Generation, und es erschreckt mich, zu bedenken, wie wenig dazu gehört hat. Ich bitte gütigst zu verzeihen, dass ich es nicht vermeiden konnte.«
Als ihm die Technische Universität Dresden 1995 die Ehrendoktorwürde verlieh, hieß es in der Laudatio des Rektors: »Ein Intellektueller von höchstem Rang soll heute geehrt werden, dessen schriftstellerisches Werk schon heute zur Weltliteratur dieses Jahrhunderts gehört und das zu erschließen und zu erobern dem deutschen Sprachraum erst noch bevorsteht.«
Camilo José Cela, der 1996 vom spanischen König den Adelstitel Marqués de Iria Flavia verliehen bekam, der begnadete Erzähler, der sich selbst mit der Attitüde des zur Eitelkeit neigenden Dichterfürsten schmückte, der zeitlebens ob seiner politischen Äußerungen streitbar und umstritten war, ist am 17. Januar 2002 in einem Madrider Krankenhaus im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Grippe gestorben.
| PETER MOHR
| Titelbild: ÁWá