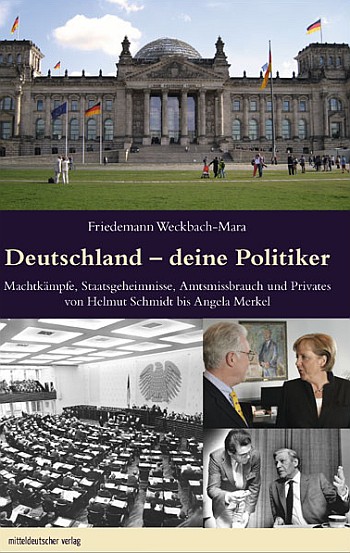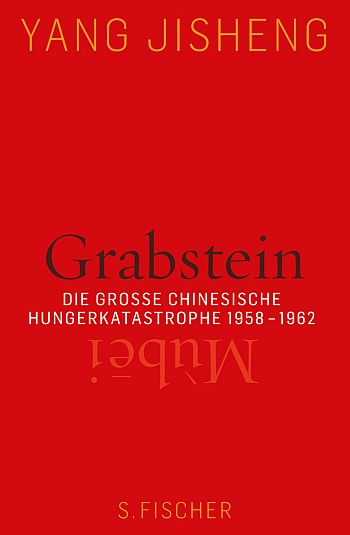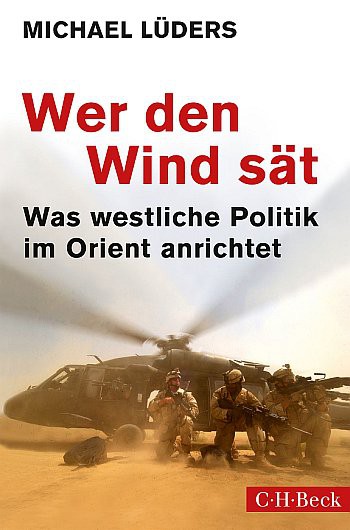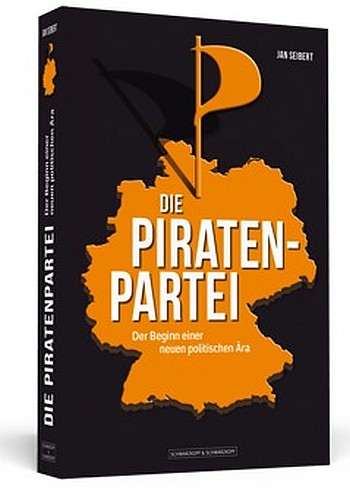Gesellschaft | Roger Schawinski: Der Allergrößte. Warum Narzissten scheitern
… und dann nicht mal wissen (wollen), was das genau ist. Wer mitansehen will, wie prompt das in die Hose geht, greife zum neuesten Buch von Roger Schawinski, ›Ich bin der Allergrößte. Warum Narzissten scheitern‹. Alle anderen amüsieren sich über einen weiteren Fall von Copy&Paste-»Literatur«. Von PIEKE BIERMANN
 Roger Schawinski ist ein Schweizer Medienjongleur, in Deutschland vor allem durch Harald Schmidt bekannt. Als der ihn 2003 vom Kirch-Nachfolger Haim Saban als neuen Sat 1-Chef vor die Nase gesetzt bekam, spotteten er und sein Sidekick Andrack: »Er tummelt sich so überall, ist mal hier, mal da. Kennst Du Herrn Schawinski?« – »Nee. Du?« Irgendein Adabei also, ein Nobody, von dem der Sender nicht mal ein Foto hatte und von dem vor allem der Schmidtsch verhaspelte Name Scha-wa-wa-winski im Gedächtnis blieb. Schawinski stieg bald wieder aus bei Sat1 und später unter anderem ein beim feinen, mittelkleinen Zürcher Verlag ›Kein & Aber‹. Dort veröffentlichte er zwei Bücher, unter anderem eine Autobiografie, bevor er auch dort 2014 wieder ausstieg. Trotzdem erschien dort soeben sein neuestes Buch ›Ich bin der Allergrößte. Warum Narzissten scheitern‹.
Roger Schawinski ist ein Schweizer Medienjongleur, in Deutschland vor allem durch Harald Schmidt bekannt. Als der ihn 2003 vom Kirch-Nachfolger Haim Saban als neuen Sat 1-Chef vor die Nase gesetzt bekam, spotteten er und sein Sidekick Andrack: »Er tummelt sich so überall, ist mal hier, mal da. Kennst Du Herrn Schawinski?« – »Nee. Du?« Irgendein Adabei also, ein Nobody, von dem der Sender nicht mal ein Foto hatte und von dem vor allem der Schmidtsch verhaspelte Name Scha-wa-wa-winski im Gedächtnis blieb. Schawinski stieg bald wieder aus bei Sat1 und später unter anderem ein beim feinen, mittelkleinen Zürcher Verlag ›Kein & Aber‹. Dort veröffentlichte er zwei Bücher, unter anderem eine Autobiografie, bevor er auch dort 2014 wieder ausstieg. Trotzdem erschien dort soeben sein neuestes Buch ›Ich bin der Allergrößte. Warum Narzissten scheitern‹.
Eigentor I
Der aparte Titel ist rasch erklärt: der normale Superlativ war schon vergeben – das Attribut »Der Größte« steht ein für allemal dem jüngst verstorbenen Muhammad Ali zu. Eine mögliche Alternative: »Ziemlich größte Loser« hätte zwar schön boulevardig-knackig geklungen, aber auch irgendwie geklaut. Was bleibt einem Mann da übrig, der ein feines Gespür für Mediengängiges und einen Hang zum beliebten Männerspiel »Wer hat den größten – ähm: längsten« besitzt? Ganz klar: »Der Allergrößte«. Das Buch, laut Verlagswerbung »eine journalistische Recherche über Narzissmus und Macht«, war allerdings keine drei Tage raus, da ventilierten schon die ersten Schweizer in Kommentarspalten, ob ihr umtriebiger Landsmann nur zwei Jahre nach der ersten jetzt seine zweite Autobiographie vorlegen möchte.
Aber das ist der harmlosere Vorbehalt.
Ich und die Frauen – wir sind fein raus
»Fragen« ist ein prima Stichwort. Denn dieses Buch, das laut Untertitel eine oder womöglich mehrere Antworten geben soll, wirft vor allem Fragen auf. Zum Beispiel: Was haben Lance Armstrong, Sepp Blatter, Joe Ackermann, Franz Beckenbauer, Jörg Kachelmann, Steve Jobs, Thomas Middelhoff, Daniel Vasella, Marcel Ospel, Rico Hächler, El Chapo, Pablo Escobar und David Petraeus gemein? Das heißt, außer dass Schawinski bei allen auf »Narzissmus« erkennt und ihn die bange Frage umtreibt, ob er auch »so einer« ist:
»Die Recherchen und das Erstellen der Porträts führten bei mir zur Introspektion. Ich stellte mir laufend die Frage, ob es sich um Verhaltensweisen handelt, die bis zu einem gewissen Grad auch bei mir festzustellen sind oder waren. Wäre ich dann tatsächlich in der Lage, sie als solche zu erkennen? Habe ich mein Auftreten aufgrund der intensiven Beschäftigung mit dem Thema verändert? Das kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Aber ich hoffe, mich besser und früher selbst zu ertappen, wenn ich in gewissen Situationen extrem narzisstische Verhaltensweisen zeigen sollte.«
Soviel zartfühlender Konditionalis! Das klingt nach demütigem Psycho-Workshop-Sprech und entlarvt doch nur, ungewollt vermutlich, dass die an sich selbst gestellte bange Frage bloß rhetorisch war. Eine »narzisstische Verhaltensweise«, bei der er sich durchaus nicht »ertappen« mag. Aber wie auch? Sie beruht schließlich auf einem soliden Überzeugungsfundament: Ich kann gar kein Narzisst sein, ich bin ja nicht gescheitert. Ähnlich scheinbar gefühlvoll lässt er eine zweite eventuell auftauchende, unangenehme Frage abperlen: warum kommt bei ihm eigentlich keine einzige Frau vor? Ach, er kann’s ja nicht ändern, »narzisstische Tendenzen« würden eben durch »die traditionell männlichen Instinkte – Macht, Aggression und Hunger nach Bewunderung« verstärkt, zumindest »vermutet man« das. Am Rest sind Frauen selbst schuld: da sie sich nun mal »nur selten in Führungspositionen vorkämpfen und Hybris bei ihnen grundsätzlich weniger häufig auftritt, sind sie in diesem Buch (leider) nicht vertreten.«
Man(n) kennt sich
Lassen wir das mal so stehen, vergessen wir gläserne Decken und historisch belegten weiblichen Größenwahn. Bleibt die Frage: wieso diese Männer? Nun, bei vielen gilt: Man(n) kennt sich. Schawinski ist nicht nur seit Jahrzehnten selbst im medialen Celebrity-Business, unter anderem als Dauergastgeber diverser Talkshows; das Promi-Personal der Schweiz ist relativ überschaubar; und ausländische Granden kommen gern ins Land von Sport-Mafia & Bankenmacht. Selbstverständlich kennt er den FIFA-Boss, den Wetterfrosch mit dem überbordenden Sexleben, den einst bestbezahlten Pharma-Chef der Welt, den Ex-Boss des größten Zürcher Verlags, den Banker, der dann doch kein Master of the Universe wurde, sondern als Master of Desaster erst die Swissair, dann seine eigene Union Banque Suisse und letztlich das Schweizer Bankgeheimnis geschreddert hat.
Mit den meisten hat Schawinski selbst schöne Geschäfte gemacht, ohne an deren krimineller Energie Anstoß zu nehmen. Andere hat er bewundert – das chemiegestützte Fahrradgenie, zum Beispiel, oder den teflonbeschichteten Fußballkaiser. Dass das Steve-Jobs-»Porträt« vor allem vom Silicon Valley berichtet, mag daran liegen, dass Jobs früh genug gestorben ist. Warum er sich ausgerechnet Harald Schmidt nicht vorknöpft – den er selbst als »parasitär« und »geldgeil« beschimpft hatte und von dem zumindest hierzulande viele meinen, Narziss sei sein zweiter Vorname –, das öffnet Räume für schöne Spekulationen. Die banalsten haben mit Angst zu tun.
Sinn & Form
Nächste Frage: Was ist eigentlich Narzissmus für Schawinski? Man weiß es nicht, er bietet dazu ein Kuddelmuddel aus einschlägigen Adjek- und Substantiven auf: von charismatisch-brillant-gutaussehend über macht- und geldgeil bis manipulativ-opportunistisch-intrigant, von Selbstüberschätzung über fehlende Bodenhaftung bis Mangel an Empathie. Ohne sich um irgendeine Trennschärfe oder sonstige Präzision zu bemühen. Die »theoretisch« genannten Kapitel sind inhaltlich schlicht subdiskutabel und stilistisch seltsam holperig. Irgendwie klingt da vieles wie amazon-Kundenrezensionen oder – Wikipedia-Beiträge?
Das ist die nicht mehr so harmlose Frage, die allerdings ist inzwischen beantwortet:
Eigentor II
Der Zürcher ›Tagesanzeiger‹ hat Roger Schawinski Plagiate en gros nachgewiesen – er hat tatsächlich wortwörtlich abgeschrieben, bei Wikipedia, bei Journalistenkollegen von ›ZEIT‹ bis ›SPIEGEL‹, aus Sachbüchern. Bei letzteren erwähnt er immerhin gelegentlich Autor und Titel. Damit wird sein Versuch, auch der eventuell drohenden Frage nach seinen Quellen vorab ironisch den Wind aus den Segeln zu nehmen, zur peinlichen Pointe. Er sei ja nur ein »Journalist ohne vertiefte psychologische Vorkenntnisse«, schreibt er, und habe »das mir vertraute Vorgehen« gewählt, nämlich wie »unsere fernen Vorfahren als Jäger und Sammler« zur Erkenntnis zu gelangen. »Oder, um es etwas weniger freundlich zu formulieren, als konsequent handelnde Parasiten, die in möglichst effizienter Weise langjähriges und detailliertes Experten- und Insiderwissen von Dritten absaugen.«
Ein Parasit, der Parasiten Parasiten schimpft?
Bleibt eine letzte, womöglich die ungemütlichste Frage, denn sie betrifft nicht bloß ein einzelnes Buch, sondern die Qualität heutigen Büchermachens: Warum nur, warum macht ein Verlag, der so gute – auch »journalistische« – Schreiber wie Truman Capote, Miriam Meckel, Niklaus Meienberg, Gay Talese im Programm hat, eine Schluderschrift, die womöglich bald eingestampft werden muss?
Titelangaben
Roger Schawinski: Der Allergrößte. Warum Narzissten scheitern
Zürich: Kein & Aber 2016
224 Seiten, 20 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Eine frühere Fassung erschien am 25. Juni 2016 im Deutschlandradio Kultur
| Andreas Toblers Recherche im Tagesanzeiger zu den Plagiaten steht hier