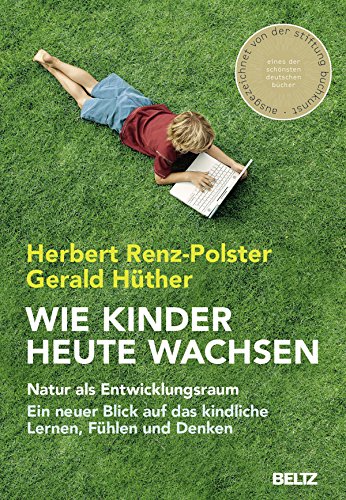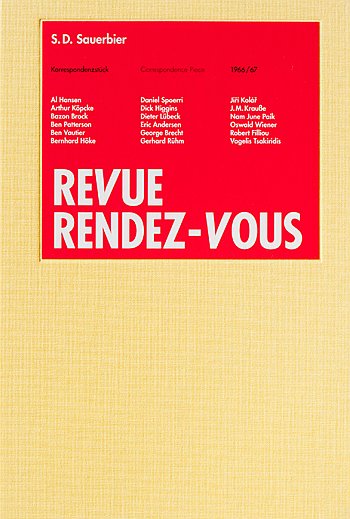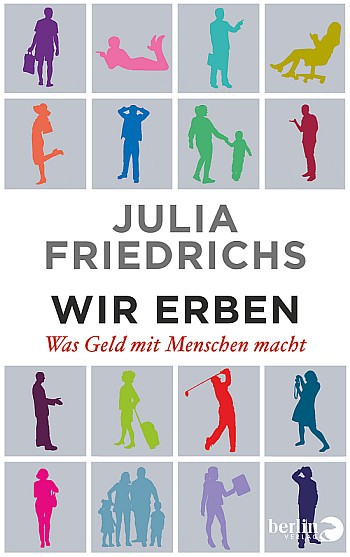Gesellschaft | Florian Schwinn: Tödliche Freundschaft
Haben wir einmal darüber nachgedacht, unter welchen Stress wir uns setzen, solange wir die Krone der Schöpfung geben wollen? Der Mensch muss sich nicht ununterbrochen beweisen, er verantwortet nicht die Organisation der natürlichen Abläufe, er muss sich nicht einmischen, er steht nicht in der Pflicht, zu verbessern, die Natur regelt ihre Existenz gern ohne sein Zutun. Von WOLF SENFF
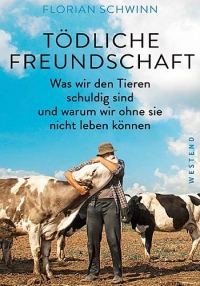 Die Natur – wie übrigens der gesamte Planet – kamen zurecht, bevor der Mensch sich zu ihrem Eigentümer ausrief, und sie werden weiterhin zurechtkommen, sobald das letzte Exemplar der Spezies die ewigen Jagdgründe aufgesucht hat.
Die Natur – wie übrigens der gesamte Planet – kamen zurecht, bevor der Mensch sich zu ihrem Eigentümer ausrief, und sie werden weiterhin zurechtkommen, sobald das letzte Exemplar der Spezies die ewigen Jagdgründe aufgesucht hat.
Blutrünstige Schlagzeilen
Sei’s drum. Noch dürfen wir über unsere Existenz auf diesem Planeten nachdenken, und Florian Schwinn ist eine der Stimmen, die sich nicht zu Eigentümern der Natur erklären, über sie herrschen wollen oder sie ausbeuten. Klug umgeht er die zwanghaft anthropozentrisch angelegte Evolutionstheorie und zeigt am Beispiel, wie erfolgreich ein gleichberechtigtes Miteinander verschiedener Arten sein kann.
Keine Gewinner, keine Eroberer, keine Helden, keine Herrscher, keine Panzerarmeen, homo homini lupus adieu, Flitzebogen adieu, Ritterrüstung verschrotten, die opulenten Schlachten in ›Herr der Ringe‹ gelöscht, und sowieso: Gab es nicht sogar Stimmen, die den Einsturz des ›World Trade Center‹ ein ästhetisches Erlebnis nannten? Unsere Aufgeregtheit, all die so fesselnd blutrünstigen Schlagzeilen während der gnadenlosen Jagd auf Saddam Hussein, auf Osama Bin Laden, auf Muammar al Gaddafi – damit soll Schluss sein?
Mensch und Wolf
Nun denn. Vielleicht bleibt uns das erhalten, einiges spricht ja dafür. Aber Florian Schwinn rüttelt an den Fundamenten, das ist unübersehbar, und es ist lobenswert. Hund, Schwein, Kuh, Huhn sind seine Beispiele, an denen er uns die ›Tödliche Freundschaft‹ anschaulich ausmalt, seine Beispiele sind keine Exoten, sondern stehen dem Menschen nahe.
Er schildert einen Prozess der Ko-Evolution von Mensch und Wolf, aus dem der Hund entstand, zunächst als ein für bestimmte Aufgaben gezüchteter Begleiter auf dem Hof, bei der Tierhaltung, bei der Jagd, heutzutage aber vorwiegend instrumentalisiert für die Bewegungs- und Sozialtherapie des Hundehalters. Der Mensch als »Krone der Schöpfung«?
Dreißig-Liter-Turbokuh
Auch für die Schweine gilt das Prinzip ›Tödliche Freundschaft‹. Florian Schwinn beschreibt einzelne, leider nur sehr seltene Höfe, deren Schweine in sogenannten Hutewäldern leben, in denen sie sich das Jahr über weitgehend selbst versorgen; wir lernen das Schwein in natürlichem Umfeld kennen, »neugierig, kontaktfreudig, schmusebedürftig«, ein hochintelligentes Tier mit Charakter. Der Gegensatz zu den industriellen Fleischproduktionsanlagen der Schweinehaltung kann krasser nicht sein, die Schilderung dieser Betriebe ist erschütternd.
Schwinn weist immer wieder darauf hin, dass real auch Alternativen zur Industrialisierung landwirtschaftlicher Abläufe bestehen, das gilt auch für das Rind, und hier zeigt sich, dass die Mechanismen selbst kontraproduktiv sind, etwa was die durchschnittliche Lebensdauer betrifft: eine Turbokuh mit durchschnittlich dreißig Litern am Tag gebe maximal vier Jahre lang Milch, bevor sie zum Schlachthof abgeliefert werde, sie habe dreimal gekalbt und erreiche ein Alter von sechs, vielleicht sieben Jahren.
Von runden Köpfen
Erfahrene Landwirte jedoch wüssten, dass eine Kuh erst nach dem fünften oder sechsten Kalb die meiste Milch liefere, und stellen ihre Betriebsabläufe darauf ein; die Kühe müssen ein gesundes, zufriedenes Leben führen können, das erst sichere die Qualität der Milch. Schwinn hat Höfe besucht und beschreibt Beispiele – es geht also.
Ebenso sei es möglich, die auf ›Kraftfutter‹ aufbauende Ernährung der Kühe zu reduzieren oder gänzlich darauf zu verzichten, und zwar nachweislich zum Nutzen der Tiere und ohne negative Konsequenzen für die Erträge. Unsere Köpfe sind rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Schwinn konstatiert den Beginn eines Umdenkens.
Ein Zweinutzungshuhn
Auch seine Darstellung der Hühnerhaltung weist darauf hin, dass sich die agrarwirtschaftlichen Abläufe ändern, wenngleich zögerlich und in winzigen Schritten. Schwinns Darstellung profitiert davon, dass er wenig vom grünen Tisch aus schreibt, sondern diverse landwirtschaftliche Betriebe besucht hat; der Leser hat häufig den angenehmen Eindruck, er läse eine Reportage, der Autor sei vor Ort gewesen – was ja auch zutrifft.
Einerseits entnehmen wir einer amtlichen Untersuchung in Nordrhein-Westfalen von 2011, dass dort über neunzig Prozent der in den Verkauf gelangten Broiler mit Antibiotika belastet waren, andererseits erfahren wir von diversen Initiativen, beispielsweise einer ›Initiative Zweinutzungshuhn‹ mit mittlerweile zwanzig angeschlossenen Höfen, die zurück will zur traditionellen Form der Hühnerzucht, was u. a. bedeutet, dass Legehennen ihr Leben als Suppenhuhn beenden, anstatt zu Tiermehl verarbeitet zu werden oder in der Biogasanlage zu landen.
Regional verwurzelte Landwirtschaft
Die Schwierigkeiten, aus der industrialisierten Tierhaltung auszusteigen, sind auch beim Huhn immens, und wir staunen Bauklötze, wenn Schwinn uns die Details ausbreitet. Beispielsweise dass mit der ›Legehenne Lohmann Brown‹ ein Hybridhuhn gezüchtet sei, das überall auf dem Planeten, ob in der Wüste Negev, in Schleswig-Holstein oder an den Hängen des Himalaya, seine dreihundert Eier und mehr pro Jahr lege – ein perfekt designtes Tier, das kaum anders funktioniert als ein Cola-Automat.
Letztlich könne es nur darum gehen, sich von der kompletten Ökonomisierung des Lebens abzuwenden und das Elend der industrialisierten Landwirtschaft zu beenden. Wir wüssten längst, dass sie das Klima schädige, die Landschaft veröde, regionale Märkte zerstöre, die Böden zerstöre und das Trinkwasser verunreinige.
Bekanntlich ist es schwieriger geworden, ›links‹ und ›rechts‹ zu unterscheiden, und Florian Schwinn ist auch deshalb angenehm zu lesen, weil er pragmatisch bleibt; seine Vorschläge zielen auf eine Abkehr von industriell organisierten Abläufen, verbunden mit der Rückbesinnung auf eine regional verwurzelte Landwirtschaft. Eine Lektüre mit Gewinn.
Titelangaben
Florian Schwinn: Tödliche Freundschaft
Was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können
Frankfurt/Main: Westend 2017
320 Seiten, 24 Euro
Reinschauen
| Leseprobe