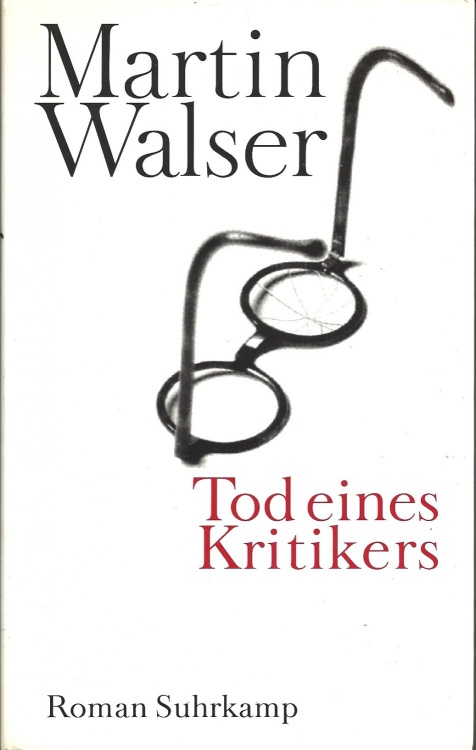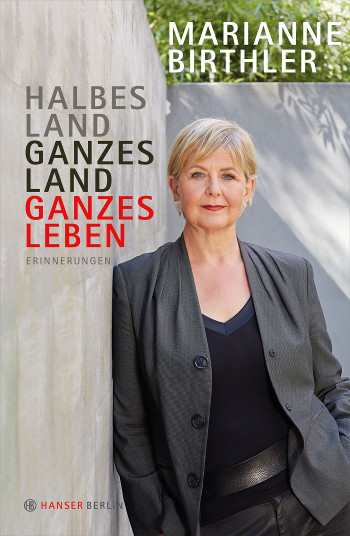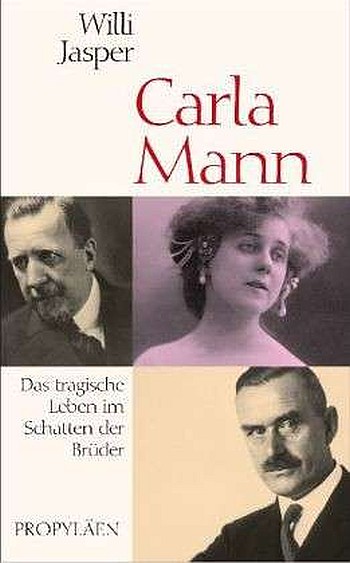Menschen | Zum Tod des israelischen Schriftstellers Aharon Appelfeld
»In den späten fünfziger Jahren gab ich meinen Wunsch auf, ein israelischer Schriftsteller zu werden. Stattdessen bemühte ich mich, das zu sein, was ich war – ein Emigrant, ein Flüchtling, ein Mensch, der das Kind der Kriegsjahre in sich trug«, erklärte Aharon Appelfeld vor einigen Jahren in einem Interview. Von PETER MOHR
 Darin steckt die ihm ureigene Mischung aus Koketterie und Understatement, denn tatsächlich war Appelfeld einer der erfolgreichsten israelischen Schriftsteller. Über 40 Bücher, die in 35 Sprachen übersetzt wurden, hat er verfasst – zuletzt sein im Herbst erschienenes Erinnerungsbuch ›Meine Eltern‹.
Darin steckt die ihm ureigene Mischung aus Koketterie und Understatement, denn tatsächlich war Appelfeld einer der erfolgreichsten israelischen Schriftsteller. Über 40 Bücher, die in 35 Sprachen übersetzt wurden, hat er verfasst – zuletzt sein im Herbst erschienenes Erinnerungsbuch ›Meine Eltern‹.
Appelfelds großes Thema war die jüdische Tragödie, die er in vielen fragmentarischen, mit schlimmen Zäsuren versehenen Lebenswegen erzählend rekonstruierte und wie Scherben wieder zusammenzusetzen versuchte. Besonders eindrucksvoll gelang ihm dies in ›Tzili‹ (1989), in dem er von einem jungen Mädchen erzählt, das von seinen Eltern getrennt wird und sich als Magd bei Bauern durchschlägt.
Aharon Appelfeld, der am 16. Februar 1932 in Zhadova (in der Nähe von Czernowitz) als Erwin Appelfeld in einer gut situierten jüdischen Familie geboren wurde, verlor als Achtjähriger seine Mutter, die von rumänischen Faschisten umgebracht wurde. Mit seinem Vater wurde er in Arbeitslager deportiert, wo er seine jüdische Identität verleugnete. »Ich war blond und blauäugig«, hat Appelfeld später erklärt, nachdem er als Küchenjunge der Roten Armee überlebt und Palästina erreicht hatte.
Die leidvollen Kindheitserinnerungen sind immer wieder in seine literarischen Werke eingeflossen. So lässt er sein Erinnerungsbuch ›Geschichte eines Lebens‹ (2005) mit einer Szene beginnen, in der er als Kind frische Erdbeeren mit Puderzucker und Sahne genießt.
Das jüdische Leben in einer multikulturellen Gesellschaft war ein weiteres zentrales Sujet in seinem umfangreichen Oeuvre. Im Gegensatz zu vielen anderen jüdischen Schriftstellern (er wurde oft mit dem ungarischen Nobelpreisträger Imre Kertész verglichen) hat sich Nelly-Sachs-Preisträger Appelfeld literarisch nie explizit mit dem Holocaust beschäftigt. Über seinen schwierigen Weg als Schriftsteller berichtete er in ›Der Mann, der nicht aufhörte zu schlafen‹ (2012) .
Appelfeld, der bis ins hohe Alter ein eigenwilliges Deutsch sprach, hat seine Werke in Iwrit verfasst, seine »Stiefmuttersprache«, wie er es nannte. Auch Stiefmütter können gute Mütter sein, ergänzte Appelfeld oft in diesem Kontext.
Der leidenschaftliche Kaffeehausbesucher Appelfeld, der von 1975 bis zu seiner Emeritierung 2001 Professor für hebräische Literatur an der Ben-Gurion-Universität gewesen ist, hat stets sein Umfeld sezierend beobachtet: »Die Leute sind arm, aber sie sind nicht arm, denn sie haben ein geistliches Leben«, konstatierte er in einem Interview vor einigen Jahren über die orthodoxen Juden aus seinem Umfeld. Trost und Lebensmut aus dem Glauben schöpfen, auch das war eine Facette aus Aharon Appelfelds Credo.
Gestern ist der große israelische Erzähler und Erinnerungskünstler in Jerusalem im Alter von 85 Jahren verstorben.
| PETER MOHR
| Abb: Jwh at Wikipedia Luxembourg, Aharon Appelfeld, Aharon Appelfeld, Rencontre et entretien Marc Rettel-003, CC BY-SA 3.0 LU
Lesetipp
Aharon Appelfeld: Meine Eltern
Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler
Berlin: Rowohlt Verlag 2017
272 Seiten, 22,95 Euro
Reinschauen
| Leseprobe