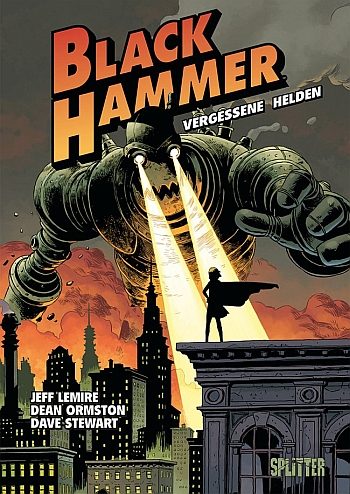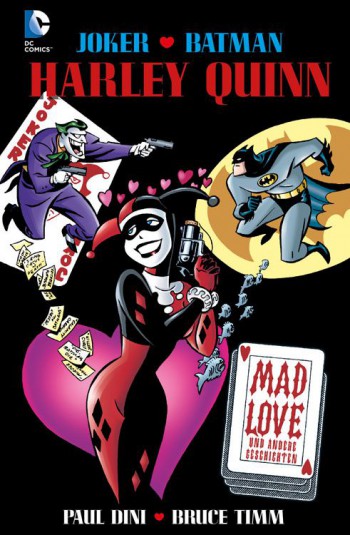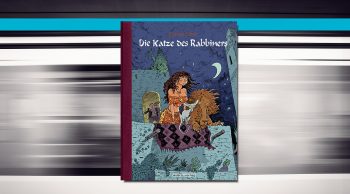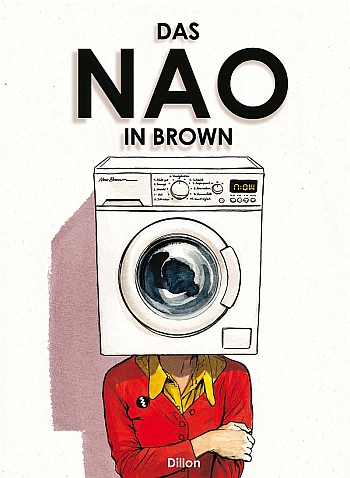Comic | J.Voloj, T.Campi: Joe Shuster. Vater der Superhelden
Die Graphic Novel ›Joe Shuster‹ bringt dem Leser den ersten Zeichner und zusammen mit ihm auch den zweiten Schöpfer des Urbilds aller Superhelden, Superman, Jerry Siegel, näher. Superman wurde gerade 80 Jahre alt. Aber Shuster und Siegel hat die weltbekannte Comicfigur kein Glück gebracht. ANDREAS ALT hat die Doppelbiografie in Comicform gelesen.
 Als Superman 1978 zu seinem bis dahin größten Triumph ansetzte, waren seine Erfinder nahezu in Vergessenheit geraten. Im Gefolge des erfolgreichen ›Star Wars‹-Spektakels kam ›Superman – Der Film‹ ins Kino. Zur Produktionsfirma Warner Brothers gehörte auch der Comicverlag DC. Der Streifen versprach, Millionen in die Kassen des Verlags zu spülen, weil viele Fans des Films nun auch anfangen würden, die ›Superman‹-Comics zu lesen. Merchandisingprodukte überschwemmten die Kaufhäuser. Aber diejenigen, die 40 Jahre vorher, 1938, den ersten ›Superman‹-Comic bei DC veröffentlichten, sollten von den Profiten keinen Cent sehen.
Als Superman 1978 zu seinem bis dahin größten Triumph ansetzte, waren seine Erfinder nahezu in Vergessenheit geraten. Im Gefolge des erfolgreichen ›Star Wars‹-Spektakels kam ›Superman – Der Film‹ ins Kino. Zur Produktionsfirma Warner Brothers gehörte auch der Comicverlag DC. Der Streifen versprach, Millionen in die Kassen des Verlags zu spülen, weil viele Fans des Films nun auch anfangen würden, die ›Superman‹-Comics zu lesen. Merchandisingprodukte überschwemmten die Kaufhäuser. Aber diejenigen, die 40 Jahre vorher, 1938, den ersten ›Superman‹-Comic bei DC veröffentlichten, sollten von den Profiten keinen Cent sehen.
Den Kampf um ihr geistiges Eigentum hatten Zeichner Joe Shuster und Autor Jerry Siegel schon lange vorher verloren. 1948 hatte der Supreme Court in New York geurteilt, ihre Comics seien »Lohnarbeit«, ihnen stehe also kein Gewinnanteil zu. Nur die Rechte an ›Superboy‹ musste DC ihnen für knapp 100 000 Dollar abkaufen. Danach konnten sie nicht mehr für den Verlag arbeiten. Vor dem Start von ›Superman – Der Film‹ wollte aber niemand bei Warner oder DC Negativschlagzeilen über die verarmten ›Superman‹-Schöpfer; Shuster und Siegel wurde nun eine Rente zugesprochen, und ihre Namen wurden ehrenhalber auf der Startseite der Comics genannt. Das war natürlich kein Ersatz für eine Gewinnbeteiligung.
Zuerst waren Shuster und Siegel Science-Fiction Fans
Der dokumentarische Comic von Julian Voloj und Thomas Campi erzählt die Geschichte noch einmal ganz von Anfang an. Shuster (1914 – 1992) stammt aus einer jüdischen Emigrantenfamilie, die in Cleveland/Ohio gelandet war. Als Außenseiter träumt sich der Jugendliche in eine phantastische Science-Fiction-Welt hinein. Als er den gleichaltrigen Jerry Siegel (gestorben 1996) kennenlernt, ebenfalls Sohn jüdischer Emigranten, geben sie zusammen eines der ersten SF-Fanzines heraus. In diesem bescheidenen Magazin erscheint 1933 erstmals eine Geschichte von ihnen mit dem Titel ›The Reign of the Super-Man‹. Der Comic hätte also mit ebenso großer Berechtigung ›Siegel und Shuster‹ heißen können, es ist nicht die Geschichte eines Einzelnen. Voloj sagt, er habe Zugang zu bisher unveröffentlichten Briefen Shusters bekommen, die einen tieferen Einblick in sein Leben erlaubten.
Shuster ist ein begabter Zeichner, Siegel schreibt Storys und versucht, die gemeinsame Arbeit zu verkaufen, wie Voloj und Campi zeigen. Mitte der 1930er Jahre machen sie aus ihrer Figur einen Comichelden, denn die Zeitungscomics boomen zu dieser Zeit, nicht allein Funnies, sondern auch Heldenepen wie ›Tarzan‹, ›Flash Gordon‹ oder ›Prince Valiant‹. Es gibt bereits zahlreiche Superhelden wie etwa Phantom, The Lone Ranger oder Doc Savage. Wohl deshalb schaffen sie es nicht, ihren ›Superman‹ bei einem Zeitungsverlag unterzubringen – es gibt schon genug ähnliches Material; die Redakteure sehen nicht, dass dieser Comic etwas anders ist. Shuster und Siegel sind nach einem Bewerbungsmarathon hocherfreut, dass der Verlag National Publications (DC) gerade Serien für Comichefte sucht. Er kauft ihnen die erste Superman-Story für 130 Dollar und unter der Bedingung ab, dass sämtliche Rechte an der Figur an den Verlag übergehen. ›Superman‹ erscheint 1938 in ›Action Comics‹ # 1 und wird sofort ein Erfolg. Siegel und Shuster, die beiden unerfahrenen 24-Jährigen, meinen, sie hätten das große Los gezogen, zumal sie bei DC eingestellt werden.
Nur wegen Superman entstehen bald Legionen von Superhelden
Vielleicht wären sie als Lohnabhängige sogar weiter zufrieden, wenn ›Superman‹ nur eine Comicfigur und allein ihr Baby bliebe. Aber schon bald gibt es ihn auch als Radio- und als Kinoserie, später auch im Fernsehen. Er ist auf der Weltausstellung in New York zu sehen, wird zur Werbefigur – kurz, er entwickelt sich zu einer umsatzträchtigen Marke. Gleichzeitig entfaltet sich das Superheldengenre bei den Comics: Das erfolgreichste Superman-Imitat ist Captain Marvel; DC selbst bringt Batman oder Wonder Woman auf den Markt, im Zweiten Weltkrieg erregt Captain America Aufsehen. Alles mehr oder weniger Superman-Imitate; die Serien verkaufen sich nur wegen seines Erfolgs – so sehen es jedenfalls Siegel und Shuster.
Wir sind nun schon im hinteren Drittel des Buchs, aber es wird deutlich gezeigt, wie die beiden zunächst mit den Verlagsoberen, Harry Donenfeld und Jack Liebowitz, in freundlicher Atmosphäre reden – die freilich zunehmend abkühlt – und dann, als sie die Rechte an Superman nicht zurückbekommen, klagen. Der Beginn, so legt es der Comic nahe, eines Jahrzehnte langen Martyriums der Superman-Erfinder bis zu ihrer zumindest teilweisen Rehabilitation im Zuge des Superman-Blockbusters 1978. Shuster muss nach dem verlorenen Prozess Pornos zeichnen, bis ihm eine Augenkrankheit seinen Beruf unmöglich macht; er wird praktisch zum Pflegefall. Siegel schreibt später für ein normales Gehalt wieder Storys für DC und wird schließlich, weil zu altmodisch, von Redakteur Mort Weisinger endgültig ausgebootet. Ironischerweise bietet ihm der Konkurrenzverlag Marvel ein Gnadenbrot als Bürobote.
Ist Shuster und Siegel Unrecht geschehen?
In diesem Jahr ist es 80 Jahre her, dass Superman in ›Action Comics‹ # 1 die Bühne der Welt betrat. Bis heute ist er eine Comic-Ikone, wenn auch von seinem dunkleren Gegenbild Batman inzwischen überflügelt. Ist das nicht eine gute Gelegenheit, sich an das traurige Schicksal von Joe Shuster und Jerry Siegel zu erinnern? Carlsen hat die Veröffentlichung von ›Joe Shuster‹ extra um ein Jahr verschoben. Doch zuvor ist zu fragen: Ist ihnen wirklich so bitteres Unrecht geschehen, wie der Comic behauptet? Die Antwort ist jedenfalls nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Dass DC sich beim Ankauf von ›Superman‹ alle Rechte sicherte, war absolut üblich, auch noch Jahrzehnte später. Damit ist der Deal natürlich nicht moralisch gerechtfertigt, aber niemand konnte den Erfolg der Figur vorhersehen. Wäre der Comic das gewesen, was er sein sollte, nämlich Füllmaterial für ein neues Comicheft, dann wäre das Honorar von 130 Euro nicht schlecht gewesen.
Dahinter steht die Frage nach dem Verhältnis zwischen Künstler und Kunstvertrieb allgemein, und die betrifft nicht nur die gesamte Comicindustrie, sondern auch Literatur, Kunst oder Musik. Roy Lichtenstein kommt hier vor als ein Gegenbeispiel, der mit – wenn man so will – abgemalten und vergrößerten Comicpanels reich wurde. Wenn der Künstler es schafft, selbst zur Marke zu werden, dann sind seine Aussichten, an seiner Schöpfung selbst kräftig mitzuverdienen, deutlich besser. Am anderen Ende der Skala stehen die schwarzen Urheber der Rockmusik, die im Vergleich zu ihren weißen Nachahmern und von einer schier allmächtigen Plattenindustrie noch viel mehr benachteiligt wurden, mit bedingt durch die strikte Rassentrennung Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA.
DC versuchte, sich den beiden gegenüber erkenntlich zu zeigen
Wie wäre es im Fall von ›Superman‹ richtig gewesen? Hätten Siegel und Shuster das Projekt von Anfang an in den eigenen Händen behalten, so wäre es sehr zweifelhaft, ob ihre Comics überhaupt zu einem großen Erfolg geworden wären. Ihnen fehlten die Mittel, um einen US-weiten Comic-Vertrieb auf die Beine zu stellen, und auch das nötige Know-how. Hätten sie sich auf das Geschäftliche konzentriert, dann hätten sie sicher kaum noch Zeit gehabt, neue Superman-Abenteuer zu erdenken und zu zeichnen. An weitere Verwertungsmöglichkeiten hätten sie vermutlich überhaupt nicht gedacht. Hätte DC ihnen die Überschüsse abtreten sollen, sobald die Einnahmen sprudelten? Das ist zumindest weltfremd. Man kann aber auch nicht erkennen, auch wenn eine äußerst zwielichtige Figur wie Donenfeld mitwirkte, dass der Verlag nicht versucht hätte, sich für die Leistungen Siegels und Shusters erkenntlich zu zeigen – in gewissem Rahmen freilich.

Das soll nicht heißen, dass am Schicksal dieser beiden Superhelden-Pioniere nichts auszusetzen wäre. Aber die Graphic Novel liefert keine Anhaltspunkte dafür, wo die Kritik ansetzen muss. Sie erzählt deren Lebensgeschichte in betont ruhiger, ja etwas distanzierter Weise. Einerseits ist die zurückhaltende Darstellungsform angenehm. Die Grafik mit den dominierenden warmen Brauntönen in Aquarelltechnik lässt die Welt Mitte des 20. Jahrhunderts ziemlich authentisch erscheinen. Andererseits wirkt das Werk beinahe wie eine Pflichtübung. Da wird eine Geschichte erzählt, die nicht mehr unbekannt ist. Sie ist auch schon ausgedeutet: Seit der Zeit von ›Superman – Der Film‹ besteht in der comicinteressierten Öffentlichkeit Einigkeit darüber, dass Siegel und Shuster von DC übel über den Tisch gezogen wurden.
Der Fall ist entschieden. Siegel und Shuster sind schon seit mehr als 20 Jahren tot. Volojs und Campis Comic ist nicht unbedingt überflüssig, aber er bringt nichts Neues. Die Comicindustrie, jedenfalls was das Superheldengenre betrifft, ist heute anders, nicht mehr so innovativ, aber den in ihr tätigen Künstlern geht es mit Sicherheit nicht mehr so schlecht wie ihren Stammvätern.
Titelangaben
Julian Voloj (Autor), Thomas Campi (Zeichner): Joe Shuster. Vater der Superhelden.
Hamburg, Carlsen Verlag 2018
176 Seiten, 19,99 Euro.
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Die Geschichte aus Verlagssicht