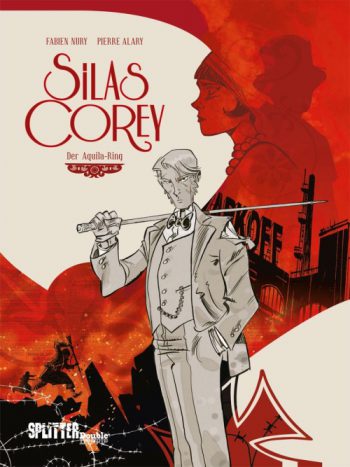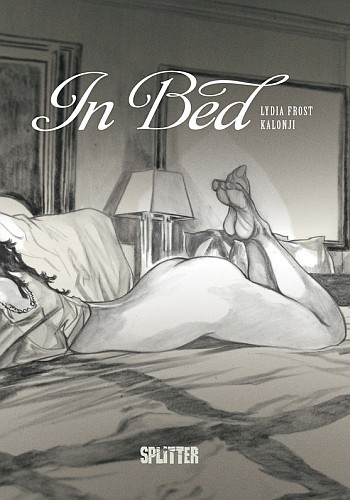In seiner ersten langen Comic-Erzählung erzählt Martin Panchaud eine tragikomisch-aberwitzige Story über einen Londoner Teenager. Indem er sich dabei optisch auf Gefilden bewegt, die eher an Planskizzen als an klassische Comics denken lassen, steckt er die Grenzen seines Mediums neu ab. Von CHRISTIAN NEUBERT
 Wer teilt sich über Piktogramme mit? Die Pikten! Asterix-Leser wissen das. Außerdem: Martin Panchaud. Sein Comic ›Die Farbe der Dinge‹ erinnert auf den ersten Blick an eine ominöse Verquickung von Kartographie und Infografik, auf den zweiten schließlich an einen Chris Ware-Comic – und beides sollte reichen, um den Band mit einem tieferen Blick zu würdigen. Zumal sich das lohnt. Denn ›Die Farbe der Dinge‹ ist ein Husarenstreich der neunten Kunst.
Wer teilt sich über Piktogramme mit? Die Pikten! Asterix-Leser wissen das. Außerdem: Martin Panchaud. Sein Comic ›Die Farbe der Dinge‹ erinnert auf den ersten Blick an eine ominöse Verquickung von Kartographie und Infografik, auf den zweiten schließlich an einen Chris Ware-Comic – und beides sollte reichen, um den Band mit einem tieferen Blick zu würdigen. Zumal sich das lohnt. Denn ›Die Farbe der Dinge‹ ist ein Husarenstreich der neunten Kunst.
Der Comic ist fast komplett aus der Vogelperspektive geschildert. Was man als Leser zu sehen bekommt, sind nicht etwa einzelne Panels, sondern grafisch arrangierte Momentaufnahmen von Orten à la Google Maps. Sie ähneln architektonischen Planskizzen, auf denen bunte Kreise darstellen, wer sich gerade wo genau befindet.
Sprechblasen gibt es keine. Stattdessen ordnen exakte Linien den maximal abstrahierten Figuren einzelne Dialogzeilen zu. Das war’s. Mal abgesehen von zwischendurch eingestreuten, tatsächlich infografisch aufbereiteten Seiten über die Blauwalpopulation im Nordatlantik, die Funktionsweise eines bestimmten Elektroschockpistolentyps, die Verwundbarkeit der Leber bei Faustkämpfen oder einer serienreifen, auf Thermoskannen basierenden »Muschi to go«.
Maximal abstrahiert
Aus all diesen Zutaten zimmert der schweizerische Künstler Martin Panchaud in seinem ersten langen Comic-Band ein Sozialdrama im Geiste Mike Leighs, das in einem leichtfüßigen Parforceritt durch komödiantische Gefilde und Road-Movie-Melancholie zum Krimi wird, während es eine Coming-Of-Age-Geschichte erzählt.
Im Zentrum des Comics steht Simon Hope, ein vierzehnjähriger Junge aus einem Londoner Vorort. Auf den Straßen vor seinem Elternhaus wird er von den anderen Jugendlichen gemobbt. Zu Hause erwartet ihn ein gewalttätiger Vater, der das ohnehin schon knappe Geld mit Pferdewetten verjubelt. Ein todsicherer Tipp für ein Pferderennen in Ascot verspricht schließlich den Ausbruch aus diesen jämmerlichen Verhältnissen – und Simon gewinnt tatsächlich.
Dumm nur, dass er sich dafür bei den Rücklagen seines Vaters bedienen musste. Und der wiederum seine Frau des Diebstahls bezichtigt, sie ins Koma prügelt und über alle Berge verschwindet. Noch dümmer ist da vielleicht nur, dass er als Minderjähriger die Unterschrift eines Elternteils benötigt, um den Wettschein einlösen zu können.
Mitreißend konstruiert
So etwas ist schnell zu viel des Guten – und selten gut. Im Falle von ›Die Farbe der Dinge‹ ist es richtig stark. Denn Panchaud versteht sein Handwerk. Und meistert die Fallstricke, die seiner ungewöhnlichen Erzähltechnik inhärent sind, was sich immer dann offenbart, wenn man zum Beispiel an Bauanleitungen scheitert.
Die Erzählstruktur hinter der nüchternen Optik der einzelnen Planskizzen wird bei ›Die Farbe der Dinge‹ zur ermittlungstechnischen Rekonstruktion eines Tathergangs. Eine solche ist naturgemäß sachlich und kühl. Durch mitreißende Dialoge wird sie allerdings stark emotional aufgeladen. Sie schaffen innere Eindrücke, die die zu Kreisen reduzierten Personen mit prallem Leben füllen.
›Die Farbe der Dinge‹ steckt die Grenzen seines Mediums auf originelle Weise neu ab. Für nostalgische Comic-Leser ist das sicher nicht leicht zu verdauen. ›Die Farbe der Dinge‹ sei ihnen dennoch empfohlen. Allen anderen übrigens auch.
Vor ›Die Farbe der Dinge‹ hat Martin Panchaud mit denselben erzählerischen Mitteln übrigens den Film ›Star Wars – A new Hope‹ adaptiert – online, zum Runterscrollen.
Titelangaben
Martin Panchaud: Die Farbe der Dinge
Aus dem Französischen von Christoph Schuler
Zürich: Edition Moderne 2020
224 Seiten, 35 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander