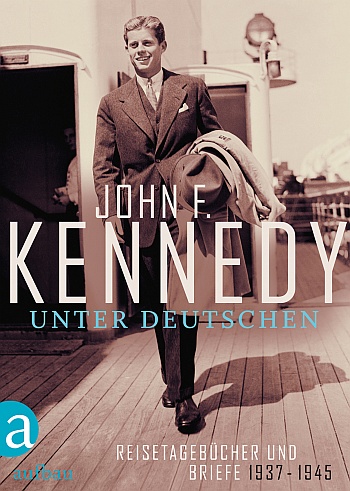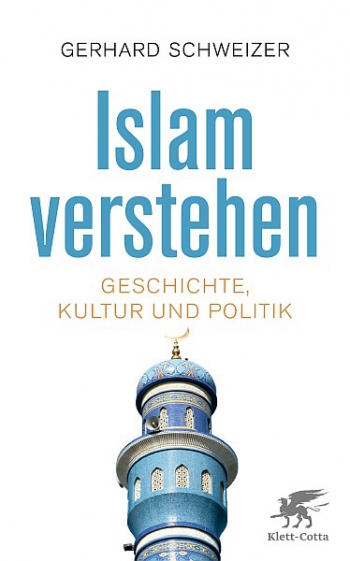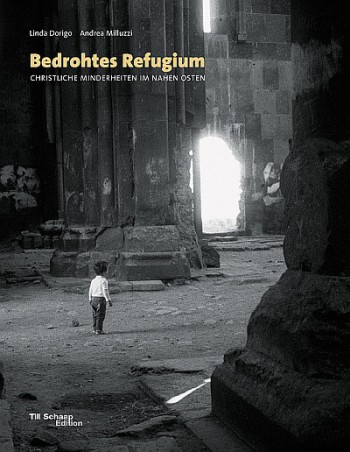Hannes Lindenmeyer: Hellmut. Die lange Geschichte einer kurzen Straße
Die Hellmutstraße bildet das Zentrum des Widerstands. Hannes Lindenmeyer, Hellmi-Aktivist der ersten Stunde, schildert das Innenleben eines Quartiers, das sich zum Ziel setzt, selbstbestimmt zu wohnen, d. h. selbst über die Bedingungen der eigenen Lebensumwelt zu entscheiden. Von WOLF SENFF
 Die Gestaltung des Lebensumfelds darf weder den Verdichtungsinteressen des städtischen Wohnungsbaus noch dem Ansiedlungskalkül von Industrieunternehmen überlassen bleiben. Wie unnachgiebig diese Gestaltungsinteressen sein können, das weiß, wer sich einmal dagegen hat wehren müssen. Wer dann allein ist, steht einsam auf weiter Flur.
Die Gestaltung des Lebensumfelds darf weder den Verdichtungsinteressen des städtischen Wohnungsbaus noch dem Ansiedlungskalkül von Industrieunternehmen überlassen bleiben. Wie unnachgiebig diese Gestaltungsinteressen sein können, das weiß, wer sich einmal dagegen hat wehren müssen. Wer dann allein ist, steht einsam auf weiter Flur.
Pulsierendes Leben im Quartier
Wir lesen gleichsam die Biographie einer Straße, wir lesen, wie sich ein Organismus formt, wie sich dessen Persönlichkeit ausbildet, sich verändert, etwa wenn die Handwerksmeister nicht länger Stammgäste im ›Pflug‹ sind und neuerdings die von der WG im Blauen Haus dort verkehren – gewiss, das ist wichtig für die Biographie einer Nachbarschaft oder besser sagen wir Kiez, auch Quartier.
Oder wenn wir lesen, dass sich um Carmelo Meo, aus Sizilien zugewandert, Rennfahrer und Velorahmenbauer, eine Veloclique sammelt, die sich auf Urlaubstour nach Südfrankreich dazu hinreißen lässt, sich in Aussicht auf ein Velo-Rennen spontan zur ACRA zu erklären: Association des Cyclistes Revolutionnaires d’Aussersihl. Das klingt nach höchst lebendiger Kiez-Atmosphäre, nach Lebensqualität.
Gentrifizierung und Widerstand
Es geht in Hannes Lindenmeyers »Hellmut. Die lange Geschichte einer kurzen Straße« um Aussersihl, einen Stadtteil Zürichs – Stadtkreis 4 – mit spezieller eigener Historie, eingemeindet 1893 und seitdem mit verschärftem Eigenprofil wahrgenommen. Schon seit jeher war das Gebiet Aussersihl eine Region, in die die Stadt die weniger angenehmen Dinge auslagerte. Das Siechenhaus, der Hinrichtungsplatz, der Galgenhügel – und Abfall und Abwasser wurden in Aussersihl genauso entsorgt wie die Tierkadaver. Später kamen die Fremdarbeiter, das Rotlichtmilieu und Jenische, die den Kreis bis heute prägen.
Seit den siebziger Jahren zogen der günstige Wohnraum und die kulturelle Vielfalt vermehrt Studenten, junge Akademiker, Künstler und Galerien an, was den Kreis 4, zusammen mit aufwertenden Projekten der Stadt, auch für die etablierte Bevölkerung attraktiv machte, und mit der wachsenden Beliebtheit stiegen die Mieten. Die Gentrifizierung setzte ein und der Widerstand gegen sie, Zentrum des Widerstands sind die Bewohner der Hellmutstraße.
Erfolge und Rückschläge
Wir kennen das aus anderen Städten, etwa dem Wohnprojekt Christiania in Kopenhagen, aus der Hafenstraße Hamburg, und wer kurz nachblättert, findet auf Anhieb Informationen zu Hausbesetzungen in Spanien, zu Wohnungsnot in San Francisco, zu Wohnungsbesetzungen in Berlin, es gab, man höre und staune, Wohnungsbesetzungen in der DDR, es gab Mieterstreiks im Berlin der Zwanziger Jahre – letztlich also wenig Neues, wenn wir die Fakten betrachten.
Neu wäre allenfalls, wenn dem Mietwucher seitens der Politik wirksame Grenzen gesetzt würden, und hier und dort findet sich tatsächlich auch das, die bewegte Geschichte der Hellmutstraße ist ein lebendiges Beispiel.
Hannes Lindenmeyer verzeichnet die Erfolge des Widerstands, jedoch auch die Rückschläge, und vor allem konzentriert er seine Darstellung auf das Innenleben, die atmosphärischen Details, an denen ein entspanntes Miteinander der Anwohner der Hellmutstraße kenntlich wird, ein überwiegend entspanntes Miteinander. Halt wie im richtigen Leben. Eine durchweg entspannt zu lesende Lektüre.
Titelangaben
Hannes Lindenmeyer: Hellmut
Die lange Geschichte einer kurzen Straße
Zürich: Rotpunktverlag 2018
256 Seiten, 37 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe