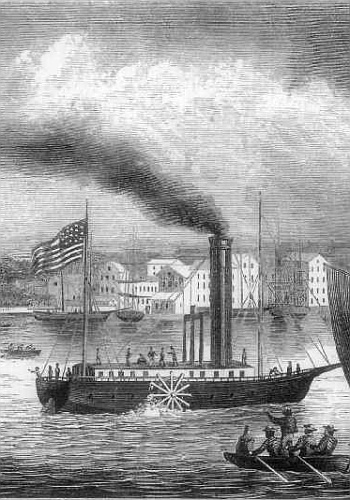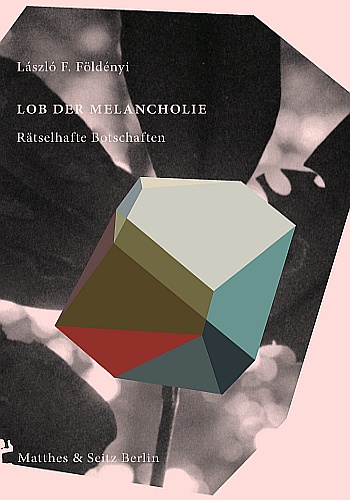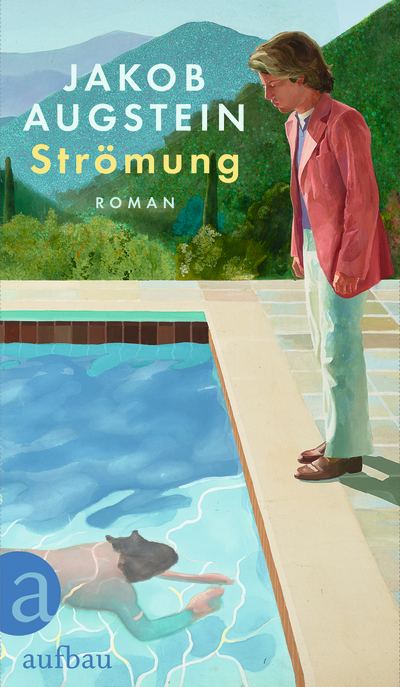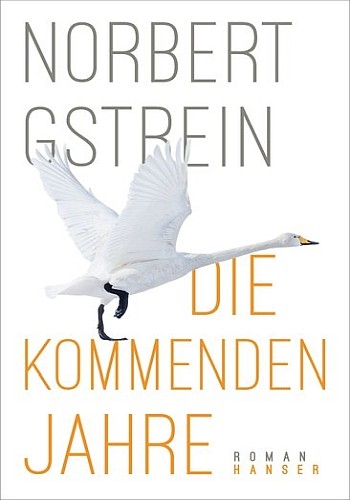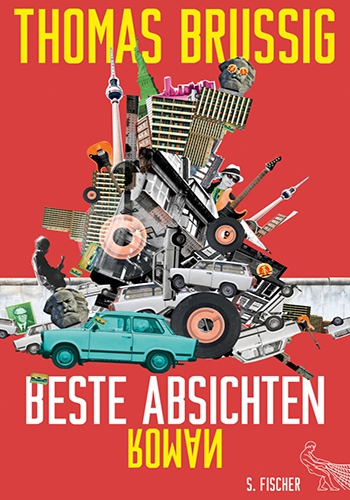Roman | Fernando Aramburu: Langsame Jahre
Viele Schriftstellerbiografien könnten auch als reizvoller Romanstoff taugen. So auch die des wichtigsten zeitgenössischen baskischen Schriftstellers Fernando Aramburu, der seit 35 Jahren in Hannover lebt, aber literarisch immer wieder zu seinen Wurzeln ins Baskenland zurück kehrt. Fernando Aramburus Langsame Jahre gelesen von PETER MOHR
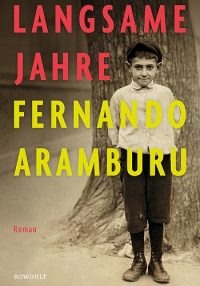 Der 60-Jährige Autor, dessen Bestseller-Roman Patria (2016) in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt wurde, hat die Beschreibung des baskischen Lebensgefühls zu seinem großen Thema gemacht. Im nun vorliegenden, bereits 2012 im Original erschienenen schmalen Roman Langsame Jahre bedient sich Aramburu eines geschickten Kunstgriffs. Er stellt den Erinnerungen eines kleinen Jungen die reflektierenden Notizen eines Schriftstellers gegenüber.
Der 60-Jährige Autor, dessen Bestseller-Roman Patria (2016) in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt wurde, hat die Beschreibung des baskischen Lebensgefühls zu seinem großen Thema gemacht. Im nun vorliegenden, bereits 2012 im Original erschienenen schmalen Roman Langsame Jahre bedient sich Aramburu eines geschickten Kunstgriffs. Er stellt den Erinnerungen eines kleinen Jungen die reflektierenden Notizen eines Schriftstellers gegenüber.
Im Mittelpunkt der zwischen 1968 und 1978 in San Sebastián angesiedelten Handlung steht ein kleiner Junge, der aus bitterarmen ländlichen Verhältnissen stammt und von seiner Mutter zur Pflege in die Familie ihrer Schwester gegeben wird.
»Was willst denn du Scheißer aus Navarro hier?« Mit diesen, alles andere als freundlichen Worten wird er von seinem deutlich älteren Cousin Julen, der später seine wichtigste Bezugsperson wird, an einer Busstation empfangen. Der lange Fußmarsch im Nieselregen durch die fremde Stadt wird schon zur Tortur. Dem kleinen Neuankömmling fällt sofort die fast völlige Sprachlosigkeit in der Familie auf, zu der neben Cousin Julen, der blasse, zumeist schweigende Onkel Vicente, die autoritäre, aber herzliche Tante Maripuy und die leicht lasziv gezeichnete Cousine Mari Nieves gehören.
»Txiki«, wie der Junge bald von seinem Cousin genannt wird, fühlt sich fremd und eingeengt in der »neuen Familie«, wird immer wieder – meistens von Julen – auf seine Herkunft aus Navorro angesprochen und damit zum Basken »zweiter Klasse« abgestempelt. Für einen Jungen im Grundschulalter eine tonnenschwere Bürde.
Hin und wieder flieht er in seine Fantasiewelt, spielt mit Würfeln und kleinen Radrennfahrerfiguren und simuliert so die großen Profiradrennen der Welt. Dies sind aber nur sehr kurze Phasen des Glücks, ansonsten dominiert in »Txikis« Wahrnehmung ein Gefühl der Fremdheit und der Andersartigkeit. Er kommt nicht in den Schlaf, weil er sich ein Zimmer mit Julen teilen muss und sich vor dessen »Käsefüße« ebenso ekelt wie vor dem Qualm der letzten Abendzigarette. Oft schluchzt er in sich hinein und sucht Schutz unter der Bettdecke. »Wärst du ein Baske, würdest du nicht weinen. Hast du schon einmal Eisen weinen sehen?«, entgegnet ihm sein Cousin Julen barsch.
Julens überbordender Patriotismus scheint »Txiki« förmlich zu erschlagen. Das exaltierte baskische »Lebensgefühl« wird vom Pfarrer Don Victoriano zusätzlich angestachelt. Er zieht mit einer Gruppe Jugendlicher in die Berge vor der Stadt und zelebriert dort mit der »Ikurrina« (die baskische Flagge) kultisch anmutende Feiern – bevorzugt im »Euskera«, die baskische Sprache, die damals noch von rund 25 Prozent der Menschen im Baskenland gesprochen wurde.
Die Separationsbestrebungen und der baskische Nationalismus gewinnen eine gefährliche Eigendynamik – trotz der drohenden, alltäglichen Gegengewalt des Franco-Regimes. Und mittendrin befindet sich der kleine »Txiki«, von der eigenen Familie getrennt und von seinen Eltern »spanisch erzogen«.
Fernando Aramburu hat sich mit dieser geschickt gewählten Erzählperspektive sämtliche Türen offen gehalten. Der Blick des naiven, verständnislosen und überforderten Kindes öffnet für den Leser ungeahnte Tiefen und lässt uns auf höchst emotionale Weise teilhaben am langsamen (und durchaus tragischen) Zerfall einer Familie. Cousine Mari Nieves wird schwanger, für ihre streng gläubige Mutter Maripuy eine »Katastrophe«, Cousin Julen, der vor »Txiki« prahlte (»ich werde in die Geschichte eingehen als der Kämpfer, der Franco getötet hat.«) geht in den politischen Widerstand, und seine Spuren verlieren sich in Frankreich.
In den begleitenden, kommentierenden Notaten des Romans schrieb Aramburu, dass er »zuerst Literatur und dann, wenn möglich, die Wahrheit« anstrebe. Beides ist ihm gelungen – auf unprätenziöse, bedächtige und einfühlsame Weise. Langsame Jahre ist ein zarter Roman voller Menschlichkeit, der zwischen Fanatismus (Julen), Religion (Tante Maripuy), Lust (Cousine Marie Nieves) und Frust (Onkel Vicente) changiert. Ein Buch, das behutsam Brücken schlagen will und das aufgrund der politischen Entwicklungen in Katalonien immer noch höchst aktuell ist.
Titelangaben
Fernando Aramburu: Langsame Jahre
Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen
Reinbek: Rowohlt Verlag 2019
200 Seiten, 20 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen| Leseprobe