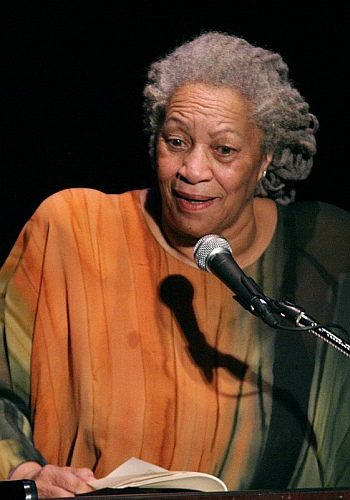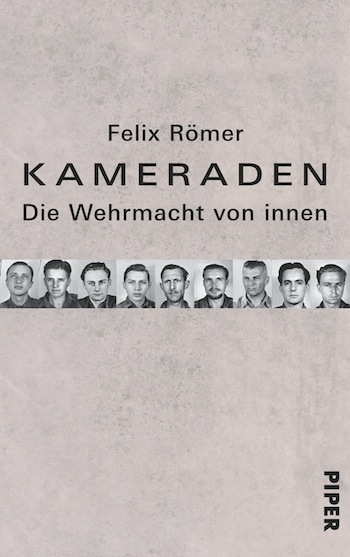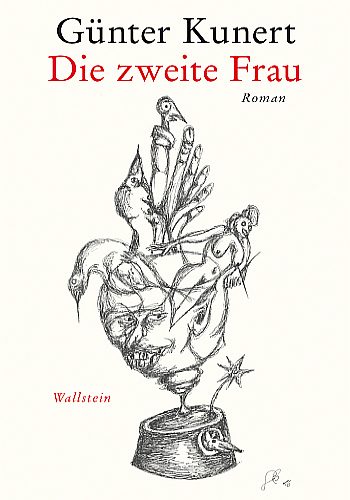Essays | Peter Schneider: Denken mit dem eigenen Kopf
»Wer sagt, er habe ich noch nie geirrt, hat viele Gelegenheiten verpasst, klüger zu werden«, heißt es in Peter Schneiders neuem Essayband ›Denken mit dem eigenen Kopf‹. Er mag sich im Laufe seines Lebens auch geirrt haben, klüger ist er auf jeden Fall geworden. Der einstige jugendliche Rebell ist nämlich nicht nur älter, sondern auch weiser geworden. Bedächtig, geradezu altersmilde lesen sich viele jüngere Schriften aus Peter Schneiders leuchtend rotem Band. Von PETER MOHR
 In den 1960er Jahren gehörte er nicht nur als Redenschreiber zum Wahlkampfteam von Willy Brandt, sondern er war auch eine der lautstärksten und einflussreichsten Stimmen in der Berliner Studentenbewegung. Er blickt heute unsentimental auf die wilde »68er-Zeit« zurück, räumt aber ein, dass sie äußerst wichtig war für das politische Bewusstsein in der Bundesrepublik, weil sie es geschafft hat, »diese Gesellschaft durchzurütteln und durchzuschütteln. Denn das musste einfach sein nach diesem unglaublichen Zivilisationsbruch, den das ›Dritte Reich‹ nun einmal dargestellt hat.«
In den 1960er Jahren gehörte er nicht nur als Redenschreiber zum Wahlkampfteam von Willy Brandt, sondern er war auch eine der lautstärksten und einflussreichsten Stimmen in der Berliner Studentenbewegung. Er blickt heute unsentimental auf die wilde »68er-Zeit« zurück, räumt aber ein, dass sie äußerst wichtig war für das politische Bewusstsein in der Bundesrepublik, weil sie es geschafft hat, »diese Gesellschaft durchzurütteln und durchzuschütteln. Denn das musste einfach sein nach diesem unglaublichen Zivilisationsbruch, den das ›Dritte Reich‹ nun einmal dargestellt hat.«
Als er sich 1973 in Berlin als Studienreferendar bewarb, wurde der »Verfassungsfeind« für den Staatsdienst abgelehnt. Das Urteil wurde zwar drei Jahre später aufgehoben, doch da hatte Schneider längst keine Ambitionen mehr, in den Schuldienst einzutreten. Seine Erzählung ›Lenz‹, eine mit großer Leidenschaft verfasste literarische Bilanz der »wilden Jahre«, hatte ihm 1973 den schriftstellerischen Durchbruch beschert. 2008 hat er in dem Band ›Rebellion und Wahn‹, in dem er auf seine Tagebücher der Jahre 1967/68 zurückgegriffen hat, noch einmal eine kritische Bestandsaufnahme dieser turbulenten Jahre vorgenommen.
Peter Schneider, der am 21. April vor 80 Jahren in Lübeck als Sohn eines Kapellmeisters und Dirigenten geboren wurde, war stets ein politisch-engagierter Autor, ohne sich allerdings ideologisch vereinnahmen zu lassen. Mit seiner Erzählung ›Mauerspringer‹ (1982) nahm er die Ereignisse aus dem Herbst des Jahres 1989 vorweg, und sein schmaler Band ›Vati‹ (1986), in dem er den Lebensweg des KZ-Arztes Mengele rekonstruierte, löste damals eine heftige, vom ›Spiegel‹ initiierte Plagiatsdiskussion aus. Schneider, der Filmdrehbücher, Essays, Kolumnen und Theaterstücke verfasste, ist immer ein wenig gegen den Strom des politischen Zeitgeistes geschwommen. Nach den wenig spektakulären Romanen ›Paarungen‹ (1992) und ›Eduards Heimkehr‹ (1999) folgte 2005 der flott erzählte Aufsteigerroman ›Skylla‹, in dem ein Alt-68er, der später als Scheidungsanwalt Karriere machte, im Mittelpunkt steht.
 Im letzten Jahr präsentierte uns Peter Schneider noch einmal eine völlig neue literarische Facette – ein Meisterwerk der literarischen Biografie. In ›Vivaldi und seine Töchter‹ erzählt er so ungezwungen wie noch nie über den großen italienischen Komponisten, der gleichermaßen umtriebig wie ungeduldig war, der jeden Monat eine Oper oder ein Konzert schreiben wollte und der mit 15 Jahren bereits zum Priester geweiht worden war. Diese Romanbiografie liefert eine harmonische Mischung aus Fakten und Imagination, ein Genre, das Peter Härtling und Dieter Kühn einst in der Nachkriegsliteratur salonfähig gemacht haben. Ein Buch mit viel Liebe zum Detail, mit einem Höchstmaß an Einfühlungsvermögen und überdies auch noch ein stimmiges Zeitbild.
Im letzten Jahr präsentierte uns Peter Schneider noch einmal eine völlig neue literarische Facette – ein Meisterwerk der literarischen Biografie. In ›Vivaldi und seine Töchter‹ erzählt er so ungezwungen wie noch nie über den großen italienischen Komponisten, der gleichermaßen umtriebig wie ungeduldig war, der jeden Monat eine Oper oder ein Konzert schreiben wollte und der mit 15 Jahren bereits zum Priester geweiht worden war. Diese Romanbiografie liefert eine harmonische Mischung aus Fakten und Imagination, ein Genre, das Peter Härtling und Dieter Kühn einst in der Nachkriegsliteratur salonfähig gemacht haben. Ein Buch mit viel Liebe zum Detail, mit einem Höchstmaß an Einfühlungsvermögen und überdies auch noch ein stimmiges Zeitbild.
46 Jahre liegen zwischen dem Romandebüt »Lenz« und dem Vivaldi-Roman. Und heute erinnern wir uns gern an den letzten Satz von Schneiders autobiografischem Erstling: »Was Lenz denn jetzt tun wolle. ›Dableiben‹, erwiderte Lenz.« Peter Schneider ist da geblieben und hat kräftig mitgemischt – eine wichtige literarische und politische Stimme im letzten halben Jahrhundert.
Titelangaben
Peter Schneider: Denken mit dem eigenen Kopf
Essays
Köln: Kiepenheuer und Witsch Verlag 2020
357 Seiten, 22 Euro
| Leseprobe
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Peter Schneider: Vivaldi und seine Töchter
Roman
Köln: Kiepenheuer und Witsch Verlag 2019
287 Seiten, 20 Euro
| Leseprobe
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander