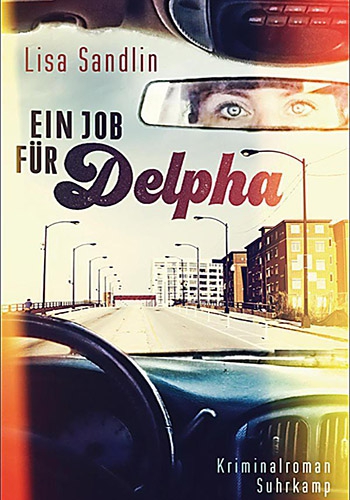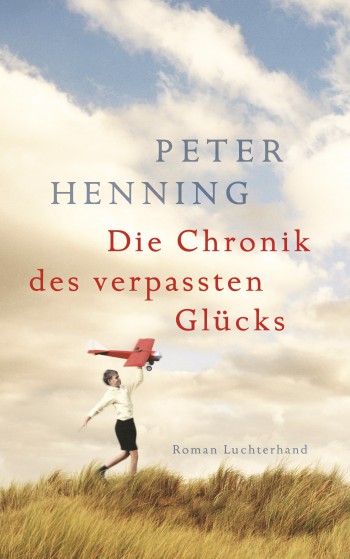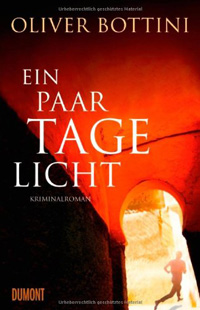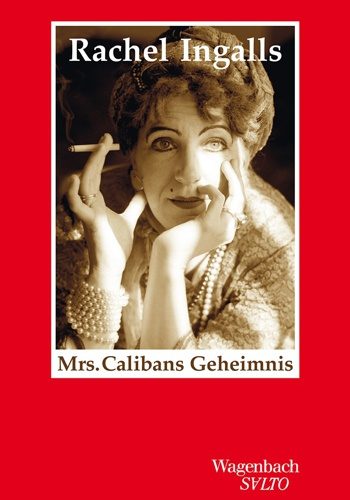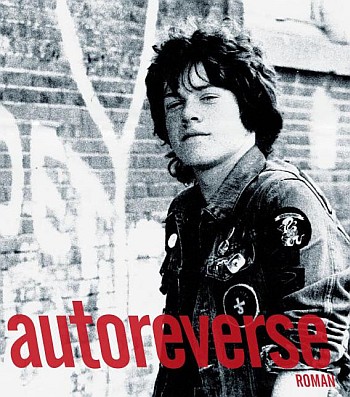Der weiße Abgrund tut sich längst vor dem sterbenskranken Heinrich Heine auf, als er mit versiegenden Kräften seine Autobiographie zu vollenden versucht. Henning Boetius hat den letzten Monaten des im Pariser Exil lebenden Dichters einen brillanten Roman gewidmet, der zur weiteren Heine-Lektüre anregt und nebenbei sehr bestechend den Zeitgeist um 1850 vermittelt. Von INGEBORG JAISER
 Paris im November 1854. Die Stadt wirkt zerfleischt wie ein ausgeweidetes Tier angesichts der radikalen Eingriffe des Stadtplaners Eugéne Haussmann. »Überall Schnitte, klaffende Wunden, herausoperierte Organe, Zerstückelungen, amputierte Gliedmaßen.« Über die aufgerissenen Straßen holpert mühsam ein offener Planwagen, der bescheidenen Hausrat transportiert – und einen auf Matratzen aufgebahrten, vor Schmerzen stöhnenden, mit Morphium vollgepumpten Kranken. Es ist der Dichter Heinrich Heine, auf dem Weg zu seinem neuen Domizil im Süden der Stadt.
Paris im November 1854. Die Stadt wirkt zerfleischt wie ein ausgeweidetes Tier angesichts der radikalen Eingriffe des Stadtplaners Eugéne Haussmann. »Überall Schnitte, klaffende Wunden, herausoperierte Organe, Zerstückelungen, amputierte Gliedmaßen.« Über die aufgerissenen Straßen holpert mühsam ein offener Planwagen, der bescheidenen Hausrat transportiert – und einen auf Matratzen aufgebahrten, vor Schmerzen stöhnenden, mit Morphium vollgepumpten Kranken. Es ist der Dichter Heinrich Heine, auf dem Weg zu seinem neuen Domizil im Süden der Stadt.
In der angemieteten Wohnung soll er endlich ein eigenes Krankenzimmer beziehen, um in Ruhe an seinem Opus Magnum, seiner umfangreichen Autobiographie schreiben zu können. Doch die Fahrt zieht sich durch die zahlreichen Baustellen so lange hin, dass sich der von Blähungen geplagte Dichter unterwegs auf dem mitgeführten Nachtstuhl erleichtern muss.
Sittengemälde der französischen Metropole
Mit dieser lebhaften, bildgewaltigen Szenerie eröffnet Henning Boëtius seinen Heinrich-Heine-Roman Der weiße Abgrund. Vor uns wird das Panorama der französischen Hauptstadt ausgebreitet, einer Metropole mitten im Umbruch, nicht nur städtebaulich, sondern auch gesellschaftlich. Oder metaphorisch ausgedrückt: »Das dritte Kaiserreich liegt wie eine Glocke über dem stinkenden Käse des Volkes.«
Wie auf einem Tableau erscheinen alle Größen der bourgeoisen Bohème, treffend charakterisiert im Kerzenlicht einer angesagten Soiree: der ekstatische Franz Liszt, die skandalumwitterte George Sand, der zwergenhafte Berlioz. Einst wurde der rebellische Exilant Heine auf dem gesellschaftlichen Parkett herumgereicht »wie ein Gegenstand, der allgemeine Neugier erweckte«. Doch eine unheilbare Krankheit hat ihn mehr als mürbe gemacht. »Körperliches Leiden macht reaktionär. Es fördert höchstens die Kreativität, aber keineswegs die Fähigkeit zu politischen Visionen.« Angesichts der neuen Entwicklung fühlt sich Heine wie ein Fossil, »dessen Reimereien nur noch ein schwaches Echo sind, zurückgeworfen vom Waldrand der Vergangenheit.«
Lebender Leichnam
Heines kümmerliches Dahinvegetieren in der »Matratzengruft« dürfte landläufig genauso bekannt sein wie seine Gedicht Loreley oder Deutschland. Ein Wintermärchen. Henning Boëtius zeichnet ein beeindruckendes Bild der letzten Lebensmonate des Dichters, der seit langem durch anhaltende Multimorbidität zur Bettlägerigkeit gezwungen wird: Kopfschmerzattacken, Lähmungserscheinungen, neurologische Ausfälle, Sehstörungen.
Halb erblindet führt Heine die Bleifeder tastend übers Papier. Mal von Verstopfung, mal von Übelkeit geplagt, erbricht er sich über die Manuskripte. »Ich kotze mein Leben aus«, denkt er und vernichtet die Papiere. Derweil flanieren Freunde und Schaulustige an seinem Bett vorbei, wie ein »Leichenzug, der hinter einem Sarg herläuft. Dabei ist er noch gar nicht tot, aber er scheint für viele so etwas wie ein interessanter lebender Leichnam zu sein«.
Letzte Liebeskomödie
Zu den Verehrerinnen der letzten Monate gehört Elise Krinitz, von Heine liebevoll »Mouche« genannt. Sie inszenieren eine bühnenreife Romanze, ja zelebrieren sie geradezu hysterisch. Schließlich ist Heine »abhängig von der Aufführung dieser kleine Liebeskomödie wie von einem opiumhaltigen Sedativum.« Dass die Krinitz das Sterben des Dichters vollends beschleunigt, mag eine Erfindung von Boëtius sein. Doch letztendlich ranken sich noch immer Legenden um das Leiden Heines. War er an Syphilis erkrankt, an Multiple Sklerose oder gar an einer Bleivergiftung? Dass sich nach seinem Tod Querelen um die nachgelassenen Schriften ergaben, ist jedoch eine verbriefte Tatsache.
Auf weniger als 200 Seiten gelingt es Henning Boëtius, ein eindrückliches Sittenbild der französischen Gesellschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu zeichnen, verdichtet auf wenige virtuos dargestellte Schlüsselszenen aus Heines letzten Lebensjahren. Gekonnt vermengt Boëtius Verbürgtes mit Erdachtem, mixt Fakten und Fiktion zu einer brillanten Romanbiographie. Als Leser fühlt man sich inmitten eines schlaglichtartig illuminierten Geschehens, bevölkert von ausdrucksvoll charakterisierten Protagonisten. Der titelgebende »weiße Abgrund« entstammt übrigens einem im Vorwort zitierten Brief an Heines Verleger Julius Campe – als allegorisches Synonym für den Tod. Doch der ist vielleicht nur »der letzte Aberglaube«.
Titelangaben
Henning Boëtius: Der weiße Abgrund
München: btb 2020
189 Seiten. 18.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe