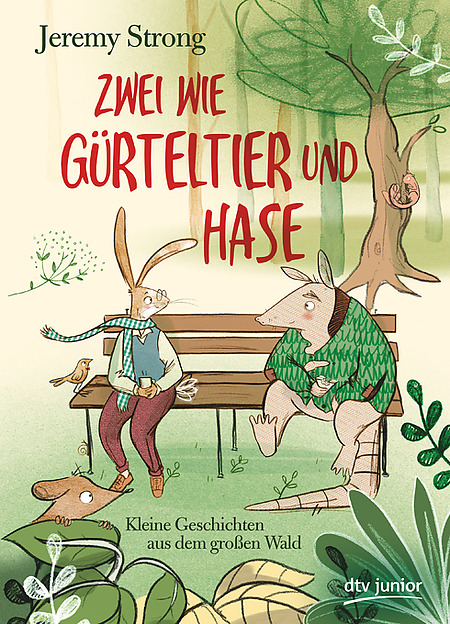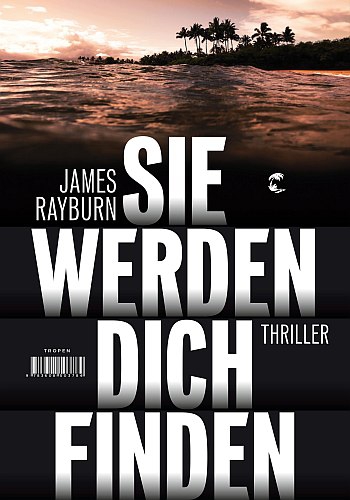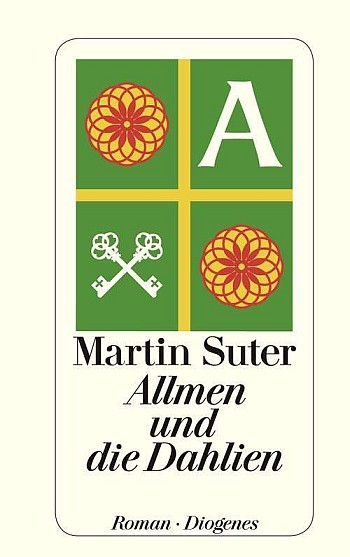Die japanische Schriftstellerin Yoko Ogawa verfasste mit Die Insel der verlorenen Erinnerung eine Dystopie, in der die Erinnerungen auf einer namenlosen Insel nach und nach verloren gehen, solange bis kaum noch etwas übrig bleibt. Damit gelingt der Autorin eine eindringliche Parabel, die vor autoritären Tendenzen und Überwachungsfantasien warnt. Von FLORIAN BIRNMEYER
 Bereits 1994 erschien Insel der verlorenen Erinnerung als »Hisoyaka na Kesshō« in Japan; doch erst 2019 wurde der Roman in englischer Übersetzung als The Memory Police und ein Jahr später in der deutschen Übersetzung von Sabine Mangold als Die Insel der verlorenen Erinnerung veröffentlicht. In diesem Zuge wurde das Buch zu einem internationalen Bestseller und zuletzt 2020 für den International Booker Prize nominiert.
Bereits 1994 erschien Insel der verlorenen Erinnerung als »Hisoyaka na Kesshō« in Japan; doch erst 2019 wurde der Roman in englischer Übersetzung als The Memory Police und ein Jahr später in der deutschen Übersetzung von Sabine Mangold als Die Insel der verlorenen Erinnerung veröffentlicht. In diesem Zuge wurde das Buch zu einem internationalen Bestseller und zuletzt 2020 für den International Booker Prize nominiert.
Die Grundzüge, Ort und Zeit der Handlung sowie die Aussage der Erzählung, erinnern an eine klassische, parabelhafte Dystopie mit abschreckender Wirkung. Ogawas Erzählung spielt nämlich zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt auf einer namenlos bleibenden Insel, deren Lage nicht näher beschrieben wird. Auch die Einwohnerinnen und Einwohner, deren Erinnerungen aufgrund der Machenschaften der sogenannten Erinnerungspolizei nach und nach verschwinden, bleiben allesamt namenlos.
Da ist einerseits die Schriftstellerin, aus deren Sicht die Geschichte in der Ich-Perspektive berichtet wird. Da ist aber auch ein alter Mann, ein ehemaliger Fährmann, der seinen Beruf nicht mehr ausüben kann (da die Erinnerung an Fähren und Schiffe verloren ging) und der der Protagonistin immer wieder zu Hilfe kommt. Da ist aber auch der Verlagslektor, der ab einem gewissen Zeitpunkt in einem Unterschlupf im Haus der Schriftstellerin versteckt werden muss, da er – wie die auf ungeklärte Weise verschwundene Mutter der Protagonistin – einer der Menschen ist, die sich an alles erinnern, auch an die eigentlich bereits verlorenen Erinnerungen.
Aufgabe der Polizisten ist es nämlich, über die Auslöschung der Erinnerungen zu wachen, da es einige Einwohnerinnen und Einwohner gibt, welche sich den Anweisungen widersetzen bzw. durch ihre Veranlagung nicht automatisch die Erinnerung an die jeweils verloren gegangene Erinnerung verlieren. Diese Gefahr für die Autorität der Erinnerungspolizei muss nach Ansicht der Institutionen natürlich ausgeschaltet werden. So hat die Mutter der Erzählerin die verschwundenen Gegenstände heimlich aufbewahrt, und der Lektor kann sich anders als die meisten Inselbewohnerinnen und -bewohner an die verlorenen Dinge erinnern, indem er damit Gedanken, Gefühle und Erlebnisse verbindet.
Den meisten Menschen auf der Insel fällt es allerdings leicht, die ausgelöschten Erinnerungen aus ihrem Gedächtnis zu verbannen. Sie bemerken es, wenn wieder eine Sache verschwunden ist, seien es die Vögel, die Rosen oder das Obst, und müssen diese Sache sowie alles damit Verbundene daraufhin aus ihrem Leben verbannen. Häufig verbrennen die Bewohnerinnen und Bewohner die Erinnerungen an das verbannte Ding nach dem Verschwinden folgsam, damit nichts übrig bleibt. Und selbst wenn sie einige Tage oder Wochen später an ein verbanntes Wort erinnert oder mit einem eigentlich verbotenen Gegenstand konfrontiert würden, könnten sie damit nichts mehr assoziieren.
Man sieht: Der Zugriff der Erinnerungspolizei auf die meisten Menschen ist allumfassend – es handelt sich um einen totalitären Überwachungs- und Polizei-Staat, der sich allerdings für die Mehrheit nicht so anfühlt. Das Parabelhafte an Ogawas Roman ist auch die große Stärke des Textes. Sie beschreibt einen totalitären Staat, in dem Überwachung und Gängelung der Bürgerinnen und Bürger durch eine diffuse Polizeimacht sowie das nicht geklärte Verschwinden von abweichenden Einwohnerinnen und Einwohnern an der Tagesordnung zu sein scheint. Damit ist der Roman eine heftige Warnung vor autoritären Tendenzen jeglicher Art in demokratischen Staaten bzw. eine Ermunterung zur freiheitlichen Demokratie.
Der Roman besteht aus zwei Erzählsträngen, die auch typographisch voneinander abgesetzt sind: Der Haupterzählstrang widmet sich vor allem dem mehr oder weniger verzweifelten Kampf gegen den Verlust der Erinnerungen, der darauf hinausläuft, dass immer mehr Erinnerungen verschwinden, solange bis am Ende kaum noch etwas Lebenswertes übrig bleibt. Außerdem wird in diesem Handlungsstrang der Lektor R. in einem Unterschlupf im Haus der Protagonistin versteckt, um ihn zu schützen, was immer wieder zu spannenden Wendungen in der Handlung führt.
Die Nebenhandlung ist zugleich ein Roman im Roman bzw. Text im Text, welchen die Protagonistin als Schriftstellerin selbst geschrieben hat. In diesem fantastischen Text geht es um eine ebenfalls namenlos bleibende Frau, die von ihrem Schreibmaschinenlehrer zunächst umschmeichelt wird, ehe er sie von sich abhängig macht, sie durch geschickte Manöver ihrer Stimme beraubt und in einen Kirchturm einsperrt, wo sie, hilflos und stumm, völlig auf ihn angewiesen ist. Ohne zu viel vorwegzunehmen: Ein wenig steht der Verlauf dieser Geschichte letztlich symbolisch auch für den Ausgang der Haupterzählung, die ebenfalls für die von der Erinnerungspolizei abhängige Protagonistin, den Fährmann sowie die meisten Einwohnerinnen und Einwohner der Insel kein sonderlich glückliches Ende nimmt.
Es ist also eine Dystopie im ureigensten Sinne, die Ogawa hier verfasst hat und bei der sie die Entwicklungen am Ende auf die Spitze treibt. Was von der Erzählung bleiben wird, ist der präzise, knappe, aber treffende und poetische Tonfall und die dystopische und parabelhafte Stimmung, die gegen den Autoritarismus anschreibt. Nur dass darin noch auf Schreibmaschinen geschrieben wird, mag etwas irritieren in einem Zeitalter der Digitalisierung, in welchem es längst Internet, Tablets und Smartphones gibt. Technische Innovationen spielen auf der Insel der verlorenen Erinnerungen keine Rolle, sodass diese einen besonders abgeschiedenen Eindruck erweckt.
Der Roman nimmt einen deshalb auch mit auf eine Reise in die vordigitale Vergangenheit, was bisweilen ganz erholsam sein kann, weil scheinbar alles etwas langsamer vonstatten geht. So wirkt diese Inselgesellschaft aus der heutigen Sicht etwas realitätsfern und aus der Zeit gefallen. – Dennoch eine klare Leseempfehlung!
Titelangaben
Yoko Ogawa: Insel der verlorenen Erinnerung
Aus dem Japanischen von Sabine Mangold
München: Liebeskind 2020
352 Seiten, 22.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe