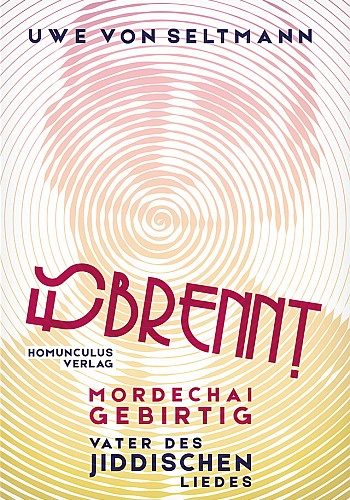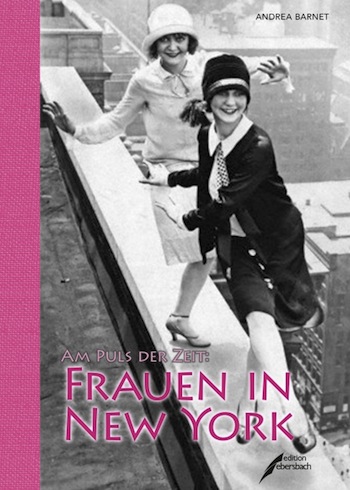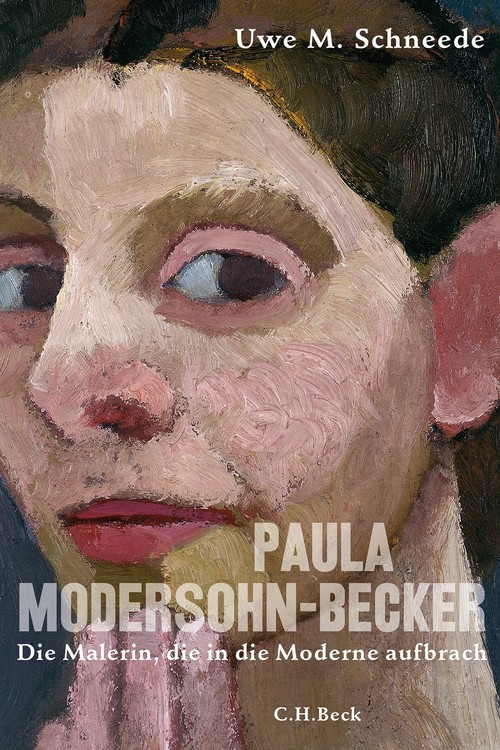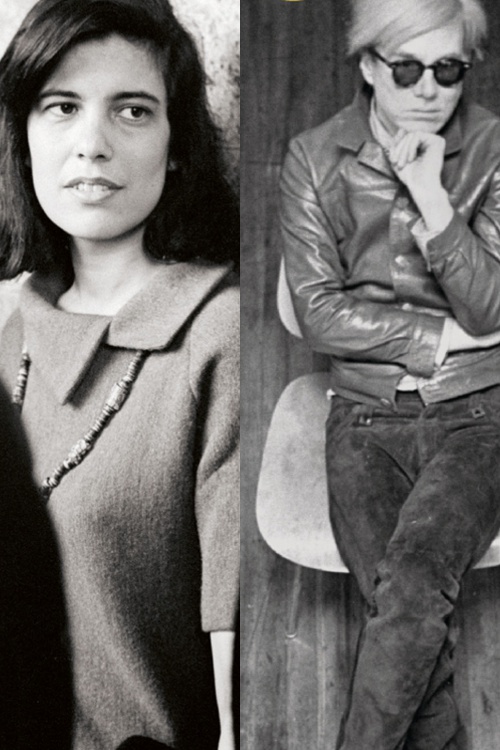Vor genau fünfzig Jahren verglühte ein Sänger und Poet, der sich selbst als brennenden Kometen bezeichnete: Jim Morrison. Anlässlich seines Todestages am 03. 07. 1971, wirft MARC HOINKIS einen tieferen Blick in die kreative Gedankenwelt eines Menschen, der genau so plötzlich auftauchte, wie er verschwand.
Der deutsche Philosoph und Literaturwissenschaftler Thomas Collmer zeigt in seiner umfassenden Abhandlung ›Pfeile gegen die Sonne‹ (1997) Morrisons weitreichende Inspirationen und verknüpft sie mit dem Werk des Poeten. Grundlage dieses Artikels ist das sechste Kapitel dieser Abhandlung, in dem der Autor Morrisons Schaffen mit dem deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche verknüpft.
Apollo und Dionysos
 Jim Morrison äußerte sich selten zur Deutung seiner Texte, wies allerdings auf die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872) von Friedrich Nietzsche (1844-1900) hin, um sein Denken besser zu verstehen. In diesem Werk versucht der Autor, die Bedeutung von Musik in der Entwicklung der antiken Tragödie aufzuschlüsseln. Sukzessive zeigt er den Verfall der Tragödie durch den Verlust des Mythos auf, den er mit der logischen Philosophie des Sokrates in Verbindung bringt. Letztendlich äußert er die Hoffnung, Richard Wagner könne den Mythos wieder aufleben lassen und somit der deutschen Kultur etwas an Stabilität zurück geben, die sie einst verloren hat.
Jim Morrison äußerte sich selten zur Deutung seiner Texte, wies allerdings auf die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872) von Friedrich Nietzsche (1844-1900) hin, um sein Denken besser zu verstehen. In diesem Werk versucht der Autor, die Bedeutung von Musik in der Entwicklung der antiken Tragödie aufzuschlüsseln. Sukzessive zeigt er den Verfall der Tragödie durch den Verlust des Mythos auf, den er mit der logischen Philosophie des Sokrates in Verbindung bringt. Letztendlich äußert er die Hoffnung, Richard Wagner könne den Mythos wieder aufleben lassen und somit der deutschen Kultur etwas an Stabilität zurück geben, die sie einst verloren hat.
Als zentrales Begriffspaar nennt Nietzsche die Götter Apollo und Dionysos, die zwei sich gegenseitig bedingende Kunstprinzipien verkörpern. Das Apollinische charakterisiert er als die »maßvolle Begrenzung« oder den »schönen Schein der Traumwelt«, etwas poetischer in Schopenhauers Worten als den »Schleier der Maja«. Das Dionysische hingegen konnotiert er mit der eigentlich schöpferischen Kraft, dem »Ur-Schoß« und dem Rausch.
Nietzsche stellt den »dionysischen Chor« als eigentlichen Ursprung dar, aus dem, durch das Wirken der apollinischen Artikulation, die antike Tragödie entstand. Dessen Untergang basiert, so Nietzsche, auf dem Auseinanderreißen dieser beiden Kunstprinzipien, da sie nur im Einklang und mit wechselseitigem Bezug agieren können. Nietzsche sieht in den antiken Dionysos-Festen das Ideal dieser Beziehung:
[su_testimonial]»Dionysus redet die Sprache des Apollo, Apollo aber schließlich die Sprache des Dionysus: womit das höchste Ziel der Tragödie und der Kunst überhaupt erreicht ist.«[/su_testimonial]Dabei wirke das Dionysische auf das Apollinische als Verstärkung der Metapher, als emotionaler Anstoß und hilft ihr dabei, sich zu entfalten:
[su_testimonial]»Die Metapher ist für den echten Dichter nicht eine rhetorische Figur, sondern ein stellvertretendes Bild, das ihm wirklich, an Stelle eines Begriffes, vorschwebt.«[/su_testimonial]So kann die Musik aus dem Geiste der Musik wiedergeboren werden, im Medium einer dionysischen Sprache, die das Apollinische benötigt, um wirklich gehört zu werden.
Morrison als Satyr
Nietzsche strebt also eine Wiederkunft des Dionysischen und eine Vereinigung mit dem Apollinischen an, um den Mythos neu zu erwecken. Möglicherweise hat Jim Morrison den Autor ebenso verstanden, jedenfalls finden sich deutliche Parallelen in seinen Texten und den Songs der Doors.
Das »Zerbrechen der erstarrten Grenzen«, welches nach Nietzsche aus dieser Wiedervereinigung resultiert, scheint auch Morrison zu verfolgen:
[su_testimonial]»If my poetry aims to achieve anything, it’s to deliver people from the limited ways in which they see and feel«.[/su_testimonial]Nietzsche spricht in diesem Zusammenhang über die Selbstmythologisierung, durch die der Künstler selbst zum Kunstwerk werde:
[su_testimonial]»So entsteht denn jene phantastische und so anstößig scheinende Figur des weisen und begeisterten Satyrs, der zugleich ›der tumbe Mensch‹ im Gegensatz zum Gotte ist: Abbild der Natur und ihrer stärksten Triebe, ja Symbol derselben und zugleich Verkünder ihrer Weisheit und Kunst: Musiker, Dichter, Tänzer, Geisterseher in einer Person.«[/su_testimonial]Dies lässt sich auf Morrison und seine Bühnenshow adaptieren. Neben seiner Funktion als Sänger, trug er auch seine Gedichte auf der Bühne vor und verfiel in ekstatische Tänze, vor allem in den längeren Instrumentalpassagen. Sein Ziel war es, die Konzerte als eine Art Séance, eine Geisteranrufung, abzuhalten, indem er Praktiken aus schamanischen Riten mit einzubinden versuchte. Morrison sah sich selbst als Vermittler zwischen der Welt des Publikums und dem Jenseits.
So wie Nietzsche beschreibt, dass sich das Publikum der antiken Tragödie selbst im Chor wiederfand, also kein Unterschied zwischen ihnen bestand, findet sich dieser Ansatz auch in Morrisons Gedichtband ›The Lords and the New Creatures‹:
[su_testimonial]»It is wrong to assume, that art needs the spectator in order to be. The film runs on without eyes. The spectator cannot exist without it. It insures his existence.«[/su_testimonial]Der Geist der Musik
Nietzsche stellt das Volkslied als die »Vereinigung des Apollinischen und des Dionysischen« dar und zitiert Schiller:
[su_testimonial]»Die Empfindung ist bei mir anfangs ohne bestimmten und klaren Gegenstand; dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische Grundstimmung geht vorher, und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee.«[/su_testimonial]In einem Interview mit Jerry Hopkins (1969) äußert sich Morrison sehr ähnlich:
[su_testimonial]»To me a song comes with the music, a sound or rhythm first, then I make up words as fast as I can just to hold on to the feel – until actually the music and the lyric come almost simultaneously.«[/su_testimonial]Morrison scheint hier eine Vereinigung des musikalischen Gefühls (als dionysisches Element) und des Songtextes (als apollinisches Element) zu beschreiben. Nietzsche fasst dies zusammen:
[su_testimonial]»Die Melodie ist also das Erste und Allgemeine […] Die Melodie gebiert die Dichtung aus sich, und zwar immer wieder von neuem, nichts anderes will uns die Strophenform des Volksliedes sagen.«[/su_testimonial]Das Prinzip der zyklischen Selbsterneuerung findet sich sowohl textlich als auch musikalisch in zahlreichen Songs der Doors.
Weiterhin äußert sich Nietzsche zum Stilmittel der Dissonanz (er erklärt die Disharmonie als »Urphänomen« der dionysischen Kunst) und betont die rhythmische Vielfalt der Musik in der antiken Tragödie:
[su_testimonial]»Dem musikalisch-rhythmischen Periodenbau, der sich im strengsten Parallelismus mit dem Text bewegte, lief nun andererseits, als äußerliches Ausdrucksmittel, die Tanzbewegung zur Seite […].«[/su_testimonial]Nietzsche spricht auch das »Halbrezitativ« an und erklärt, dass der Tragödiendichter über Fähigkeiten nicht nur als Dichter und Musiker, sondern auch als Schauspieler und Regisseur verfügen müsse:
[su_testimonial]»[…] viele Künste in höchster Tätigkeit und doch ein Kunstwerk – das ist das antike Musikdrama.«[/su_testimonial]Als Paradebeispiel sei hier der Song ›The End‹ aus dem ersten Doors-Albums (1967) genannt, dessen Klimax Morrison stets tanzend verbringt, während Densmore das immer wiederkehrende »Fuck… Kill…« akzentuiert. Weiterhin der rezitative Mittelteil, der eine deutliche Anspielung an das antike Ödipus Drama von Sophokles darstellt. Wenn wir Nietzsche glauben, dass in allen antiken Dramen, bis auf wenige Ausnahmen, der tragische Held immer Dionysos selbst oder eine Maske des Dionysos sei, können wir hier ebenfalls eine Reminiszenz an eben diesen finden. Eine Passage aus Morrisons Gedicht ›An American Prayer‹ könnte einen Hinweis darauf geben:
[su_testimonial]»We have assembled inside this ancient & insane theatre […]«[/su_testimonial]»Nietzsche killed Jim«
 Diese Aussage des Gitarristen der Doors, Robby Krieger, bezieht sich wohl am ehesten auf einen Aspekt des Dionysischen, dem Jim Morrison sein Leben schenkte: der Rausch. Morrison war bekannt für seine Experimente mit psychedelischen Substanzen und seiner starken Alkoholabhängigkeit, die wohl gleichermaßen zu kreativen Ausbrüchen und zerstörerischen Exzessen führte. Auch wenn seine Todesursache nie ganz geklärt wurde, liegt es Nahe, dass sein jahrelanges Leben auf der Überholspur einen Teil dazu beigetragen hat.
Diese Aussage des Gitarristen der Doors, Robby Krieger, bezieht sich wohl am ehesten auf einen Aspekt des Dionysischen, dem Jim Morrison sein Leben schenkte: der Rausch. Morrison war bekannt für seine Experimente mit psychedelischen Substanzen und seiner starken Alkoholabhängigkeit, die wohl gleichermaßen zu kreativen Ausbrüchen und zerstörerischen Exzessen führte. Auch wenn seine Todesursache nie ganz geklärt wurde, liegt es Nahe, dass sein jahrelanges Leben auf der Überholspur einen Teil dazu beigetragen hat.
Der eigentliche Apollo?
So sehr man Jim Morrison mit dem Dionysischen in Verbindung bringen kann, verkörperte er doch auch das apollinische Element: Seine Texte wurden durch die Musik der restlichen Band-Mitglieder erst wirklich zum Vorschein gebracht und trotz seiner wachsenden Popularität erreichten seine Gedichte erst nach seinem Tod ein breiteres Publikum, nicht zuletzt durch das Album »An American Prayer« (1978), auf dem die übrig gebliebenen Mitglieder der Doors Aufnahmen von Morrisons Gedichten, die er 1970 eingelesen hatte, mit Musik unterlegten und neu arrangierten.
Ob apollinisch oder dionysisch … Morrison hat sich selbst zum Mythos erhoben und ging zusammen mit den restlichen Doors für immer in den Olymp des Rock ein. Oder um es mit seinen eigenen Worten zu sagen:
[su_testimonial]»I see myself as a huge fiery comet […] Everyone stops, points up and gasps ›Oh look at that!‹ Then – whoosh, and I’m gone…and they’ll never see anything like it ever again… and they won’t be able to forget me- ever.«[/su_testimonial]| MARC HOINKIS
| Abbildungen: Elektra Records, Jim Morrison 1969, als gemeinfrei gekennzeichnet; Friedrich Hartmann creator QS:P170,Q58668439, Nietzsche187a, als gemeinfrei gekennzeichnet