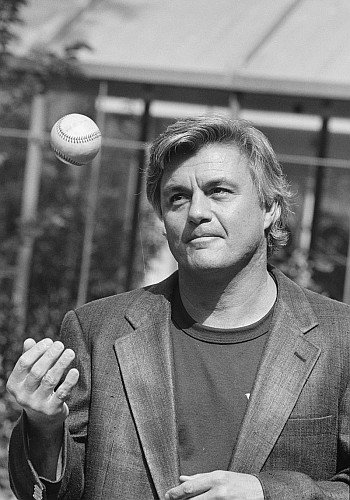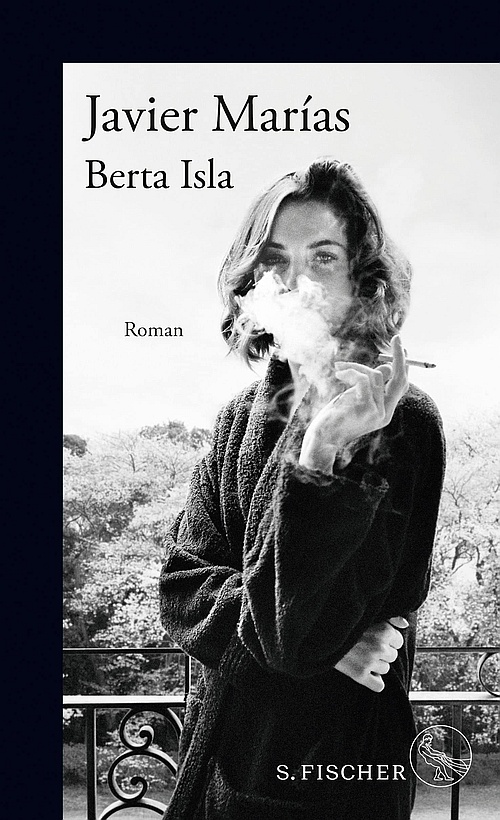Menschen | Mary und Charlie Dickens: Unser Vater Charles Dickens
Am 7. Februar 2012 vor 200 Jahren wurde Charles Dickens geboren, als zweites von acht Kindern. Das »Leben im Prekariat« lernt er früh aufs Drastischste kennen, als der Vater kurzfristig im Schuldturm sitzt und der elfjährige Charles in einer Schuhwichsefabrik fürs Familieneinkommen sorgen muss. Die Grenze für Bildung heißt Geld, die Grenze für Liebesglück heißt Klassengesellschaft. Charles Dickens wird diese Erfahrung als Gerichts- und Parlamentsreporter und erst recht als Schriftsteller immer wieder variieren, ob als herzzerreißende Erzählung oder als schneidende Sozialsatire. Wie sie auch in sein eigenes Familienleben einfließt, erzählt das von Alexander Pechmann zusammengestellte Buch Mary und Charlie Dickens: Unser Vater Charles Dickens. Von PIEKE BIERMANN
 Die Null ist eine indische Erfindung, auf ihr beruht das Dezimalsystem, beides zusammen kam mit der arabischen Kultur endlich auch nach Europa. Von hier schwang es sich auf zum internationalen Standard, und das ist durchaus verdienstvoll – für die Mathematik im Allgemeinen, für Handel, Wandel und Geldverkehr und natürlich für die Vermessung der Welt, der Wohnung und des eigenen Körpers im Besonderen. Als Messlatte für den westlichen Standardkulturbetrieb dagegen bereitet es hin und wieder ein gewisses Unbehagen an eben der Kultur. Soundso viele Nullen an einem Geburts- oder Todestag erzeugen manche Überschwemmung durch Namen und Werke, die ohne schlimme Folgen am dunklen Meeresboden hätten bleiben dürfen, weil ihre Bedeutung bei Licht betrachtet doch eher gegen Null tendiert.
Die Null ist eine indische Erfindung, auf ihr beruht das Dezimalsystem, beides zusammen kam mit der arabischen Kultur endlich auch nach Europa. Von hier schwang es sich auf zum internationalen Standard, und das ist durchaus verdienstvoll – für die Mathematik im Allgemeinen, für Handel, Wandel und Geldverkehr und natürlich für die Vermessung der Welt, der Wohnung und des eigenen Körpers im Besonderen. Als Messlatte für den westlichen Standardkulturbetrieb dagegen bereitet es hin und wieder ein gewisses Unbehagen an eben der Kultur. Soundso viele Nullen an einem Geburts- oder Todestag erzeugen manche Überschwemmung durch Namen und Werke, die ohne schlimme Folgen am dunklen Meeresboden hätten bleiben dürfen, weil ihre Bedeutung bei Licht betrachtet doch eher gegen Null tendiert.
Im Fall von Charles Dickens ist das anders. Er wäre im kommenden Februar 200 Jahre alt. Folglich gibt es pünktlich vorab – und gut platziert zum Weihnachtsgeschäft – das eine oder andere Dickenssche Werk in wohlfeiler Nachauflage und eine neue, aufs deutsche Publikum hin geschriebene Biographie. Das ist gut so, denn es wird Zeit, den armen Dickens vom hierzulande vorherrschenden Image des netten Märchenonkels zu befreien, der rührende Geschichten von ausgebeuteten Kindern und hartleibigen, aber in Weihnachtsseligkeit bekehrten Geizhälsen zu erzählen hat. Charles Dickens – ach ja, das ist doch »der mit David Copperfield und Oliver Twist«. Die die meisten dann auch weniger in der gedruckten als in der Hollywood-Version kennen, so wie die Weihnachtsgeschichte, die zur nämlichen Zeit immer durch irgendeinen Fernsehkanal flimmert.
Eben erschienen ist außerdem noch ein allerliebstes, hübsch gemachtes Büchlein im praktischen Handtaschenformat: in rotes Leinen gebunden, aber biegsam. Kurz, das ideale Weihnachtsgeschenk für alle, die wissen wollen, wie dieser unvorstellbar produktive, ungemein populäre und unübersehbar politische Weltautor wohl privatim so war. Es ist eine Collage aus Texten und Erinnerungen einiger der zehn Kinder, die Dickens‘ Frau Catherine zwischen 1837 und 1852 zur Welt gebracht hatte und von denen eins noch als Baby starb.
Der Charles Dickens, den Charlie, Kate und vor allem Mary schildern, ist selbst für heutige Zeiten erstaunlich emanzipiert: »in jeder Hinsicht ein Familienmensch«, dem keine häusliche Angelegenheit »zu trivial schien«, der sich aufmerksam um die Kinder kümmert und »das kleine wunde Herz« zu trösten versteht. Der Schöpfer einer ganzen Phalanx literarischer Archetypen mit »sprechenden Namen« versieht auch seine Kinder mit vielsagenden Spitznamen, Kate zum Beispiel, die hitzköpfige Drittgeborene, heißt allgemein »Lucifer Box«. Gleichzeitig ist er, mit einem heutigen Wort, ein Workaholic, der nebenbei auf Lesereisen durch die halbe Welt tourt und auch noch Bühnenauftritte hinlegt, wenn er nicht gerade schreibt. Sein Arbeitszimmer hat dennoch kein Zutrittsverbot wie zum Beispiel das von Thomas Mann. Und dabei ist jede der verschiedenen Familienwohnungen obendrein bevölkert von sämtlichen literarischen Figuren, die er gerade in Arbeit hat. Charlie, der Älteste, ist im Nachhinein sicher, »dass die Kinder seines Geistes für ihn manchmal realer waren als wir.«
Schluriges Laissez-faire ist das Familienleben dennoch nicht. Der erzieherische Dreisatz von Vater Charles heißt Pünktlichkeit, Ordnung und Fleiß. Mithilfe solcher geschmähten »Sekundärtugenden« hatte er selbst die Traumata aus bitter-armer Kindheit und Klassendünkel überlebt und seine eigene Erfolgsgeschichte organisiert, aber er hatte sie auch so verinnerlicht, dass sein früher, jäher Tod nur logisch erscheint. Mit einem anderen heutigen Wort: als totales Burn-Out.
Die Erzählungen über diesen Tod von Kate und Mary, der Zweit- und der Drittältesten, sind anrührend. Sie sind allerdings auch »familientauglich« zensiert, so wie manches andere. Von »unserer Mutter« Catherine zum Beispiel ist kaum die Rede – die war von »unserm Vater« recht schnöde abserviert worden, nachdem er sich in eine sehr viel jüngere Schauspielerin verliebt und sie zur – natürlich verheimlichten – Muse erkoren hatte. Dieses glückliche, geistvolle und sehr viktorianische Familienleben mit Hund und Katz, Spiel und Spaß, Haus und Garten ist also nur die eine Seite.
Die andere, nicht weniger viktorianische, »dunkle« Seite wird in diskreten Zwischentexten nachgetragen vom kenntnisreichen und sprachgewandten Alexander Pechmann. Eigentlich müsste er als Autor-Herausgeber in der Titelei stehen. Er hat die Texte der Kinder nicht nur zusammengestellt und zum ersten Mal übersetzt – vor allem die Hauptquelle, Mary Dickens‘ Memoiren ›My Father As I Recall Him‹ –, er hat sie auch kommentiert und zu einem runden, grob chronologischen Ganzen komponiert. Zu einem Buch, das tatsächlich Behagen bereitet. Und zwar ganz und gar nicht im deutsch-biedermeierlichen Sinn.
Titelangaben
Mary und Charlie Dickens: Unser Vater Charles Dickens
Aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Alexander Pechmann
Berlin: Aufbau Verlag 2011
207 Seiten. 14,99 Euro (eBook: 11,99 Euro)
| Erwerben Sie dieses eBook bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe