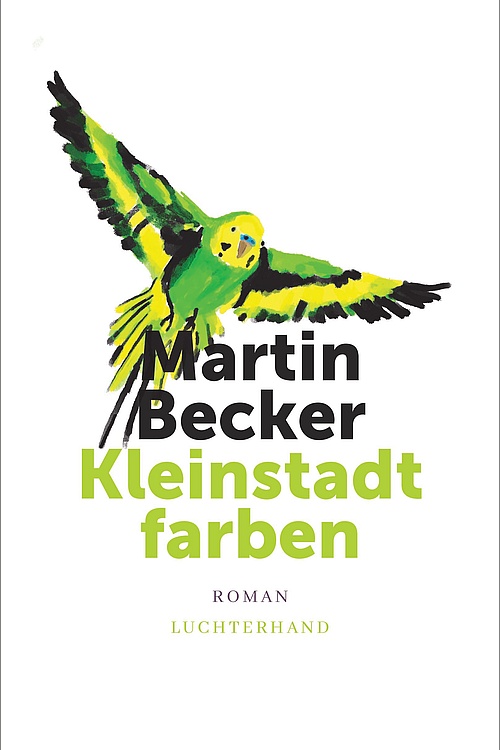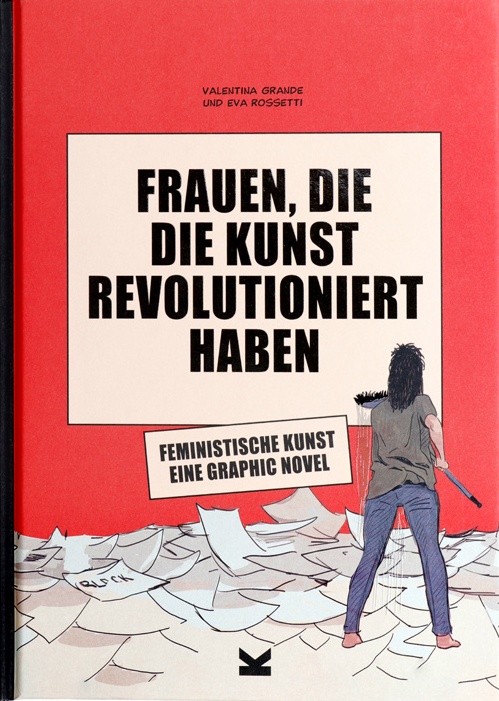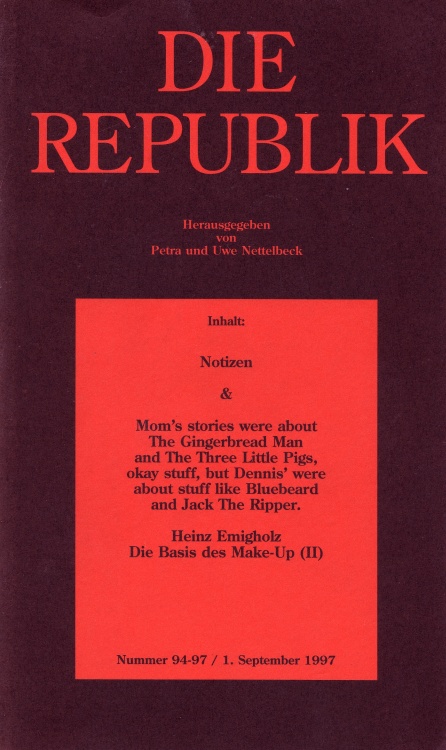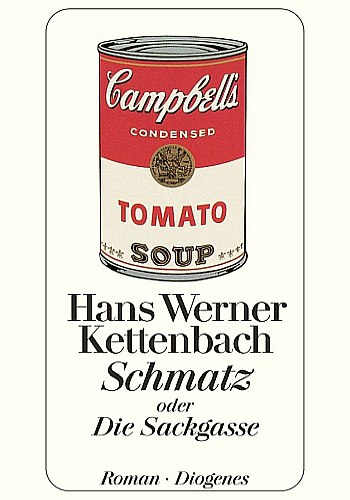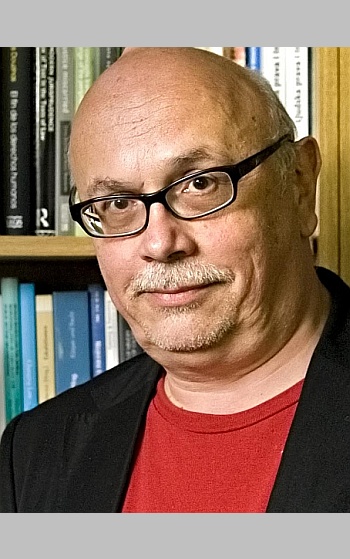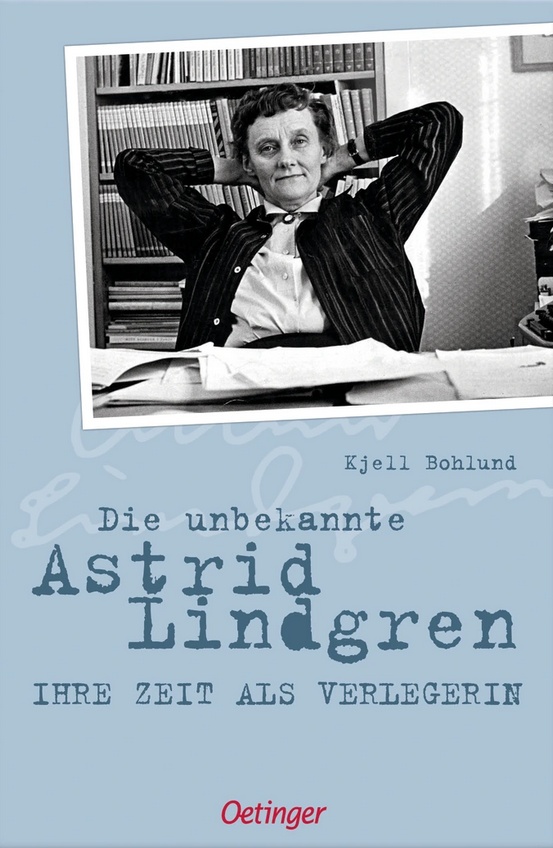»Wenn man zu lange Zeit unterdrückt wird, wird man entweder aggressiv, oder resigniert. Damals war ich aggressiv, jetzt, wo ich alt bin und gesehen habe, dass sich fast nichts geändert hat, bin ich resigniert«, hatte Elfriede Jelinek im letzten Jahr in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung ›La Republica‹ anlässlich der Neuveröffentlichung ihres Buches ›Die Liebhaberinnen‹ in Italien erklärt. Von PETER MOHR
Zwischen Revolte und Resignation – in diesem emotionalen Zwiespalt bewegt sich Elfriede Jelinek seit etlichen Jahren. Vor vier Jahren war ihr noch einmal ein großer Bühnenwurf gelungen. Am Hamburger Schauspielhaus wurde »Am Königsweg« uraufgeführt, eine vehemente Bühnenabrechnung mit Donald Trump. Die Zeitschrift ›Theater heute‹ wählte den »Königsweg« später zum »Stück des Jahres«. In ihrem letzten Stück ›Schwarzwasser‹ (uraufgeführt im Februar 2020 am Wiener Akademietheater) bewegt sie sich ganz nah am Puls der Zeit, thematisiert darin Klimakatastrophe und aggressiven Rechtspopulismus.
»Das Schreiben ist bei mir ein leidenschaftlicher Akt, eine Art Rage. Ich bin nicht jemand, der wie Thomas Mann an jedem Satz feilt, sondern ich fetz halt herum. Das geht zwei, drei Stunden, dann falle ich zusammen wie ein Soufflé, in das man mit einer Nadel sticht«, hat Elfriede Jelinek in einem Interview mit der Zürcher ›Weltwoche‹ erklärt.
An Leidenschaft, Elan, Bissigkeit und künstlerischem Furor hat es in Jelineks Werken nie gemangelt. Als ihr 2004 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, war dies eine faustdicke Überraschung. Einen »Skandal« nannten viele Kommentatoren die Preisvergabe, von einer »mutigen Entscheidung« sprachen wohlmeinendere Stimmen.
»Das ist eine Ehre, die für mich zu groß ist im Moment. Es ist doch unvorstellbar, dass ich mich jetzt neben Leuten wie Beckett und Hemingway wiederfinde«, kommentierte die öffentlichkeitsscheue Autorin, die auch prompt der Preisverleihung in Stockholm fernblieb und ihre Dankesrede in ihrer Wiener Wohnung auf Video aufzeichnen ließ.
Elfriede Jelinek ist in ihren Bühnen- und Erzählwerken immer eine verbale Kämpferin, eine Autorin, die dem österreichischen Establishment – ähnlich Thomas Bernhard – mit schneidenden Worten zu Leibe rückt. Die mangelnde Bereitschaft, sich mit der österreichischen Nazi-Vergangenheit auseinanderzusetzen, lastete sie ihren Landsleuten wiederholt an, und sie attackierte öffentlich die Politiker Kurt Waldheim und Jörg Haider.
Ihr ambivalentes Verhältnis zu ihrem Heimatland gipfelte darin, dass sie 1996 ein (kurzzeitiges) Aufführungsverbot für ihre Stücke in Österreich aussprach. Zwei Jahre später feierte sie am Wiener Burgtheater mit dem von Einar Schleef inszenierten ›Sportstück‹ jedoch einen grandiosen Erfolg.
Dabei hatte die literarische Provokateurin Elfriede Jelinek, die am 20. Oktober 1946 als Tochter eines Chemikers in Mürzzuschlag in der Steiermark geboren wurde und heute abwechselnd in Wien und München lebt, künstlerisch äußerst feinsinnig begonnen. Als Teenager lernte sie am Wiener Konservatorium Blockflöte, Orgel und Komposition, und Mitte der 60er Jahre schrieb sie erste Gedichte, die 1969 mit dem Lyrikpreis der österreichischen Jugendkulturwoche ausgezeichnet wurden. Ihr Studium der Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte brach sie wegen einer psychischen Krise ab, in deren Folge sie sich für ein Jahr in ihrem Elternhaus verschanzte.
Ihre ersten künstlerischen Erfolge feierte Jelinek Anfang der 70er Jahre mit Hörspielen, erst 1979 kam in Graz ihr erstes Theaterstück ›Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte‹ auf die Bühne. Der Durchbruch der Österreicherin in Deutschland ist ganz eng mit dem Namen Hans Hollmann und dem Bonner Theater verknüpft, das zwischen 1982 und 1988 vier Jelinek-Stücke uraufführte.
Erfolg war der Autorin eigentlich immer suspekt, weil sie fürchtete, sich den Konventionen anzupassen, den Publikumsgeschmack zu treffen und selbst irgendwann im verhassten Kultur-Establishment zu landen. Elfriede Jelinek schlug sich immer auf die Seite der Schwachen und Entrechteten. Sie kämpfte als Radikalfeministin mit ästhetisch fragwürdigen Mitteln gegen die Unterdrückung der Frauen (1989 erschien ihr Skandal-Roman ›Lust‹), sie schrieb gegen das Vergessen der Nazi-Vergangenheit an (1995 im Roman ›Die Kinder der Toten‹), wehrte sich gegen tradierte Machtstrukturen (u.a. im autobiografisch fundierten Roman ›Die Klavierspielerin‹, 1983) und wünschte sich für Österreich sehnlichst eine »links-sozialistische Partei«.
›Einen musikalischen Fluss‹, den die Nobelpreis-Jury rühmte, wird man bei Elfriede Jelinek nur schwerlich finden. Stattdessen stößt man immer wieder – auf einen zornigen, mittlerweile auch leicht larmoyanten Grundtenor. Als ihr 1998 der Georg-Büchner-Preis verliehen wurde, bekannte Elfriede Jelinek schon: »Ja, ich bin resigniert.«
Ihre künstlerische Produktivität hat unter der vermeintlichen Resignation (wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat) allerdings nicht gelitten. Ihren kritischen Blick, ihre Bissigkeit und ihre Affinität zur Provokation hat sich die Nobelpreisträgerin bewahrt.
Trotz der gigantischen Erfolge klingt Elfriede Jelineks dringlichster Wunsch ziemlich bescheiden: »Das einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist, zurückgezogen zu leben. Ich will nur in Ruhe gelassen werden.«
| PETER MOHR
| Abb: Ghuengsberg at English Wikipedia., Elfriede jelinek 2004 small cropped, Farbe, CC BY-SA 3.0