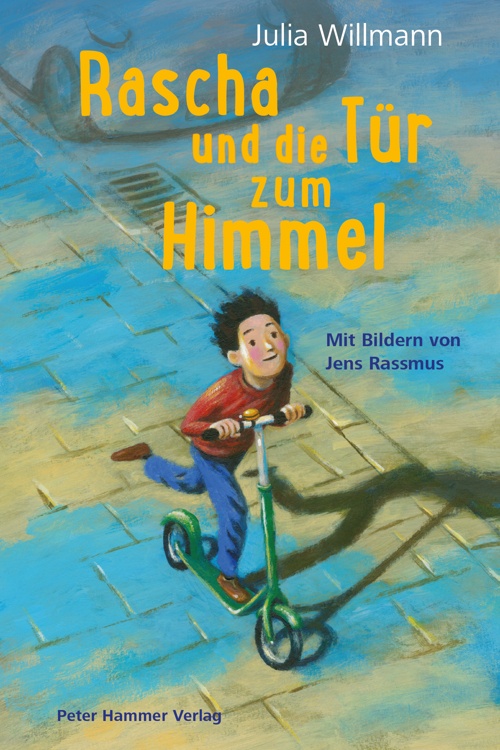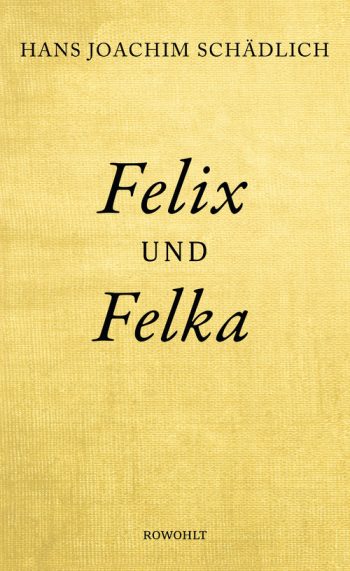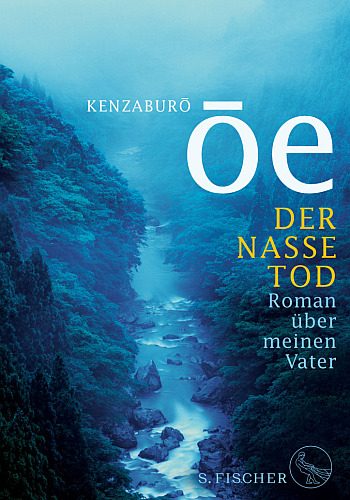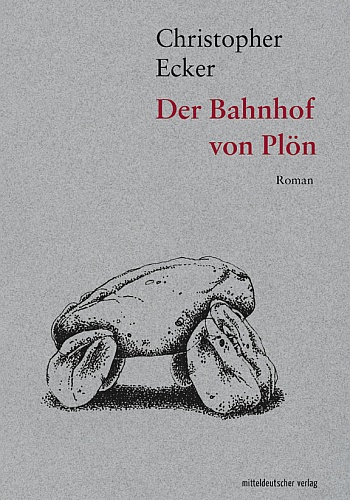Den slowakischen General Milan R. Štefánik hat es wirklich gegeben. Viele andere der im fünften Roman von Michal Hvorecký auftretenden Personen auch. Was es freilich nicht gab: einen slowakischen Exodus in die Südsee, nach Tahiti. Aber zu verfolgen, wie das kleine, einst zu Österreich-Ungarn gehörende Volk sich quer durch Europa und schließlich zu Schiff über den Atlantik zu neuen Ufern aufmacht, ist hochamüsant und lässt zahlreiche Parallelen zu unserer Gegenwart durchscheinen. Zumal Hvorecký seine genial erfundene Geschichte auch dazu nutzt, mit heute wieder grassierenden nationalistischen Tendenzen in seiner Heimat ins Gericht zu gehen. Von DIETMAR JACOBSEN
 Milan Rastislav Štefánik zählt neben Tomáš Masaryk und Edvard Beneš zu den drei Gründervätern der Tschechoslowakei. Geboren 1880, war der studierte Astronom, Politiker, Militärpilot in französischen Diensten und spätere Gründer der Tschechoslowakischen Legionen – Militärverbänden aus Tschechen und Slowaken, die im Ersten Weltkrieg an der Seite der Entente kämpften – auch der erste Kriegsminister der am 28. Oktober 1918 in Prag als eigenständiger Staat proklamierten Tschechoslowakei.
Milan Rastislav Štefánik zählt neben Tomáš Masaryk und Edvard Beneš zu den drei Gründervätern der Tschechoslowakei. Geboren 1880, war der studierte Astronom, Politiker, Militärpilot in französischen Diensten und spätere Gründer der Tschechoslowakischen Legionen – Militärverbänden aus Tschechen und Slowaken, die im Ersten Weltkrieg an der Seite der Entente kämpften – auch der erste Kriegsminister der am 28. Oktober 1918 in Prag als eigenständiger Staat proklamierten Tschechoslowakei.
Bereits ein halbes Jahr später, am 4. Mai 1919, kam er beim Absturz eines von ihm gesteuerten Flugzeugs nahe Bratislava ums Leben. Auch Michal Hvorecký lässt den populären General in seinem Roman Tahiti Utopia mit einem Flugzeug abstürzen, verlegt allerdings den Todeszeitpunkt ins Jahr 1923 und den Ort der Katastrophe auf die polynesische Insel Tahiti.
Auf der Suche nach dem Paradies
Er hat Štefánik eine andere, nicht durch die Historie gedeckte Rolle zugedacht. In Hvoreckýs fünftem Roman Tahiti Utopia führt der General die Slowaken nämlich in ihre neue Heimat Tahiti, die er kurzerhand in »Neu-Slowakien« umbenennt. Denn die »Ober-Ungarn« fühlen sich bei der Neuordnung der nach dem Ersten Weltkrieg untergegangenen Habsburger Monarchie, wie es die Versailler Verträge vorsehen, übergangen. Niemand kümmert sich bei den Pariser Friedensverhandlungen um das kleine, dafür aber umso stolzere Volk zwischen Tschechien im Westen, der Ukraine im Osten, Polen im Norden und Ungarn im Süden. Jede der Großmächte möchte so viel Gewinn wie möglich aus dem Weltkriegs-Desaster schlagen.
Nur die kleine Slowakei interessiert niemanden außerhalb der eigenen Delegation. Ihre Abgesandten zu den Debatten im Siegerland Frankreich werden übergangen, belächelt, kaum zu Wort kommen gelassen. Was umso ärgerlicher ist, als Štefánik und die Seinen in die Verhandlungen im festen Glauben gegangen waren, sie würden von den Mächten der Welt als gleichberechtigte Partner angesehen und behandelt werden. Aber »es war um vieles einfacher, einen Krieg zu führen, als einen Frieden zu vereinbaren«. Nun ist die Enttäuschung groß. Und die Suche nach einem Ausweg aus der misslichen Situation, als kleines europäisches Volk nicht ernstgenommen, ja in der eigenen Heimat zunehmend blutig unterdrückt zu werden – »Entslowakisieren. Das Wort des Tages.« –, beginnt.
Zwischen »Südsee-Karpaten« und »Neusiedler-Meer«
Letztlich bleibt nur der Exodus. »Laßt uns etwas Besseres finden als unsere Väter und Großväter.Laßt uns von hier weggehen. Wir haben nichts zu verlieren.Noch schlimmer kann es gewiß nicht werden.Wir haben endgültig genug vom Terror«, heißt es in den überall im Land kursierenden Flugblättern. Und die Slowaken folgen dem Aufruf: »Ganze Dörfer setzten sich in Bewegung. Hunderte, Tausende von Slowaken aus allen Regionen brachen zu einem Marsch auf. Der Strom von Menschen überflutete Straßen und Wege.« Durch halb Europa, das mit den sich auf der Flucht Befindenden alles andere als freundlich umspringt – Anspielungen auf aktuelle Migrationsbewegungen und die dubiose Rolle der europäischen Staatengemeinschaft sind nicht zu übersehen –, führt Štefánik die Slowaken bis zum Hafen von Le Havre, von wo aus man nach einer achtunddreißigtägigen beschwerlichen Seereise Tahiti erreicht.
Bei den Einheimischen sind die Ankömmlinge zunächst wenig beliebt. Kaum ist man den »perversen Nichtstuer, […] versoffenen Faulpelz und Parasiten« Paul Gauguin losgeworden, hat man den nächsten Europäer auf dem Hals, in dessen Gefolge »ungebetene Menschenmassen« die Insel fluten. Und auch die Slowaken haben zu kämpfen – für’s Erste vor allem mit den ungewohnten klimatischen Bedingungen. Aber bald versteht man es durchaus, Heimatliches und Fremdes zu verbinden. Zwar wollen die traditionellen Halušky, das slowakische Nationalgericht, mit Kokosmilch statt Frischkäse zubereitet nicht schmecken. Aber mit Ruderblättern als Schlägern und getrockneten Kokosnüssen etablieren die Siedler ihr geliebtes Hockeyspiel im Exil. Zudem hilft es, die tahitianischen Berge als »Südsee-Karpaten« und den Pazifik als »Neusiedler-Meer« zu bezeichnen, um die Sehnsucht nach der alten Heimat wenigstens ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Der Mensch kann niemals über seinen Schatten springen
Als Erzählerin des Romans fungiert übrigens eine 1976 geborene Urenkelin Štefániks. Die studierte Historikerin hat sich viele Jahre lang mit dem Exodus der Slowaken, vor allem der Rolle, die Frauen dabei spielten, beschäftigt. Im Gegensatz zu vielen anderen Fachvertretern, in deren Werken Štefániks Tod als von ausländischen Mächten inszeniert dargestellt wird, was nationalistische Schlussfolgerungen impliziert, interessieren sie mehr Leben und Werk ihres Vorfahrs. Doch gegen die Kräfte, die die Vergangenheit gerne so hinbiegen, dass sie ihre eigene aggressive Politik in der Gegenwart mitzubegründen hilft, kommt sie auf Dauer nicht an. Und so entschließt sie sich letzten Endes, statt einer wissenschaftlichen Studie einen Roman zu schreiben und ihn Tahiti zu nennen.
Realität als Fiktion und Fiktion als Realität. Geschickt spielt Michal Hvorecký in seinem Roman mit Gewesenem und Erfundenem. Lässt seine Historikerin die tatsächliche Geschichte der Slowakei – »Was wäre passiert, wenn die Slowaken nicht nach Tahiti gegangen wären? Wenn sie in dem Kessel zwischen Tatra und Donau geblieben wären? Wie wäre dort ihre Geschichte weitergegangen?« – als utopisches Konstrukt erzählen, während die raffiniert erfundene Exodus-Story den Platz der historischen Wahrheit einzunehmen hat. Einer Wahrheit letzten Endes, mit der sich die nationalistischen Bestrebungen der Gegenwart viel besser erklären lassen. Kein Wunder deshalb, wenn die zunehmend unter Druck kommende Historikerin letztlich erleben muss, dass Angehörige einer radikalen Jugendorganisation sie als »ausländische Agentin« verteufeln und ihr Buch öffentlich verbrennen. Denn jeder macht sich die Geschichte, die ihm in der Gegenwart den meisten Nutzen bringt.
Titelangaben
Michal Hvorecký: Tahiti Utopia
Aus dem Slowakischen von Mirko Kraetsch
Stuttgart: Tropen 2021
251 Seiten. 20.- Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe