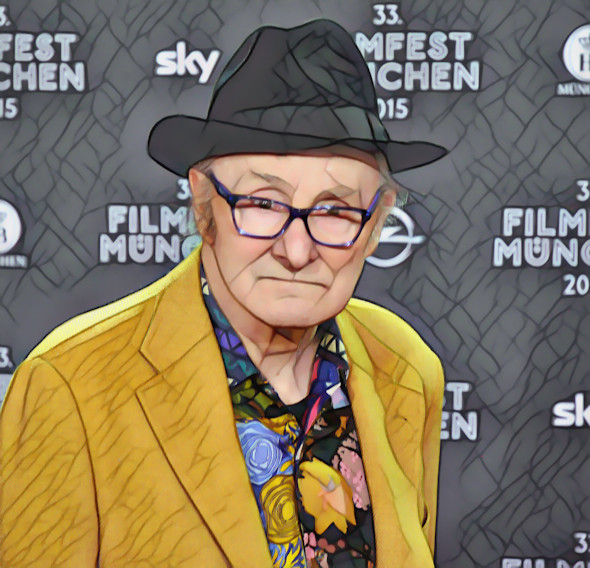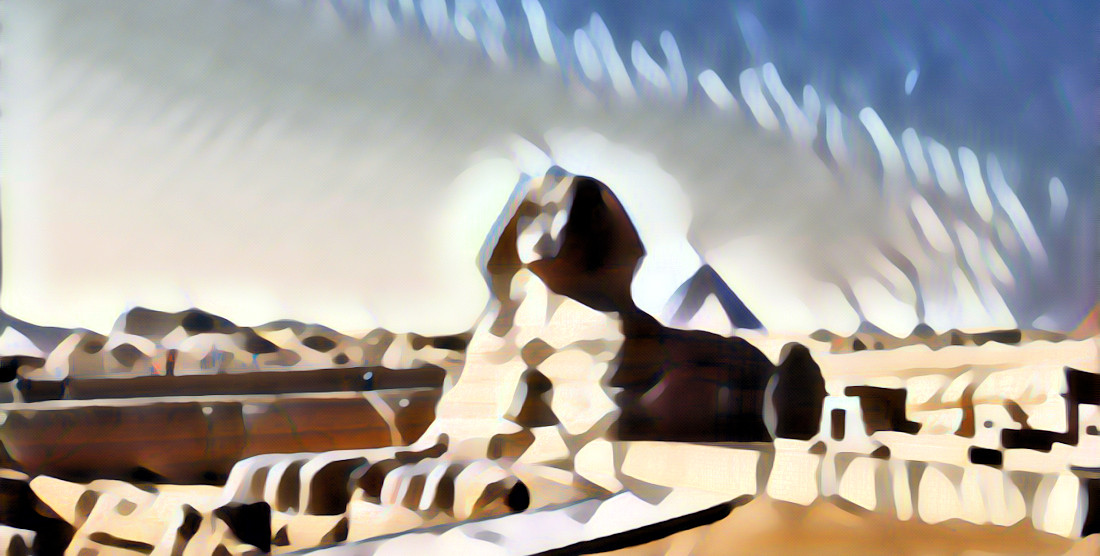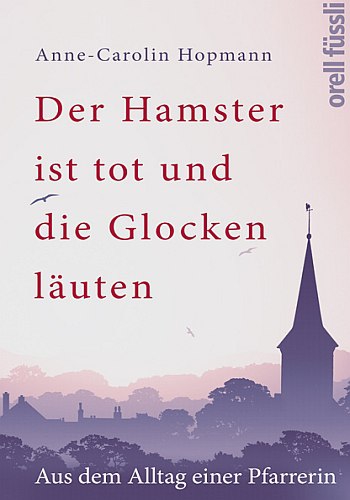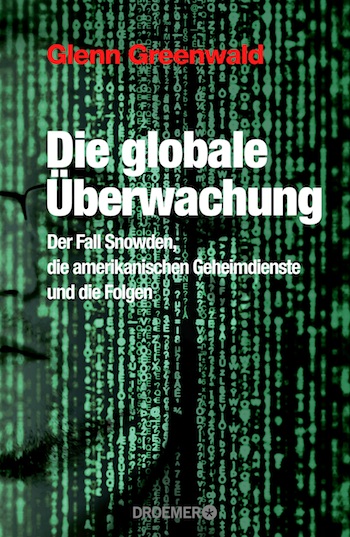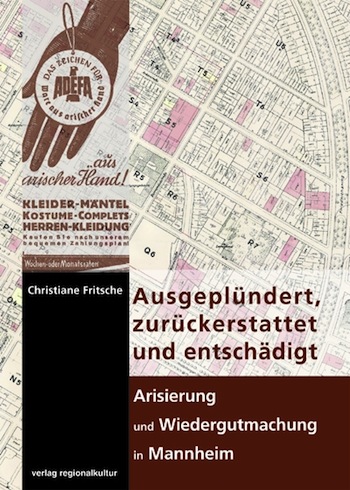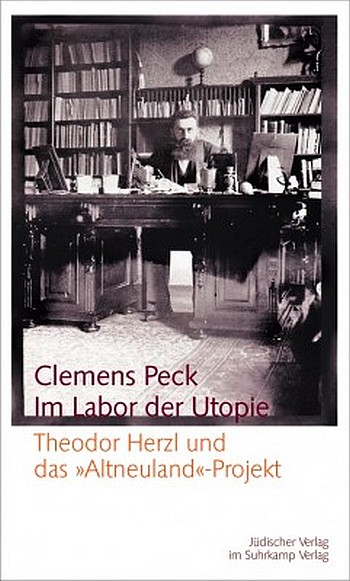Diese 192 Seiten tun weh, irritieren, machen mehr als nachdenklich. ›Drecksarbeit‹, der Titel ist für manche dieser zehn Geschichten noch untertrieben. Jan Stremmel will treffen, will wachrütteln, will aufklären. Von BARBARA WEGMANN
 Jan Stremmel ist erst Mitte 30, hat etwas so Unverfängliches wie u. a. Geschichte, Kunstgeschichte und Literatur studiert, wechselte dann zum Journalismus, ist für die Süddeutsche Zeitung tätig, arbeitet heute auch für Wissenschaftssendungen. Er hat Biss, und: er hat das ungeheure Talent sprachlich wunderbar lesbar ins schrecklich Schwarze zu treffen. Kompromisslos, da widerspricht niemand. Sehr persönlich und doch so allgemeingültig.
Jan Stremmel ist erst Mitte 30, hat etwas so Unverfängliches wie u. a. Geschichte, Kunstgeschichte und Literatur studiert, wechselte dann zum Journalismus, ist für die Süddeutsche Zeitung tätig, arbeitet heute auch für Wissenschaftssendungen. Er hat Biss, und: er hat das ungeheure Talent sprachlich wunderbar lesbar ins schrecklich Schwarze zu treffen. Kompromisslos, da widerspricht niemand. Sehr persönlich und doch so allgemeingültig.
Einen Tag lang begleitet Stremmel einen Baumwollfärber in einem Betrieb, irgendwo vor Kalkutta. Seine Turnschuhe weichen schnell durch in der Chemikalienbrühe: »…wo meine Schuhe Löcher für die Schnürsenkel hatten, waren jetzt blutige Löcher in meinem Fuß«. Stremmel versteht, warum die Färber in Flip-Flops arbeiten: sie können sich jederzeit Wasser über die Füße laufen lassen.
Die Arbeitsbedingungen sind im wahrsten Sinne atemraubend: »Es roch, als würde ein größenwahnsinniger Figaro hundert Kundinnen gleichzeitig die Haare blondieren.« Er weiß, dass er sich im »toten Winkel der Globalisierung« befindet, er weiß, dass es die Sub- und noch mal Sub-Unternehmen gibt, die mittlerweile im noch billigeren Bangladesch arbeiten. »Dort ist der Mindestlohn halb so hoch«. Ein bisserl was an Ausbeutung geht immer noch …
Recht schnell kommen ungute Gefühle beim Lesen auf, recht schnell begreift man, das hier sind schauerliche Geschichten, die von weit weg erzählen, aber mich und jeden hautnah und direkt betreffen. Schnell wird man aber auch süchtig, mehr von diesen Hintergründen zu erfahren, mehr zu erkunden, wie Ausbeutung, Profitgier und unmenschliche Arbeitsverhältnisse funktionieren, wie wachsender Reichtum in der westlichen Welt mit wachsender Armut in fernen Ländern zusammenhängt. Eines bedingt das Andere, eines nimmt dem Anderen die Luft zu atmen und zu leben. »Es braucht Hunderte Chemikalien, um Baumwolle oder Kunstfaser zu färben. Die meisten sind giftig, ätzend, krebserregend, hormonell wirksam oder alles auf einmal … Das Grundwasser von Kalkutta ist massiv mit Giftstoffen aus der Industrie belastet. Für den Staat ist eine Million toter Fische akzeptabler als eine Million gefährdeter Arbeitsplätze.«
Wollen Menschen wirklich um jeden Preis billig kaufen? Den Autor haben seine eigenen Recherchen verändert. Er habe es sich abgewöhnt, so sagt er, beim Kaufen auf den Preis zu schauen, wisse aber auch, dass es für Viele schwer sei, nachhaltig, und fair produziert zu kaufen.
Zustände, so Stremmel, an denen auch das Lieferkettengesetz nichts geändert hat, ein Gesetz, das hiesige Unternehmen für die Herstellung ihrer Produkte verantwortlich machen soll. Dazu anhalten soll, auf Menschenrechte, das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit zu achten, aber: dieses Gesetz greift nur bei größeren Unternehmen, und die Mehrheit der produzierenden Betriebe seien, so Stremmel, Betriebe mit unter jenen festgelegten 3000 Mitarbeitern.
Jan Stremmel besucht auf den Kapverdischen Inseln Sandräuber, die für einen Hungerlohn der gefräßigen Bauindustrie Sand beschaffen. Er begleitet Dita, die Sand stiehlt und verkauft, »eine von geschätzt Hunderttausenden in diesem Geschäftszweig, allein an der afrikanischen Westküste.« Wie Sand am Meer, so sagt ein Sprichwort? Das wird hier zum puren Zynismus. Es gibt nämlich bald keinen Sand mehr. Sand sei, so schreibt der preisgekrönte Autor, »nach Wasser die zweitmeist verbrauchte Ressource«.
Ob es die Produktion von Grillkohle ist, die wir bald im Sommer wieder so billig in Baumärkten für die Gartenparty erstehen, oder ob es die Rosen sind, die wir so spottbillig in Supermärkten kaufen, oder ob es der irrsinnige Wasserbrauch für die Produktion unsere T-Shirts ist, ob es die verantwortungslose Rodung von immensen Flächen an Regenwald rund um den Äquator ist, eines haben all diese Dinge gemeinsam: »Alles hängt mit allem zusammen« und es ist Irrsinn, sagt Stremmel, wenn Rosen im wasserknappen Kenia angebaut werden, um dann per Flugzeug nach Europa geflogen zu werden. »Ein Produkt, das keinen wichtigen Zweck erfüllt, … wird in einer Gegend angebaut, in der das Wasser knapp ist, wird dann mit jeder Menge klimaschädlichem Kerosin um die halbe Welt geflogen, um schließlich im besten Fall nach einer Woche im Biomüll zu landen.«
Es ist schon kein leichter Blick in den Spiegel, in den wir da schauen, wir, die wir im Schnitt 92 Kleidungsstücke besitzen. Und ein T-Shirt, wie sagt der Autor so treffend, tragen wir dabei nicht einmal länger als die Tüte, in der wir das Kleidungsstück aus dem Laden tragen.
Veränderungen und Abhilfe dieser irrsinnigen, uns und unseren gemeinsamen Globus schädigenden Dinge, sie können nur erreicht werden durch Begreifen aller Zusammenhänge, dieser »unendlich vielen kleinen Zahnräder, über die die Welt miteinander verbunden ist.«
192 Seiten, die viel anrichten im Kopf, die man dennoch gern zweimal liest, weil ihr Inhalt so unglaublich dicht ist, so stark in jeder Aussage, so bildhaft in jeder Beschreibung. 192 Seiten, die durch sehr persönliche Erzählweise und direkt vor Ort Erlebtem eine zusätzliche Dimension bekommen. Zehn schonungslose Reportagen, die in Vielem zunächst hilflos zurücklassen; wer von uns kann schließlich schon Lieferkettengesetze auf den Weg bringen, die tatsächlich Arbeiter und Arbeiterinnen in den ärmsten Regionen dieser Welt vor Ausbeutung und miesesten Arbeitsbedingungen schützen? Wer kann allein den Klimawandel stoppen, Waldrodungen verhindern, Gewässer vor dem Austrocknen oder die Ausbeutung auf Kaffeeplantagen verhindern. Aber: Zum bald wiederkehrenden Valentinstag beispielsweise könnte man statt Rosen einmal Schneeglöckchen verschenken. Das wäre ein Anfang. Ein winziger Anfang. Immerhin.
Titelangaben
Jan Stremmel: Drecksarbeit
Geschichten aus dem Maschinenraum unseres bequemen Lebens
München: Knesebeck 2021
192 Seiten, 22 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander