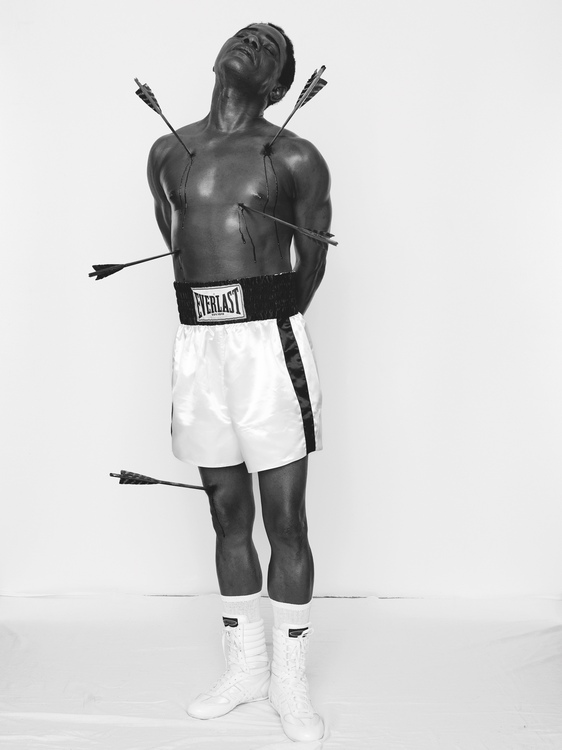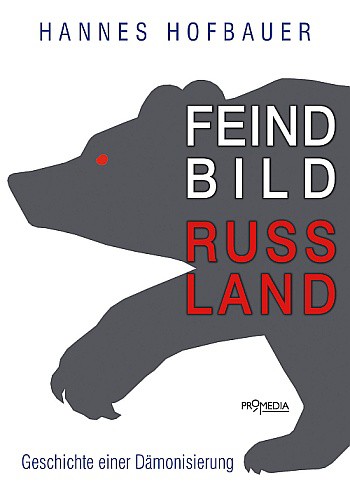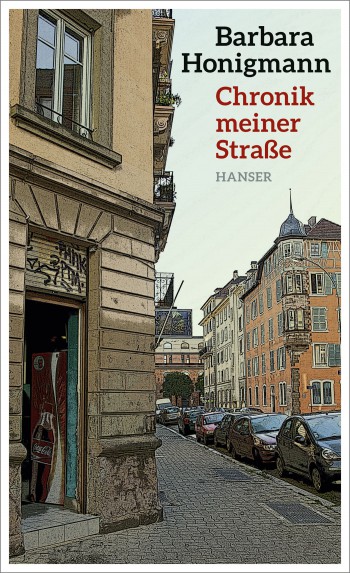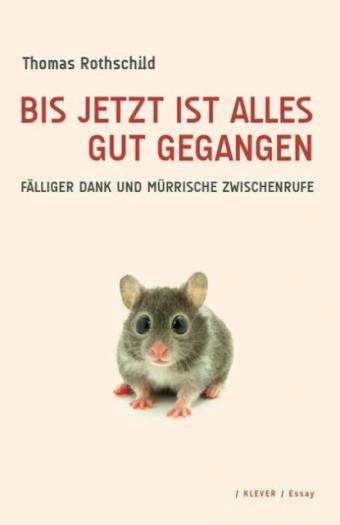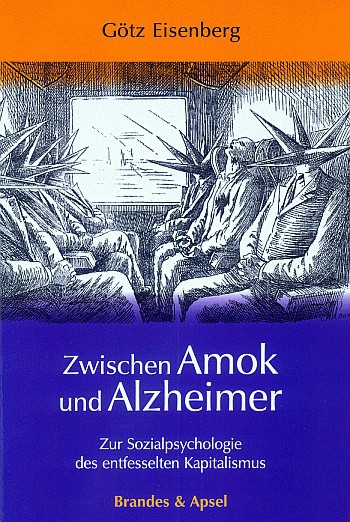Eines ist über die Zeit allgemein bekannt: sie ist immer zu knapp. Warum das so ist? Das wissen wir dann wieder nicht. Wir benutzen Waschmaschinen und Geschirrspüler, fahren unentwegt mit Autos und warten nicht mehr auf die Post, weil wir schnell eine Mail schreiben. Wir sparen derart viel Zeit, dass sie unmöglich zu knapp sein kann. Dass sie es dennoch ist, gehört zu ihrem Wesen.
Der Journalist und Autor Stefan Boes ist der Frage nachgegangen, wohin die Zeit verschwindet und wie wir sie zufriedenstellender nutzen können. Seine Erkenntnisse hat er in dem Buch mit dem vielversprechenden Titel »Zeitwohlstand für alle. Wie wir endlich tun, was uns wirklich wichtig ist« zusammengefasst.
Zeitwohlstand 1: Politische Wege für größere Stücke aus dem Zeitkuchen
 Im Groben und Ganzen ist das Buch zweigeteilt. Es gibt einen theoretischeren ersten Teil, der philosophische Anklänge hat und einen praktischeren zweiten Teil, der politisch ist. Dieser politische Teil des Buchs wendet sich der schnöden Realität des Zeithabens oder nicht Habens zu. Da geht es um Arbeitszeit, Care-Zeit, flexible Lebensläufe. Es geht um Lebensarbeitszeitkonten und wie diese zu erreichen seien. Es geht um die 4-Tage-Woche, Hartz IV, bedingungsloses Grundeinkommen und die Frage, wie unbezahlte Pflegearbeit entlohnt werden kann. Boes skizziert einen Zeitkuchen und überlegt, wie alle ein möglichst großes Stück abbekommen. Soweit die politische Dimension.
Im Groben und Ganzen ist das Buch zweigeteilt. Es gibt einen theoretischeren ersten Teil, der philosophische Anklänge hat und einen praktischeren zweiten Teil, der politisch ist. Dieser politische Teil des Buchs wendet sich der schnöden Realität des Zeithabens oder nicht Habens zu. Da geht es um Arbeitszeit, Care-Zeit, flexible Lebensläufe. Es geht um Lebensarbeitszeitkonten und wie diese zu erreichen seien. Es geht um die 4-Tage-Woche, Hartz IV, bedingungsloses Grundeinkommen und die Frage, wie unbezahlte Pflegearbeit entlohnt werden kann. Boes skizziert einen Zeitkuchen und überlegt, wie alle ein möglichst großes Stück abbekommen. Soweit die politische Dimension.
Was Zeitwohlstand bedeutet
Der philosophische Teil definiert Zeitwohlstand als frei verfügbare Zeit; also Zeit, die nicht für Arbeit oder andere Pflichten und Erledigungen aufgewendet werden muss. Allerdings befinden wir uns heutzutage in einem scheinbaren Paradoxon, welches als Zeit-Rebound-Effekt benannt wurde. »Der Zeit-Rebound-Effekt besagt, dass die zeitsparenden Techniken nicht in eine höhere Qualität der Zeit investiert werden, sondern dass sie unseren Anspruch verändern und die Nachfrage nach weiteren zeitsparenden Techniken steigt. Wir vermehren und verdichten unsere Erlebnisse. Dazu beschleunigen wir unser Lebenstempo. Nur eines gewinnen wir dadurch nie: Zeit.« (Seite 41)
Mehr Zeit führt also nicht automatisch zu Zeitwohlstand, sondern die Mehrzeit löst sich in einem immer größeren Angebot an Möglichkeiten auf. Der Moderator und Publizist Roger Willemsen hat dieses Phänomen sehr treffend zusammengefasst: »Wir beschleunigen das Leben in der Angst, wir könnten es verpassen. Und indem wir es beschleunigen, verpassen wir es.«
Die Technische Universität Berlin hat im Februar 2020 eine Studie begonnen, um herauszufinden, was Menschen mit Zeitwohlstand anfangen würden. Ganz vorne bei den Antworten stand schlafen, gefolgt von ausruhen, entspannen, nichts tun. Es sind die scheinbar banalsten und zugleich grundlegendsten Dinge, für die uns die Zeit fehlt. Die Forscher schlussfolgern, viele Menschen wollen eigentlich ganz anders leben, als sie es tun. Zeitwohlstand, so Boes, könnte den Weg zu diesem anderen Leben eröffnen.
Wie die Zeit die Zeit wurde
Um zu verstehen, was sich ändern soll, müssen wir verstehen, wo die Zeit herkommt. Eine Vorstellung von Zeit hatten die Menschen schon immer. Wer sein Essen erfolgreich anbauen wollte, der war auf die Beachtung der Jahreszeiten zwingend angewiesen. Mindestens also seit der Mensch ein Ackerbauer war, musste er die großen, natürlichen Zyklen beachten. Lustigerweise haben sich die Jahreszeiten und die Ernährung heute weitgehend entkoppelt.
Schon in der römischen Antike zählte der Politiker und Philosoph Cicero die Jahre sehr genau. Seine Beobachtungen und Reflexionen fasste er in der ebenso lesenswerten wie immer aktuellen Schrift »Keine Angst vor dem Älterwerden!« zusammen. Aber so richtig drängend wurde die Zeit für uns Menschen erst, als sie (zunehmend bis auf die Sekunde genau) getaktet – und man anschließend von diesem Takt abhängig wurde.
Als man noch als Schmied, Bäcker, Gerber arbeitete, schreibt Boes, stellte man her, was man konnte und es dauerte, bis es fertig war. Man selber war der Zeitgeber. Das änderte sich, als man sich zunehmend mit anderen Menschen abstimmen, als der Waren- und auch Personenverkehr über größere Strecken organisiert werden musste. Ein Zug braucht einen Fahrplan und Menschen brauchen die Zeit, um sich nach dem Fahrplan richten zu können.
Zeitwohlstand 2: Die kapitalistische Zeit – dem Wachstumsdenken entziehen
Seitdem wandelte sich die Zeit von einem Hilfsmittel des Wirtschaftens zum Taktgeber für die Wirtschaft. Mit der Einführung von Minuten und Sekunden beschleunigte sich die Wirtschaft und bald dominierte die Zeit jeden Winkel unseres Lebens. Diese Zeit ist die kapitalistische Zeit.
Boes empfiehlt, um zu mehr Zeitwohlstand zu kommen, man solle dich dem (kapitalistischen) Wachstumsdenken entziehen, den eigenen Konsum reduzieren und für sich eine Kultur der Genügsamkeit etablieren. Dann würde freie Zeit automatisch folgen und man selber zur Ruhe finden.
Innerhalb der kapitalistischen Logik hat Zeit immer einen Zweck. Freizeit zum Beispiel dient dazu Arbeitskraft wieder herzustellen. Ruhe aber findet man, wenn man sich einer Sache ganz widmen kann und sich sicher ist, dabei nicht gestört zu werden. Im Prinzip spiegelt dies genau das Ergebnis der Studie der TU Berlin. Die Menschen wünschen sich ziel- und absichtslose Zeit; eine Zeit, die für nichts verwendet werden muss.
Fazit
Insgesamt mag man sich Buchautor Stefan Boes gerne anschließen, wenn er schreibt: »Solange wir die Idee verfolgen, dass wir alles sein und haben können, laufen wir Gefahr, unter der Last der unbegrenzten Möglichkeiten zusammenzubrechen.« Auch das größte Stück aus dem Zeitkuchen kann dieser Gefahr nicht beikommen. Vielleicht ist diese Erkenntnis, das Wissen darum schon ausreichend – einen Weg dorthin, raus aus dem Hamsterrad kann »Zeitwohlstand für alle« leider nicht aufweisen. Man weiß nach dem Lesen zwar, was man tun sollte, aber nicht, wie es gelingen kann. Am Ende läuft vieles auf den Zeit-Rebound-Effekt hinaus. Wie man ihm entkommen kann, bleibt fraglich.
Der erste Teil des Buchs überzeugt inhaltlich und gedanklich. Er liefert eine ansprechende Geschichte der Zeit und ordnet ein, worin heute die Herausforderungen bestehen. Im zweiten Teil sind die politischen Forderungen zwar gerechtfertigt, aber sie sind wenig zielführend, wenn man die Forderung nach dem Ausstieg aus der kapitalistischen Wachstumslogik ernst nimmt, weil sie sich noch innerhalb der kapitalistischen Logik bewegen und nicht diese verlassen.
Titelangaben
Stefan Boes: Zeitwohlstand für alle
Wie wir endlich tun, was uns wirklich wichtig ist
Münster: Perspective Daily 2021
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe