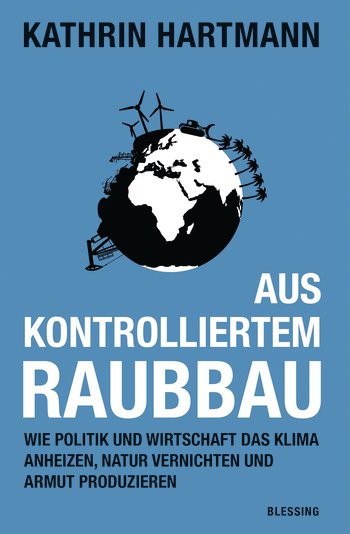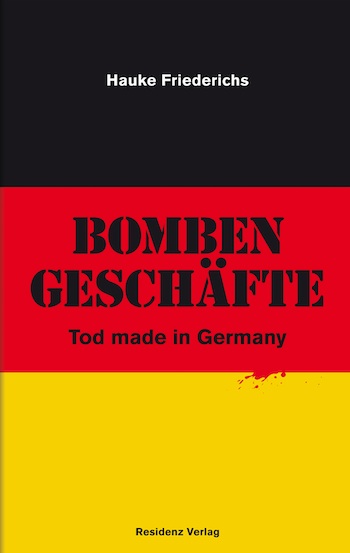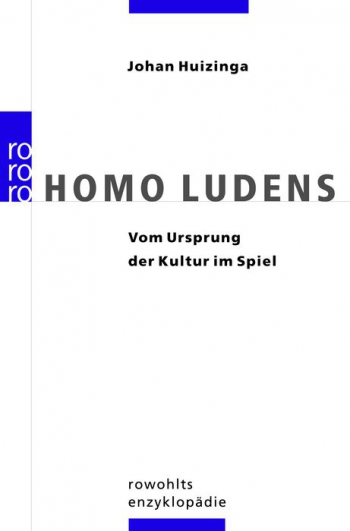Kulturbuch | Sabine Hank / Hermann Simon / Uwe Hank: Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften des Ersten Weltkrieges
Das wilhelminische Kaiserreich war ein Staat der schroffen Gegensätze, steckengeblieben irgendwo zwischen industrieller Moderne und ideologischem Mittelalter, zwischen Demokratie und Neoabsolutismus. Niemand bekam das mehr zu spüren als die jüdischen Deutschen. Von PETER BLASTENBREI
 Bismarcks Reichsverfassung von 1871 hatte sie rechtlich den Christen gleichgestellt, einklagbar war das aber nicht. Wilhelm II. etwa weigerte sich konstant, Juden zu Professoren oder Richtern zu ernennen oder gar zu Offizieren seiner geliebten Armee. Was es in dieser Situation hieß, Seelsorge für jüdische Soldaten zu betreiben, stellen Sabine Hank, Hermann Simon und Uwe Hank in Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften des Ersten Weltkrieges dar.
Bismarcks Reichsverfassung von 1871 hatte sie rechtlich den Christen gleichgestellt, einklagbar war das aber nicht. Wilhelm II. etwa weigerte sich konstant, Juden zu Professoren oder Richtern zu ernennen oder gar zu Offizieren seiner geliebten Armee. Was es in dieser Situation hieß, Seelsorge für jüdische Soldaten zu betreiben, stellen Sabine Hank, Hermann Simon und Uwe Hank in Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften des Ersten Weltkrieges dar.
Zuerst einmal hieß das, jüdische Militärseelsorge buchstäblich »zu erfinden«, denn so etwas gab es im Deutschen Reich im Frieden nicht – anders als in Österreich-Ungarn (1875), Frankreich (1880) oder Großbritannien (1892). Noch im August 1914 stellte daher der Verband der deutschen Juden als jüdische Dachorganisation einen entsprechenden Antrag an das preußische Kriegsministerium. Dann musste die Feldseelsorge selbst organisiert und nicht zuletzt vorfinanziert werden. Denn die deutschen Heeresstellen reagierten zwar positiv auf die Anfrage, doch erst ein Jahr später zahlten sie den Feldrabbinern eine reguläre Besoldung.
Alle Feldrabbiner waren Freiwillige, erfahrene Gemeinderabbiner, darunter so prominente Namen wie Leo Baeck (1873-1956), der spirituelle Führer der deutschen Juden während der Nazizeit. Ursprünglich wurde wegen der geringen Zahl jüdischer Soldaten jeder Feldarmee nur ein Rabbi zugeteilt, dies brachte aber ein anderes Problem mit sich: die großen Entfernungen, die die Feldrabbiner zurücklegen mussten, waren kaum zu bewältigen. Schließlich wurden ihnen Hilfsgeistliche unterstellt, meist Religionslehrer oder Rabbinatskandidaten.
Aufreibende Tätigkeit
Der Band besteht aus drei Teilen, den Biografien der Feldrabbiner, einer personenbezogenen Dokumentensammlung und den Protokollen der Rabbinerkonferenzen. Der biografische Teil umfasst alles, was man über die 30 Feldrabbiner und 15 Feldhilfsrabbiner weiß, eingeteilt in die Abschnitte Familie, Ausbildung, Berufsweg, Kriegsdienst und späteres Leben. Für die Aktivitäten der Rabbiner unter Kriegsbedingungen und generell zum Verhältnis von Juden und Nichtjuden im Ersten Weltkrieg ist der zweite Teil der wichtigste, der ihre Korrespondenzen mit dem Verband der deutschen Juden enthält.
Dieser Briefwechsel enthüllt die außerordentlich vielfältigen Tätigkeiten der Rabbiner, Gottesdienste, auch für jüdische Kriegsgefangene, Seelsorge in vielen Einzelgesprächen, Lazarettbesuche, Begräbnisse, Verteilen von geeigneter Literatur, Erarbeiten von Kriegsgebetbüchern, Kontakte zu Kommandobehörden und jüdischen Stellen zu Hause. Feldrabbiner waren unter Frontbedingungen unablässig auf Achse. Ein immer wiederkehrendes Thema in der Korrespondenz mit dem Verband der deutschen Juden sind die eigenen Aktivitäten und eben die ständigen Reiseschwierigkeiten, die sich in Russland oder auf dem Balkan zu alptraumhaften Dimensionen steigern konnten.
Ein weiteres Dauerthema des Briefwechsels sind die Finanzen. Die Offiziersbesoldung der Rabbiner reichte nicht für ihre Ausgaben, die karge Unteroffiziersbesoldung der Hilfsrabbiner noch weniger. Reisen kosteten, Ritualzubehör für Feiertage musste besorgt werden, gegen Ende des Krieges dann auch Nahrung für Soldaten, die im Feld koscher lebten. Die Feldrabbiner deckten die Kosten aus eigenem Vermögen, soweit vorhanden, ansonsten musste der jüdische Verband oder die Heimatgemeinde einspringen. Mazzen und Wein für den Pessachgottesdienst 1917 in Skopje zahlte z.B. die jüdische Gemeinde Essen.
Unerfüllte Hoffnungen
Vielfach ist das freundliche Wohlwollen der Militärführung für die jüdischen Seelsorger bezeugt. Nichtjüdische Offiziere besuchten Gottesdienste, Feldrabbiner wurden von Generälen eingeladen, Kommandeure stellten unaufgefordert Transportmittel bereit. Doch deutet hier vieles eher auf schieren Pragmatismus im Offizierskorps hin als auf bewusste »Ehrung des Judentums« (Rabbi Emil Levy). So meinte General von Heeringen, Chef der 7. Armee und bis 1913 preußischer Kriegsminister: »Ein gottesfürchtiger Soldat gleich welcher Religion ist ein guter Soldat« (S. 268).
Die Feldrabbiner entsprachen solchen Erwartungen. In der Regel überzeugte kaisertreue Nationalisten vermischte sich in ihrer Tätigkeit nicht anders als bei ihren christlichen Kollegen religiöser Zuspruch unmittelbar mit dem Aufruf zu Tapferkeit und Opfermut. »Es braust ein Ruf wie Donnerhall« als Teil des Gottesdienstes, das Gebet für den Kaiser mit der Thora im Arm oder ein zelebrierender Rabbi im Gebetsmantel mit Eisernem Kreuz – das haben damals nur sehr wenige als unpassend empfunden.
Dahinter steckte nicht zuletzt die Hoffnung, dass der Krieg antijüdische Vorbehalte endlich beseitigen könnte (die die Rabbiner noch ganz religiös verstanden). Mit Spannung wurden Beförderungen und Auszeichnungen jüdischer Kämpfer registriert; Emil Levy hat gegenüber dem Verband darüber regelrecht Buch geführt. Aber schon die erste Offiziersernennung eines Juden im November 1914 kam letztlich zu spät. Scharfsichtige wie Bruno Italiener waren schon im März 1915 skeptisch, denn »je näher dem Feinde, umsoweniger Vorurteile« (S. 276) – in der Etappe änderte sich nicht viel.
Die berüchtigte Judenzählung im Heer 1916/17 zeigte dann auch dem letzten jüdischen Soldaten, dass der Antisemitismus durch seine Tapferkeit nicht auszurotten war. Ihm sind langfristig auch die hier vorgestellten jüdischen Gelehrten zum Opfer gefallen. 26 von ihnen mussten Deutschland nach 1933 verlassen, sechs wurden ermordet.
Dem Autorentrio ist ein außerordentlich farbiges, informatives und spannendes Buch gelungen, eine Pionierarbeit, die fast ausschließlich aus ungedruckten Quellen erarbeitet wurde. 170 Abbildungen machen es zudem zu einer regelrecht opulenten und (mit 1,6 kg Gewicht auch physisch) gewichtigen Veröffentlichung.
Übrigens – die Bundeswehr hat bis heute keine Militärseelsorge für ihre jüdischen Soldaten.
| PETER BLASTENBREI
Titelangaben
Sabine Hank / Hermann Simon / Uwe Hank: Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften des Ersten Weltkrieges
Gemeinsam herausgegeben von der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum und dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr
(Schriftenreihe des Centrum Judaicum, Band 7)
Berlin: Hentrich & Hentrich-Verlag 2013. 624 Seiten, 48 Euro