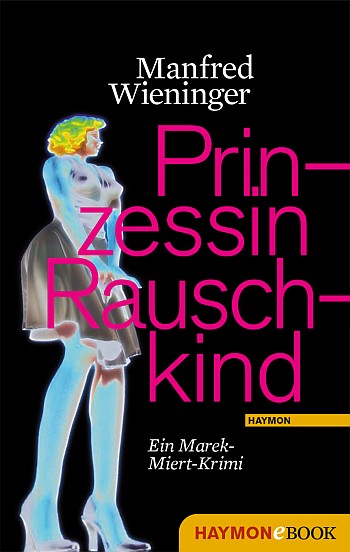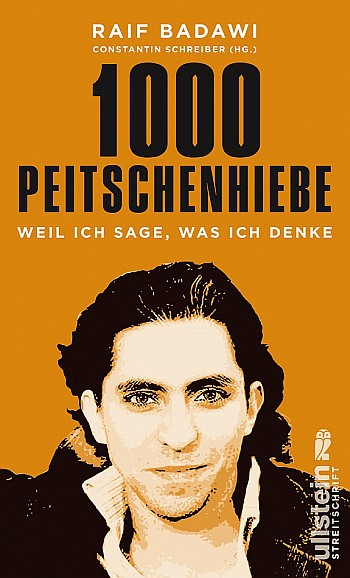Eine engagierte Analyse des Wissenschaftsbetriebs und zehn »Regeln« für eine kreativere Zukunft an deutschen Hochschulen. Von JOSEF BORDAT
 Es ist nicht besonders originell, über Eliten zu lästern. Wer in Deutschland über »die« Politiker, »die« Manager, »das« Fernsehen oder auch »die« Kirche herzieht, ist auf der sicheren Seite. Und je höher das Tier, das gerade geschlachtet wird, desto lauter der Applaus der Massen. Nach diesen einfachen Regeln lässt sich auf der Basis tatsächlicher Verfehlungen Einzelner publizistisch eine Menge gestalten. Ohne großen Aufwand: Zwar ändert die Sau, die durchs mediale Dorf getrieben wird, mit jeder neuen »Skandal!«-Welle geringfügig das Aussehen, doch die Wegstrecke ist stets die gleiche.
Es ist nicht besonders originell, über Eliten zu lästern. Wer in Deutschland über »die« Politiker, »die« Manager, »das« Fernsehen oder auch »die« Kirche herzieht, ist auf der sicheren Seite. Und je höher das Tier, das gerade geschlachtet wird, desto lauter der Applaus der Massen. Nach diesen einfachen Regeln lässt sich auf der Basis tatsächlicher Verfehlungen Einzelner publizistisch eine Menge gestalten. Ohne großen Aufwand: Zwar ändert die Sau, die durchs mediale Dorf getrieben wird, mit jeder neuen »Skandal!«-Welle geringfügig das Aussehen, doch die Wegstrecke ist stets die gleiche.
Auch »die Wissenschaft“ bekommt das zu spüren, obwohl deren hochrangige Vertreter im Elfenbeinturm oder Hochsicherheitslabor noch verhältnismäßig unbehelligt bleiben, schon deshalb, weil kaum jemand durchschaut, was dort eigentlich genau passiert. Doch das Bild des liebenswürdig zerstreuten Professors, der mit seiner Forschung für das Gute steht, ist in der letzten Zeit der Rhetorik vom arbeitsscheuen Abzocker gewichen, nicht zuletzt durch Uwe Kamenz’ und Martin Wehrles polemische Enthüllungsstudie ›Professor Untat. Was faul ist hinter den Hochschulkulissen‹ (2007).
Durchgefallen!
In die gleiche Kerbe – doch sehr viel tiefer! – schlagen die kritischen Analysen der Post-Bologna-Uni. Das ökonomisierte System »Wissenschaft« reizt zum Widerspruch, besonders, wenn es mit Vokabeln wie »Exzellenz« zum Befreiungsschlag ausholt, um mit einem Mal zu retten, was im »Sachzwang« (keine Zeit, kein Geld) unterzugehen droht: Qualität.
Richard Münchs feine Arbeit ›Die akademische Elite: Zur sozialen Konstruktion wissenschaftlicher Exzellenz‹ (2007) oder auch der vielschichtige Sammelband ›Die Illusion der Exzellenz – Lebenslügen der Wissenschaftspolitik‹ (2009), herausgegeben von Jürgen Kaube, zeugen von der Unzufriedenheit mit einer akademischen Welt, die sich vom Markt für Mittelklassewagen oder Erfrischungsgetränke prinzipiell nicht mehr unterscheidet.
Ähnlich nun Wolf Wagner. In ›Tatort Universität. Vom Versagen deutscher Hochschulen und ihrer Rettung‹ versucht der Autor des Bestsellers ›Uni-Angst und Uni-Bluff‹ (1992) nachzuweisen, dass die akademische Bildung systematisch am erklärten Ziel, kreative Köpfe zu fördern, vorbeischießt.
Dabei ist Bildung im »Land der Ideen« der wichtigste Rohstoff, eine Bildung, die als ganzheitliche Persönlichkeitsbildung im Sinne Humboldts (und ursprünglich, wie Wagner zeigt, Meister Eckharts) den Menschen befähigt, zu neuen Ufern vorzudringen bzw. zu werden, wie Gott uns gemeint hat, um den Ursprung des Begriffs »Bildung« bei Meister Eckhart aufzugreifen, die dem Menschen dazu diene, »sich dem Bilde Gottes, als das er äußerlich geschaffen war, auch innerlich [anzunähern]«.
Doch Bildung ist, nicht nur in dieser, sondern auch in der säkularisierten Version, hierzulande zu einem Problem geworden. PISA rückte das »Land der Dichter und Denker« ins OECD-Mittelfeld und bei der Tertiärbildung droht gar der Abstieg: Deutschland hat mit 22 Prozent Hochschulabsolventen ein sehr niedriges Bildungsniveau (von den G8-Staaten steht nur Italien schlechter da). Das heißt: Wir sind ziemlich blöd. Und: Deutschland ist das einzige Industrieland überhaupt, indem der Anteil der Hochschulabsolventen an der Gesamtbevölkerung bei den »Alten« (55 bis 64 Jahre) höher ist als bei den »Jungen« (25 bis 34 Jahre). Ergo: Wir verblöden weiter. Politik und Wirtschaft sind sich einig: So kann es nicht weiter gehen!
Schlüssel für Kreativität
Bevor nun Wagner erklärt, wie es unter dem Schlagwort »Innovation« (»Der Grad der Innovationsfähigkeit entscheidet heute mehr denn je über die Zukunft entwickelter Gesellschaften.«) stattdessen weiter gehen kann, erläutert er die individuellen und institutionellen Bedingungen, unter denen kreatives Arbeiten überhaupt nur möglich ist. Dass es nötig ist, dürfte klar sein: Kreativität ist für Neuerungsprozesse unerlässlich, Kreativität ist der Treibstoff, der den Innovationsmotor am Laufen hält. Doch Wagner konstatiert, dass diese so bitter nötige Ressource im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb nicht gefördert werde. Die kompetetive Mentalität und die hierarchische Struktur der deutschen Universität verhinderten, dass Freiräume »verrückten Denkens« (als Vorstufe des »exakten Denkens«) entstehen können, die nötig seien, damit sich neue Ideen jenseits von Kritik (oft genug auch Spott) und Fehlersuche (oft genug auch Pedanterie) entfalten können.
Mit der mangelnden Verfügbarkeit von Räumen kreativen Schaffens hängen, so Wagner, auch andere Probleme der deutschen Uni zusammen, etwa die mangelnde Offenheit nach außen, also die Einbeziehung der Bevölkerung in das Bildungsprogramm, sowie die strukturelle Selbstbezüglichkeit der Disziplinen, die voneinander abgegrenzte Fachkulturen hervorbrächten – trotz aller inter- und transdisziplinären Ansätze.
Ein Schlüssel für Kreativität ist das Zulassen von Fehlern, zumindest in der ersten Phase des schöpferischen Ausdenkens, dem sich freilich ein kritisches Nachdenken anschließen muss. Doch darf dieses nicht als »Schere im Kopf« oder, wie Wagner sagt, als »Selbstblockade« das zarte Pflänzchen der neuen Idee im Keim ersticken. Genau das geschehe jedoch, denn der Belohnungsapparat Universität (Wagner nennt sie auch »Reputationsmaschine«) konditioniere auf bestimmte Konformitäten, die dazu führten, Fehler möglichst zu vermeiden, indem man allen Risiken aus dem Weg gehe, und Fehler zu vertuschen, wenn sie trotzdem auftreten. Tragischerweise wird durch dieses eine Tradierung des Irrtums vorgenommen und durch jenes gerade die Kreativität gehemmt, denn: Neuerungen sind immer riskant, verbinden sie doch entlegene Gebiete, die sich jeweils durch eine eigene Sprache und Methode ausweisen und dadurch abzugrenzen, ja: zu isolieren versuchen.
Wer diese Grenzen überschreitet, wird weit kritischer beäugt als der, der sich im engen Rahmen des eigenen Forschungsfeldes bewegt. Und: Bei einem Fehlschlag droht in der »kalten«, »aggressiven« Welt der Wissenschaft besonders viel Häme. Das Problem besteht also darin, dass niemand gerne seine Anerkennung aufs Spiel setzt und sich zum Außenseiter macht. Das müsse der Kreative nämlich, so Wagner, denn im System, wie es sich derzeit darstelle, habe er keine Chance.
Engagiert, konstruktiv und nachvollziehbar
Im Anschluss daran betrachtet Wagner den Innovationsbegriff, dessen Geschichte und Bedeutung im Allgemeinen und die Verwendung im Kontext der Bildungspolitik, die mit einer italienischen Stadt verbunden ist: Bologna. Das dort festgezurrte Paket aus »Bachelor« und »Master« ließe sich durchaus aufknüpfen, um die Studierenden durch eigene, selbstbestimmte Projekte und »forschendes Lernen« zu gesteigerter Kreativität zu führen. Wagner nennt dies das »Google-Prinzip«, weil sich dieses Erfolgsunternehmen durch besondere Offenheit und Neuartigkeit auszeichne, die den Hochschulen (und ihren Studiengängen) als Vorbild dienen könne.
Dazu bedarf es eines Umbaus der Uni. Der Autor beschreibt ausführlich den institutionellen Reformbedarf und skizziert, wie eine Hochschule aussehen müsste, damit sich in ihr kreative Köpfe wohlfühlen. Das Leitmotiv laute dabei: »Structure follows function« – die Struktur der Universität muss deren Funktionen, Aufgaben und Leistungen stützen, nicht umgekehrt.
Nach diesem langen theoretischen Anlauf formuliert Wagner zehn praxisorientierte »Regeln« für eine kreative Hochschule. Die Anführungszeichen stehen auch im Original; Wagner bezieht die gewonnene Erkenntnis gleich auf die eigene Arbeitsweise, was keine Selbstverständlichkeit ist. Doch er weiß: Die Forderung nach unbedingter Beachtung eines zu starren Regel-Korsetts würde der Forderung nach mehr individuellen und institutionellen Freiräumen widersprechen. So sind die Regeln mehr als Angebote denn als Gebote zu verstehen. Im Mittelpunkt des Katalogs steht die gezielte Förderung kreativer Denkprozesse bei methodischer Offenheit, Selbstbestimmung und Ganzheitlichkeit von Bildung. Zugleich gehe es, so Wagner, um Demokratisierung und breite Beteiligung der Bevölkerung.
Wolf Wagners Kritik ist engagiert, konstruktiv und – durch die umfängliche Herleitung und kleinschrittige Gedankenführung – gut nachvollziehbar. Seine treffend formulierte Analyse vermag in der Ausrichtung nicht grundsätzlich zu überraschen – viele Missstände kann man erahnen, auch ohne im Wissenschaftsbetrieb zu arbeiten. Diese sich durchaus kulturell bzw. mentalitätsmäßig begründet und lassen sich ähnlich in anderen gesellschaftlichen Bereichen (etwa in der Verwaltung oder in Wirtschaftsunternehmen) aufweisen. Das lehrreiche und unterhaltsame Lesevergnügen wird lediglich etwas getrübt durch einige kleinere sachliche Mängel, die dem Korrektiv des »exakten Denkens« verborgen blieben – das »Ding an sich« stammt von Kant (nicht von Hegel), und wären Mendels Vererbungsregeln erst »500 Jahre später« anerkannt worden, wie der Autor schreibt, dann wären sie noch gar nicht anerkannt (sie stammen aus den 1860ern). Dennoch: Wolf Wagner hat mit ›Tatort Universität. Vom Versagen deutscher Hochschulen und ihrer Rettung‹ ein beachtliches Zeichen gesetzt.
Titelangaben
Wolf Wagner: Tatort Universität
Vom Versagen deutscher Hochschulen und ihrer Rettung
Stuttgart: Klett-Cotta 2010
187 Seiten, 16,90 Euro
Reinschauen
| Leseprobe