Kulturbuch | Bernhard Pörksen: Die große Gereiztheit
Algorithmen von Suchmaschinen sortieren meine Aktivitäten zu einem Persönlichkeitsprofil und lassen Werbespots auf mich los wie blutrünstige Kampfhunde. Ich blättere nach einem Gebrauchtwagen und werde von unerwünschten Anbietern belästigt. Ich suche eine Unterkunft in Mecklenburg, und diverse Anbieter stellen mir erneut wochenlang nach, mein Konsumverhalten wird überwacht. Von WOLF SENFF
 Wo anders gibt es derartige Geschäftspraktiken? Mich telefonisch heimzusuchen ist verboten, nun hilft das Internet, in meinen Alltag einzudringen. Die Apple, Windows & Co. haben mir eine Software angehängt, die ihnen private Räume öffnet und mit der sie massiv Rubel einfahren, und genau so selbstherrlich treten sie ja auf, die Thiel, Zuckerman & Co.
Wo anders gibt es derartige Geschäftspraktiken? Mich telefonisch heimzusuchen ist verboten, nun hilft das Internet, in meinen Alltag einzudringen. Die Apple, Windows & Co. haben mir eine Software angehängt, die ihnen private Räume öffnet und mit der sie massiv Rubel einfahren, und genau so selbstherrlich treten sie ja auf, die Thiel, Zuckerman & Co.
Ein Kulturbruch
Ihr Absatz floriert, sie führen die Welt aufs Glatteis. Missliche Konsequenzen sind ihnen schnuppe. Politik wird von ihnen am Nasenring durch die Manege geführt, für Schäden haftet der Steuerzahler. Erfolgreich? Nein, abgesehen von Thiel, Zuckerman & Co. sollte niemand von einem erfolgreichen Geschäftsmodell reden.
Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler, geht das Thema aus seiner eigenen Sicht vermutlich grundsätzlicher an, das Aufkommen der Digitalisierung sei ein medialer Kulturbruch, neben den traditionellen Medien entstehe eine fünfte Gewalt, die nicht nur eine Flucht in private Wirklichkeitskonstruktionen anbiete, sondern darüber hinaus eine diffuse Öffentlichkeit mit bisher unbekannter Bandbreite schaffe mit Platz für Wirklichkeitsentwürfe, die von Ideologien eingefärbt seien, aber auch Platz für separate Kampagnen böten vom Shitstorm und Trollerei bis hin zur erfolgreichen Umweltaktion.
Informationelle Selbstbestimmung
Diese Öffentlichkeit intensiver Diskursaktivitäten sei qualitativ neu, Pörksen charakterisiert sie als Empörungsdemokratie, die Medienmacht sei heutzutage überall, sie habe sich gewissermaßen demokratisiert, sie agiere mit atemberaubender Geschwindigkeit, einst festgefügte Hierarchien seien eingeebnet, anstelle des zentral ausspähenden Überwachungsturms gebe es eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich gegenseitig auszuforschen. Die Wirklichkeit sei transparent, und das habe nun einmal gute wie schlechte Auswirkungen. Wo er recht hat, hat er recht. Doch besonders tiefschürfend klingt das nicht.
Einhergehend mit dem tendenziellen Verlust informationeller Selbstbestimmung fürchtet er um einen generellen Verlust von Autorität und hält die fortwährende Enttäuschung und die Wut über das behauptete moralische Versagen der politischen Eliten bereits für den Ausfluss dessen, was er Fünfte Gewalt nennt.
Schmetterlingseffekt
Leider verfestigt sich der Eindruck, Pörksen sei selbst von der Erregung ergriffen, von der er seine Leser befreien will. Das ist nicht eben förderlich. Klagen um rasante Beschleunigung lasen wir vor einigen Jahrzehnten bei Paul Virilio, und das Einbringen von Terminologie aus der Netzaktivistenszene – Filter Bubble, Filter Clash, FOMO u.a.m. – imponiert nicht jedem. »Unterschiedlichste Varianten der Weltwahrnehmung prallen in radikaler Unmittelbarkeit aufeinander« – geht’s noch?
Er findet einen »Schock der Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren« und redet uns ein, das sei ein völlig neues Phänomen, und auch der »digitale Schmetterlingseffekt« verweist lediglich wieder auf die erwähnte Beschleunigung und die Überwindung räumlicher Distanzen. Dass der Firnis der Zivilisation dünn sei, ist ein allseits geläufiger Topos, Pörksen trägt dazu weitere Beispiele bei und illustriert das Wirken einer Emotions- und Erregungsindustrie.
Ethikkommissionen
Er verweist auf Mechanismen der Skandalisierung und hält eine Art Ethikkommission für erforderlich, deren Wertegerüst, klar, auch Fundament schulischer Medienerziehung sein müsse, so dass eine redaktionelle Gesellschaft entstehen könne.
Man darf den Ausführungen zugutehalten, dass sie gut gemeint sind. Aber eine Ethikkommission? Bernhard Pörksen gewinnt seinen Blick aus einer Perspektive, für die Fragen von Ökonomie und Macht nicht zu existieren scheinen. Er verkennt auch den Adressaten. Der sind weder die Pädagogen, noch ist es in erster Linie die Politik; Veränderung wäre von den Konzernen zu verlangen. Denen müssen Grenzen gesetzt werden.
Kosten-Nutzen-Bilanzen
Seine Ergebnisse sind nicht besonders originell, sie überraschen nicht. Er scheint allen Ernstes anzunehmen, dass die Strategie der IT-Konzerne sich an moralischen Kriterien orientieren könnte oder überhaupt moralische Bedenken in Betracht ziehen würde. Da ist er auf dem Holzweg, und eigentlich sollte man nicht erwarten, dass Bernhard Pörksen mit einem so zentralen Thema so unkritisch, so naiv umgeht und sich überdies weigert, wahrzunehmen, dass zahlreiche ›User‹, vor allem Kinder und Jugendliche, zu Opfern des Internets werden. Seine Verengung auf medienwissenschaftliche Betrachtung greift nicht.
Es ist keine drei Wochen her, dass infolge eines Elektrizitätsausfalls auf einem großen Flughafen der USA der Flugverkehr tagelang eingestellt wurde. Das ist kein Einzelfall, und es wäre für Deutschland wie für Europa an der Zeit, eine Kosten-Nutzen-Bilanz zu erarbeiten, eine Bestandsaufnahme.
Interesse der Gemeinschaft
Denn ohne Zweifel (und nicht nur weil die Konzerne keine angemessenen Steuern zahlen) verursacht die IT-Kultur erhebliche Schäden, deren Begleichung – Wie teuer kommen uns eigentlich die Hacker zu stehen? – letzten Endes aus öffentlichen Haushalten finanziert wird. Es gilt sich von dem Rausch freizumachen, der den so zuckerwattesüßen Verheißungen der IT-Kultur innewohnt.
Anstatt Ethik-Kommissionen zu etablieren, ist durch staatliche Regulierung zu gewährleisten, dass die IT-Kultur sich weniger am privaten Profit orientiert, sondern sich dem berechtigten Interesse der Gemeinschaft unterordnet. Wenn ein ICE trotz neuester Bahn-Technologie mal wieder in Wolfsburg nicht hält, kommt ja auch nicht der Steuerzahler für die entstehenden Regress-Ansprüche auf.
Titelangaben
Bernhard Pörksen: Die große Gereiztheit
Wege aus der kollektiven Erregung
München: Hanser 2018
256 Seiten, 22 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe





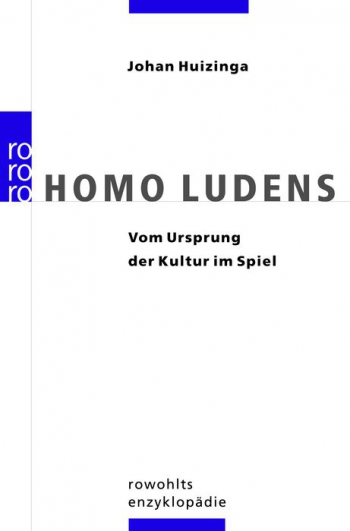

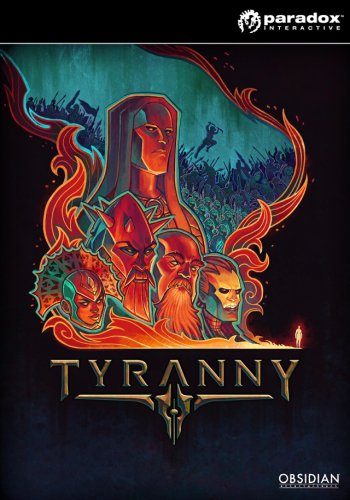
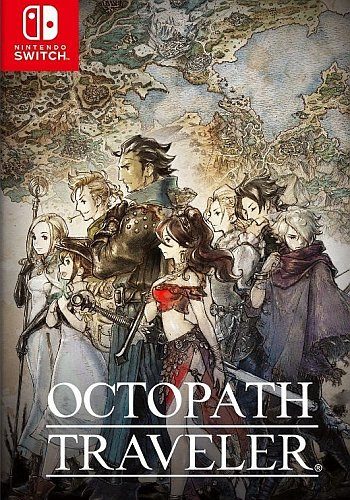
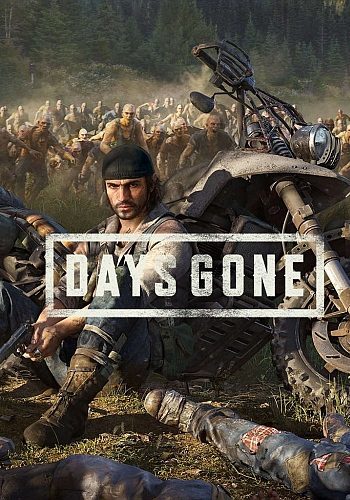

[…] B. Pörksen: Die große Gereiztheit | TITEL kulturmagazin “Er scheint allen Ernstes anzunehmen, dass die Strategie der IT-Konzerne sich an moralischen Kriterien orientieren könnte oder überhaupt moralische Bedenken in Betracht ziehen würde. Da ist er auf dem Holzweg, und eigentlich sollte man nicht erwarten, dass Bernhard Pörksen mit einem so zentralen Thema so unkritisch, so naiv umgeht und sich überdies weigert, wahrzunehmen, dass zahlreiche ›User‹, vor allem Kinder und Jugendliche, zu Opfern des Internets werden.” […]