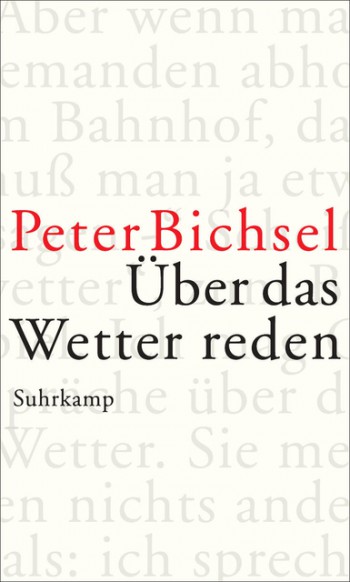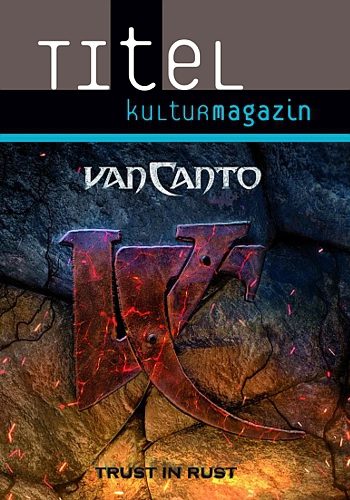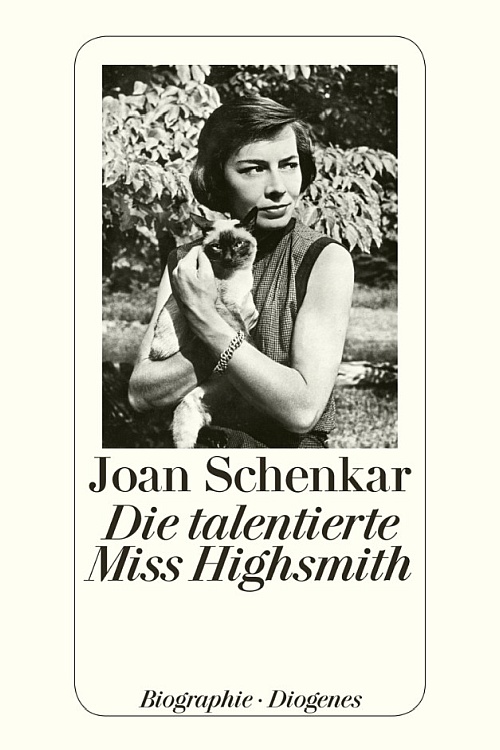Als das Stockholmer Nobelpreiskomitee im Oktober 1996 seine Entscheidung zugunsten von Wisława Szymborska bekannt gab und sie als »Mozart der Poesie« rühmte, hielt sich die Lyrikerin gerade in einem Erholungsheim für polnische Autoren in Zakopane auf. Szymborska zeigte sich überrascht über die ihr zugesprochene bedeutendste Auszeichnung in der literarischen Welt: »Ich freue mich enorm, bin aber gleichzeitig erschrocken. Es ist auch eine hohe Auszeichnung für die ganze polnische Poesie.« Nach Henryk Sienkiewicz (1905), Wladyslaw Reymont (1924) und Czeslaw Milosz (1980) ging der Nobelpreis 1996 erst zum vierten Mal nach Polen. Von PETER MOHR
Während in der offiziellen Begründung der Stockholmer Jury hervorgehoben wurde, dass Wisława Szymborska »mit ironischer Präzision den historischen und biologischen Zusammenhang in Fragmenten menschlicher Wirklichkeit hervortreten lässt«, formulierte der international renommierte (im Jahr 2000 verstorbene) polnische Romancier Andrzej Szczypiorski (›Die schöne Frau Seidenmann‹, ›Eine Messe für die Stadt Arras‹), seine Glückwünsche auf ganz persönliche Art: »Sie ist eine große Dichterin und eine wunderbare Frau«.
Wisława Szymborska, die ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit fern hielt, war immer eine bescheidene und zurückhaltende Frau: »Wenn ich schreibe, habe ich immer das Gefühl, jemand steht hinter mir und schneidet Grimassen. Deshalb hüte ich mich, so gut ich kann, vor großen Worten.« Skepsis und Neugierde standen in ihrem Werk stets im Vordergrund, die Verkündung dichterischer Botschaften mit dem Anspruch der Unantastbarkeit war Szymborska fremd. In ihrem Gedichtband ›Der Augenblick‹ (2005, Suhrkamp Verlag) eröffnete sie stattdessen »ein Verzeichnis von Fragen, deren Beantwortung ich nicht erleben werde«.
Szymborska hat sich in über 60 Jahren mit 17 Gedichtbänden den Ruf als »erste Dame der polnischen Poesie« erworben. Ihre Lyrik wurde sogar ins Arabische, Hebräische, Japanische und Chinesische übersetzt. Schon 1991 ehrte die Stadt Frankfurt am Main die »große Humanistin Europas« mit ihrem Goethe-Preis. Szymborska hatte sich zwar im Gegensatz zu anderen bekannten schreibenden Landsleuten nur selten öffentlich politisch engagiert (1966 war die Lyrikerin aus der Kommunistischen Partei ausgetreten), doch die Zeiten des Außenseitertums und der Lesungen mit nur zwölf Zuhörern gehörten für die Schriftstellerin seit 1996 endgültig der Vergangenheit an. Als »unersetzlichen Verlust für die polnische Kultur«, hatte der damalige polnische Außenminister Radoslaw Sikorski den Tod der Nobelpreisträgerin bezeichnet.
Wisława Szymborska, die am 2. Juli 1923 in Bnin bei Posen geboren wurde, studierte polnische Sprache, Literatur und Soziologie in Krakau, wo sie seit 1931 lebte. Ihr literarisches Debüt gab sie 1945 mit dem in der Tageszeitung ›Dziennik Polski‹ veröffentlichten Gedicht ›Ich suche das Wort‹. Von 1953 bis 1981 arbeitete die Lyrikerin in der Redaktion der Zeitschrift »Das literarische Leben«, für die sie auch viele Rezensionen schrieb. Ihre Gedichte, die nicht selten ins Prosaische und Aphoristische drängten, kamen ohne philosophisch-theoretischen Überbau daher.
Eines ihrer schönsten Gedichte heißt ›Autorenabend‹: »Muse, kein Boxer zu sein bedeutet, gar nicht zu sein./ Das brüllende Publikum hast du uns nicht gegönnt./ Zwölf Zuhörer sind im Saal/ Zeit anzufangen/ Die Hälfte ist da, weil es regnet/ der Rest sind Verwandte. Muse!« Diese Form der lakonisch vorgetragenen, reflexiven Selbstironie ist durchaus charakteristisch für das gesamte Oeuvre.
Ihrer gesellschaftlichen Randexistenz als Dichterin war sich Wisława Szymborska immer bewusst. In »Auf Wiedersehen bis morgen« schrieb sie: »Manche mögen Poesie/ man mag ja auch Nudelsuppe/ mag auch Hunde streicheln.« Es waren alltägliche, unpathetische Momentaufnahmen, die ihre Gedichte prägten: spontane emotionale Befindlichkeiten oder Beobachtungen, die mit fotografischer Präzision in Sprache verwandelt werden.
Pünktlich zum 100. Geburtstag hat der Suhrkamp Verlag zwei Werke der Nobelpreisträgerin neu aufgelegt. Am 1. Februar 2011 ist Polens bedeutendste Lyrikerin im Alter von 88 Jahren in Krakau gestorben. Eine poetische Stimme von großer Wandlungsfähigkeit.
Titelangaben
Wisława Szymborska: Gesammelte Gedichte
Frankfurt: Suhrkamp Verlag 2023
448 Seiten, 25 Euro
Wisława Szymborska: Sie sollten dringend den Kugelschreiber wechseln
Anregungen für angehende Literaten
Frankfurt: Suhrkamp Verlag 2023
152 Seiten, 12 Euro